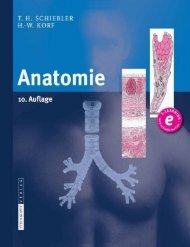Biologie Buchzusammenfassung
Biologie Buchzusammenfassung
Biologie Buchzusammenfassung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Biologie</strong> <strong>Buchzusammenfassung</strong><br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einführung....................................................................................................................................... 2<br />
2 Stoffwechsel.................................................................................................................................... 5<br />
Stoffwechsel, Energie und Leben ..................................................................................................... 5<br />
3 Ein Rundgang durch die Zelle ....................................................................................................... 7<br />
4 Membranen: Struktur und Funktion.............................................................................................. 8<br />
Struktur biologischer Membranen..................................................................................................... 8<br />
Stofftransport durch biologische Membranen ................................................................................... 9<br />
5 Zellatmung: Gewinnung chemischer Energie............................................................................ 13<br />
Prinzipien der Energiegewinnung ................................................................................................... 13<br />
Ablauf der Zellatmung..................................................................................................................... 14<br />
Chemiosmotische Theorie .............................................................................................................. 14<br />
6 Photosynthese .............................................................................................................................. 15<br />
7 Reproduktionsbiologie, Der Zellzyklus ...................................................................................... 19<br />
Zellzyklus und Mitose...................................................................................................................... 20<br />
Die Kontrolle des Zellzyklus............................................................................................................ 24<br />
8 Reproduktionsbiologie, sexuelle Entwicklungszyklen ............................................................. 26<br />
Prozesse der Befruchtung und der Meiose .................................................................................... 27<br />
Unterschiede zwischen Mitose und Meiose.................................................................................... 32<br />
Ursprünge genetischer Variabilität.................................................................................................. 33<br />
9 Mendel und der Genbegriff .......................................................................................................... 34<br />
Uniformitätsgesetz .......................................................................................................................... 35<br />
Spaltungsregel ................................................................................................................................ 36<br />
Rückkreuzung ................................................................................................................................. 37<br />
Gesetz der freien Kombinierbarkeit ................................................................................................ 37<br />
Erweiterung der Mendel-Genetik .................................................................................................... 38<br />
10 Chromosomen – Theorie der Vererbung.................................................................................... 40<br />
Geschlechtschromosomen ............................................................................................................. 40<br />
11 Evolutionsbiologie........................................................................................................................ 42<br />
Charles Darwin (Pfarrer) ................................................................................................................. 42<br />
Theorie der Anpassung einer Art.................................................................................................... 43<br />
Evolution von Populationen ............................................................................................................ 45<br />
Änderungen im Genpool ................................................................................................................. 46<br />
Evolution und Sexualität ................................................................................................................. 48<br />
12 Die Entstehung der Arten............................................................................................................. 48<br />
Teilung der Population .................................................................................................................... 48<br />
Möglichkeiten der Artbildung........................................................................................................... 48<br />
Reproduktionsbarrieren .................................................................................................................. 48<br />
Makroevolution................................................................................................................................ 48<br />
13 Phylogenie und Systematik ......................................................................................................... 48<br />
Fossilbelege und geologische Zeit.................................................................................................. 48<br />
14 Die junge Erde und die Entstehung des Lebens ....................................................................... 48<br />
Einführung in die Geschichte des Lebens ...................................................................................... 48<br />
Der Ursprung des Lebens............................................................................................................... 48<br />
Die Hauptlinien des Lebens............................................................................................................ 48<br />
15 Verhaltensbiologie........................................................................................................................ 48<br />
Angeborenes Verhalten .................................................................................................................. 48<br />
Lernen ............................................................................................................................................. 48<br />
Sozialverhalten und Soziobiologie.................................................................................................. 48<br />
16 Glossar........................................................................................................................................... 48
1 Einführung<br />
(Kapitel 1)<br />
Die Erforschung des Lebens auf seinen vielen Ebenen<br />
Jede biologische Organisationsebene weist emergente Eigenschaften auf.<br />
Räumlicher Aspekt<br />
• (Biosphäre)<br />
• Oekosystem<br />
• Biocönose<br />
• Population<br />
• Organismus<br />
• Organsysteme<br />
• Organe<br />
• Gewebe<br />
• Zellen<br />
• Organellen<br />
• Moleküle<br />
• Atome<br />
Energie (E = m * c 2 )<br />
Zeitliche Aspekt<br />
Raum<br />
Fortpflanzung<br />
Ökologie<br />
Anatomie Physiologie<br />
Zytologie<br />
Molekularbiologie<br />
Genetik = Übertragung von Informationen<br />
Ontogenese = eine Lebensphase<br />
Phylogenese = ganze Lebensgeschichte<br />
Zellen sind die Basiseinheiten der Struktur und Funktionen eines Lebewesens.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 2 / 70<br />
Zeit<br />
Die Eukaryotenzelle, die man in Pflanzen,<br />
Tieren und allen anderen Organismen<br />
mit Ausnahme der Archaebakterien<br />
und Eubakterien findet, ist durch<br />
eine starke Unterteilung in viele verschiedene<br />
Kompartimente oder Organellen<br />
gekennzeichnet. Der Aufbau der<br />
für Archae- und Eubakterien typischen<br />
Prokaryotenzelle dagegen ist viel einfacher;<br />
es fehlen ihr die meisten Organellen<br />
der Eukaryoten-zelle. Die meisten<br />
prokaryotischen Zellen sind ausserdem<br />
viel kleiner als Eukaryotenzellen.
Die Kontinuität des Lebens beruht auf vererbbarer Information in Form von DNA.<br />
Erbinformation (DNS = Desoxyribonukleinsäure)<br />
Hat 4 Buchstaben (Moleküle): Cytosin, Guanin, Thymin, Adenosin<br />
Biodiversität<br />
bezeichnet die Vielfalt der Lebewesen auf der Erde und umfasst die Vielfalt innerhalb von<br />
Arten (z.B. genetische Unterschiede zwischen Individuen und Populationen), zwischen Arten<br />
sowie die Vielfalt von Lebensgemeinschaften und Ökosystemen.<br />
Struktur und Funktion sind auf allen biologischen Organisationsebenen miteinander<br />
verkoppelt.<br />
Phylogenese (Stammbäume)<br />
Evolution = ist eine Veränderung der Lebewesen in Anpassung an die Umwelt.<br />
-> Leben ist dynamisch wandelbar.<br />
Die Natur schafft eine Variabilität (Vielfalt).<br />
Konzept der Evolution von Charles Darvin.<br />
Organismen sind offene Systeme, die kontinuierlich mit ihrer Umwelt in Wechselbeziehung<br />
stehen.<br />
Offene Systeme<br />
(Bsp. Lebewesen)<br />
Leben kann sich erhalten. Energie und Stoffe werden dazugegeben.<br />
Struktur lebender Systemgrenzen = Membranen = selektiv und semipermeabel<br />
Moleküle: hydrophober Schwanz, hydrophiler Kopf<br />
Geschlossene Systeme<br />
(Bsp. Erde)<br />
Nach längerer Zeit kommt die Auflösung. Energie wird hinzugefügt, jedoch keine Stoffe.<br />
Isolierte Systeme<br />
Übrig bleibt nichts mehr. Sie sind von der Umwelt isoliert. Es wird keine Energie und auch<br />
keine Stoffe hinzugefügt.<br />
Beim Organismus gilt der zweite Thermodynamische Hauptsatz nicht.<br />
Regulationsmechanismen sorgen in lebenden Systemen für ein dynamisches Gleichgewicht.<br />
Homöostase = Sie halten einen Zustand konstant. Dazu muss der Organismus einen<br />
Regelungsmechanismus haben. Der Begriff ist von dem griechischen Wort für »gleichartig,<br />
ähnlich« abgeleitet und bezeichnet das ständige Bestreben des Organismus, verschiedene<br />
physiologische Funktionen (wie Körpertemperatur, Pulsschlag, Blutzuckerspiegel u.a.)<br />
einander anzugleichen und diesen Zustand möglichst konstant zu halten. Dadurch wird die<br />
Anpassung an die Umwelt optimiert, der Kräfteaufwand zur Lebenserhaltung minimiert.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 3 / 70
Die Zehn verbindenden Leitthemen der <strong>Biologie</strong><br />
Emergente Eigenschaften<br />
Die Welt der Lebewesen ist hierarchisch organisiert, von Molekülen bis hin zur Biosphäre.<br />
Mit jedem Schritt auf eine höhere Organisationsstufe tauchen infolge von Wechselbeziehungen<br />
zwischen Bestandteilen der niedrigeren Ebenen neue Eigenschaften auf.<br />
Die Zelle<br />
Zellen sind die grundlegenden strukturellen und funktionellen Einheiten aller Organismen.<br />
Die beiden Hauptzelltypen sind die prokaryotischen Zellen von Archaebakterien und<br />
Eubakterien sowie die eukaryotischen Zellen von Protisten, Pflanzen, Pilzen und Tieren.<br />
Erbinformation<br />
Damit Leben kontinuierlich fortbestehen kann, muss die biologische Information in Form der<br />
DNA-Moleküle vererbt werden. Diese genetische Information ist in den Nucleotidsequenzen<br />
der DNA verschlüsselt.<br />
Struktur und Funktion<br />
Form und Funktion sind auf allen biologischen Organisationsebenen miteinander gekoppelt.<br />
Wechselbeziehungen mit der Umwelt<br />
Organismen sind offene Systeme, die Stoffe und Energie mit ihrer Umwelt austauschen. Zur<br />
Umwelt eines Organismus gehören andere Lebewesen ebenso wie unbelebte Faktoren.<br />
Regulation<br />
Biologische Systeme werden durch Rückkopplungsmechanismen reguliert. In manchen<br />
Fällen wird durch die Regulation ein Zustand der Homöostase aufrechterhalten, ein relativer<br />
Gleichgewichtszustand innerer Faktoren wie der Körpertemperatur.<br />
Einheitlichkeit und Vielfalt<br />
Biologen teilen die biologische Vielfalt in drei Domänen ein: Bacteria, Archaea und Eukarya.<br />
Aber so vielfältig das Leben ist, wir finden auch viele Gemeinsamkeiten wie den universellen<br />
genetischen Code. Je näher zwei Arten miteinander verwandt sind, desto mehr Merkmale<br />
haben sie gemeinsam.<br />
Evolution<br />
Die Evolution, das zentrale Thema der <strong>Biologie</strong>, erklärt sowohl die Vielfalt des Lebens.<br />
Darwins Theorie der natürlichen Selektion erklärt die Anpassung von Populationen an ihre<br />
Umwelt mit dem unterschiedlichen Fortpflanzungserfolg verschiedener Individuen.<br />
Naturwissenschaftliche Forschung<br />
Naturwissenschaftliche Forschung setzt sich aus empirischen, auf Beobachtung beruhenden<br />
Entdeckungen und der hypothesischdeduktiven Überprüfung von Erklärungen zusammen.<br />
Die Glaubwürdigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse hängt davon ab, ob die<br />
Beobachtungen und Experimente wiederholbar sind.<br />
Wissenschaft, Technik und Gesellschaft<br />
Viele Technologien sind zielgerichtete Anwendungen naturwissenschaftlicher<br />
Forschungsergebnisse. Sich über die Beziehung zwischen Wissenschaft, Technik und<br />
Gesellschaft im Klaren zu sein, ist heute wichtiger als je zuvor.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 4 / 70
2 Stoffwechsel<br />
(Kapitel 6)<br />
Stoffwechsel, Energie und Leben<br />
Die Chemie des Lebens ist in Stoffwechselwegen organisiert. Der Stoffwechsel ist die Summe<br />
der chemischen Reaktionen, die in einem Organismus auftreten. Unter Mithilfe von<br />
Enzymen verläuft er entlang sich verzweigender Stoffwechselwege, die katabol (Moleküle<br />
abbauend, Energie freisetzend) oder anabol (Moleküle aufbauend, Energie verbrauchend)<br />
sein können.<br />
Organismen wandeln Energie um. Energie ist das Vermögen, Arbeit zu leisten, beispielsweise<br />
Materie zu bewegen. Ein sich bewegendes Objekt hat kinetische Energie. Potenzielle<br />
Energie ist in der Lage oder der Struktur von Materie gespeichert und schliesst chemische<br />
Energie ein, die in der Molekülstruktur gespeichert ist. Energie kann im Rahmen der<br />
thermodynamischen Gesetze verschiedene Formen annehmen.<br />
Die Energieumwandlungen der Lebensprozesse gehorchen zwei Gesetzen der Thermodynamik.<br />
Nach dem ersten Gesetz, dem Energieerhaltungssatz, kann Energie weder<br />
erzeugt noch zerstört werden. Das zweite Gesetz besagt, dass bei jeder Energieänderung<br />
die Entropie (S) beziehungsweise die Unordnung im Universum zunimmt. Materie kann nur<br />
geordneter werden, wenn die Unordnung der Umgebung wächst.<br />
1. Hauptsatz<br />
„Energie kann übertragen und umgewandelt, aber weder erzeugt noch zerstört werden“<br />
(Beispiel: Stausee, Turbine, hat potential Arbeit zu leisten, Potentielle Energie)<br />
2. Hauptsatz<br />
„Jeder Energietransfer oder Energiewandel vergrössert die Unordnung (Entropie) des<br />
Universums)“. Wird oft als Wärme (vermehrte ungeordnete Teilchenbewegung) ersichtlich.<br />
In jedem System gibt es eine Entropie. Entropie = Mass für Ordnung. Bessere Ordnung,<br />
Entropie nimmt ab.<br />
(Beispiel: mit der Zeit bleibt von der Blume nichts mehr übrig => grösste mögliche<br />
Unordnung => Entropie nimmt zu.)<br />
3. Hauptsatz<br />
Der dritte Hauptsatz ist quantentheoretischer Natur und verbietet es, ein System bis zum<br />
absoluten Nullpunkt abkühlen zu können.<br />
Entropie in Lebewesen nimmt ab oder bleibt. Sie nimmt erst dann zu, wenn das Lebewesen<br />
stirbt.<br />
Ohne Energie zerfällt alles -> Entropie nimmt zu.<br />
Bsp. Ein Krokodil 8m Länge in einem Käfig 4m Länge.<br />
Krokodil wird nicht länger als 4m, egal ob sein Programm eigentlich 8m vorgesehen hat.<br />
-> Die Umwelt kann Einfluss nehmen auf die Entwicklung (auf das Programm eines<br />
Lebewesens).<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 5 / 70
Organismen leben von freier Energie, die sie ihrer Umgebung entziehen. Die freie Energie<br />
eines lebenden Systems ist diejenige Energie, die unter zellulären Bedingungen tatsächlich<br />
Arbeit verrichten kann. Die freie Energie (G) steht mit der inneren Energie (H) und mit der<br />
Entropie (S) in folgendem Zusammenhang: ∆G = ∆H - T∆S. Spontane Veränderungen<br />
gehen mit einer Abnahme an freier Energie einher (-∆G). In einer exergonischen<br />
(spontanen) Reaktion sind die Produkte ärmer an freier Energie als die Reaktanden (-∆G).<br />
Endergonische (unfreiwillige) Teilreaktionen erfordern Energiezufuhr (+∆G). Im zellulären<br />
Stoffwechsel werden exergonische Teilreaktionen benutzt, um endergonische anzutreiben<br />
(Energiekopplung). Die Zugabe von Ausgangsstoffen (Reaktanden) und das Entfernen von<br />
Stoffwechselprodukten verhindern, dass der Stoffwechsel das chemische Gleichgewicht<br />
erreicht. Es herrscht ein Fliessgleichgewicht.<br />
Lebende Systeme entziehen der Umgebung hochwertige Energie. Energie, die Arbeit leisten<br />
könnte => Freie Energie!!<br />
Freie Energie: G = H -TS<br />
G: freie Energie<br />
H: Enthalpie (innere Energie) eines Systems<br />
T: Temperatur in K<br />
S: Entropie<br />
(TS: Unordnung des Systems)<br />
Bei jeder spontanen Reaktion nimmt die freie Energie ab.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 6 / 70
3 Ein Rundgang durch die Zelle<br />
(Kapitel 7)<br />
Wie man Zellen untersucht<br />
Mikroskope eröffnen Einblicke in das Innenleben<br />
der Zellen<br />
Andere membranumhüllte Organellen<br />
Mitochondrien und Chloroplasten sind die<br />
hauptsächlichen Energiewandler der Zellen.<br />
Die Mitochondrien, bei Eukaryoten der Ort der<br />
Zellatmung, besitzen eine Aussenmembran und<br />
eine innere Membran, die zu Cristae gefaltet ist.<br />
Manche Reaktionen der Zellatmung finden in der<br />
von der Innenmembran umschlossenen Matrix statt,<br />
andere werden von Enzymen katalysiert, die in die<br />
Innenmembran eingebettet sind.<br />
Chloroplasten enthalten Chlorophyll und andere<br />
Pigmente, die an der Photosynthese mitwirken. Die<br />
beiden Chloroplastenmembranen schliessen das<br />
flüssige Stroma ein, in dem die zu Stapeln (Grana)<br />
aufgeschichteten Thylakoide liegen.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 7 / 70
4 Membranen: Struktur und Funktion<br />
(Kapitel 8)<br />
Struktur biologischer Membranen<br />
Membranmodelle entwickeln sich aufgrund neuer Befunde weiter. An die Stelle des Davson-<br />
Danielli-Modells, in dem die Proteine auf beiden Seiten der Lipiddoppelschicht lagen, trat<br />
das Flüssig-Mosaik-Modell:<br />
Membranen sind dynamisch. Sie können wandern. Modell einer Biomembran:<br />
Biomembranen sind ein strukturelles und funktionelles Mosaik. Die integralen Membranproteine<br />
sind in die Lipiddoppelschicht eingelagert, periphere Membranproteine stehen in<br />
Kontakt mit ihrer Oberfläche. Innen- und Aussenseite der Membran sind unterschiedlich<br />
zusammengesetzt. Zu den Funktionen der Membranproteine gehören Transport, Enzymaktivität,<br />
Signalübertragung, Verbindungen zu anderen Zellen, Zell-Zell-Erkennung sowie die<br />
Verknüpfung mit dem Cytoskelett und der extrazellulären Matrix.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 8 / 70
Membrangebundene Kohlenhydrate sind wichtig für die Zell-Zell-Erkennung. Mit den Proteinen<br />
und Lipiden auf der Aussenseite der Membran sind kurze Zuckerketten verknüpft, die<br />
dort mit den Oberflächenmolekülen anderer Zellen in Wechselwirkung treten können.<br />
Stofftransport durch biologische Membranen<br />
Der molekulare Aufbau einer Biomembran führt zu selektiver Permeabilität. Jede Zelle muss<br />
kleine Moleküle und Ionen mit ihrer Umgebung austauschen. Dieser Vorgang wird von der<br />
Plasmamembran gesteuert. Hydrophobe Substanzen sind fettlöslich und passieren die<br />
Membran sehr schnell. Polare Moleküle und Ionen können sie in der Regel nur mithilfe besonderer<br />
Transportproteine durchqueren.<br />
Wassermolekül, Polare<br />
Moleküle, Ionen<br />
Transportprotein<br />
Passiver Transport ist Diffusion von Teilchen durch eine Membran. Diffusion ist die spontane<br />
Wanderung einer Substanz entlang ihres Konzentrationsgefälles.<br />
Diffusion einer gelösten Substanz:<br />
Die Poren der Membran sind so gross, dass Farbstoffmoleküle sie passieren können. Der<br />
Farbstoff diffundiert von dem Bereich mit höherer zu dem mit niedrigerer Konzentration. Am<br />
Ende steht ein Fliessgleichgewicht: Die gelösten Moleküle durchqueren weiterhin die Membran,<br />
aber mit gleicher Häufigkeit in beide Richtungen.<br />
Rot = Farbstoff<br />
Blau = Wasser<br />
Hier entsteht eine Diffusion. =<br />
homogene Verteilung auf beiden<br />
Seiten.<br />
Brown’sche Molekularbewegung ist eine Funktion der Temperatur und Bewegung. (Bei<br />
absolutem 0-Punkt bewegt sich gar nichts mehr).<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 9 / 70
Osmose ist der passive Transport von Wassermolekülen. Zwei unterschiedliche konzentrierte<br />
Zuckerlösungen sind durch eine poröse Membran getrennt, die für das Lösungsmittel<br />
(Wasser) durchlässig, für die gelöste Substanz (Zucker) aber undurchlässig ist. Das Wasser<br />
diffundiert von der hypotonischen zur hypertonischen Lösung in dem Bestreben, diese zu<br />
verdünnen. Durch diesen passiven Transport des Wassers, auch Osmose genannt, vermindert<br />
sich der Unterschied der Zuckerkonzentration. Das aufgrund des „osmotischen<br />
Drucks“ in den rechten Schenkel des Gefässes eindringende Wasser lässt dort den Flüssigkeitsspiegel<br />
gegen den „hypostatischen Druck“ steigen, bis es zu einem Gleichgewicht<br />
kommt.<br />
Das Überleben der Zellen hängt von einem ausgeglichenen Wasserhaushalt ab. Zellen ohne<br />
Zellwände (zum Beispiel Tierzellen und manche Protisten) sind gegenüber ihrer Umgebung<br />
isotonisch oder besitzen Anpassungen zur Osmoseregulation. Bei den Zellen der Pflanzen,<br />
Pilze und mancher Protisten verhindert die elastische Zellwand, dass sie in einem hypotonischen<br />
Milieu platzen.<br />
Tierzelle:<br />
Einer Tierzelle geht es im isotonischen Milieu am besten, es sei denn, sie kann durch<br />
besondere Anpassungen der osmotischen Aufnahme von Wasser entgegenwirken.<br />
Pflanzenzelle:<br />
Pflanzenzellen sind in der Regel prall geschwollen in hypotonischem Milieu am gesündesten;<br />
einer übermässigen Wasseraufnahme wirkt der Druck der elastischen Zellwand<br />
entgegen.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 10 / 70
Spezifische Proteine erleichtern den passiven Transport des Wassers und ausgewählter<br />
gelöster Substanzen. (erleichterte Diffusion)<br />
Bei der erleichterten Diffusion beschleunigt ein Transportprotein die Wanderung des<br />
Wassers oder einer gelösten Substanz durch die Membran entlang ihres<br />
Konzentrationsgefälles.<br />
Aktiver Transport ist das Pumpen eines gelösten Stoffes entgegen seinem<br />
Konzentrationsgefälle. Diese Tätigkeit verrichten spezielle Membranproteine unter Aufwand<br />
von Energie, die sie in der Regel aus ATP beziehen.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 11 / 70
Manche Ionenpumpen erzeugen an der Membran ein elektrisches Potenzial. Ionen können<br />
sowohl einen chemischen Gradienten haben (das heisst ein Konzentrationsgefälle), als auch<br />
einen elektrischen Gradienten (ein Spannungsgefälle). Gemeinsam bilden diese Kräfte den<br />
elektrochemischen Gradienten, der über die Diffusionsrichtung von Ionen bestimmt.<br />
Elektrogene Pumpen wie die Natrium-Kalium-Pumpe oder die Protonenpumpe sind Transportproteine,<br />
die elektrochemische Gradienten aufbauen.<br />
Elektrogene Pumpen<br />
Die wichtigsten elektrogenen Pumpen der Pflanzen, Pilze und Bakterien, sind Membranproteine,<br />
die an der Membran durch Ladungstrennung eine elektrische Spannung aufbauen<br />
und so Energie speichern. Mit ATP als Energiequelle verschiebt die Potonenpumpe positive<br />
Ladungen in Form von Protonen. Elektrisches Membranpotenzial und Protonenkonzentrationsgradient<br />
sind eine doppelte Energiequelle, die sich die Zelle als elektrochemischer Gradient<br />
zum Antrieb anderer Vorgänge zunutze machen kann.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 12 / 70
5 Zellatmung: Gewinnung chemischer Energie<br />
(Kapitel 9)<br />
Prinzipien der Energiegewinnung<br />
Chemische Elemente, die für das Leben wichtig sind, werden durch Zellatmung und Photosynthese<br />
wieder verwertet. Für die Energie gilt das aber nicht.<br />
Zellatmung und Gärung sind katabole (Energie liefernde) Reaktionswege. Der Abbau der<br />
Glucose sowie anderer organischer Betriebsstoffe ist exergonisch und liefert Energie für die<br />
ATP-Synthese. (ATP = Adenosintriphosphat)<br />
C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O<br />
Pflanzen geben O2 und Zucker an<br />
Menschen und Tiere.<br />
Menschen und Tiere geben CO2 und<br />
H2O an Pflanzen.<br />
Die Zellatmung ist räumlich und zeitlich von der Photoynthese getrennt.<br />
Zusammenhang der Reaktionen in Chloroplasten und Mitochondrien:<br />
Organische Moleküle wie Zucker<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 13 / 70
Die Zellen müssen das ATP regenerieren, das sie bei ihren Aktivitäten verbrauchen.<br />
Das ATP überträgt Phosphatgruppen auf verschiedene Substrate und regt sie so dazu an,<br />
Arbeit zu leisten. Damit eine Zelle dauerhaft funktionieren kann, muss sie das ATP wieder<br />
herstellen. Die Zellatmung, die von Glucose oder anderen organischen Betriebsstoffen<br />
ausgeht und O2 verbraucht, liefert H2O, CO2 sowie Energie in Form von ATP und Wärme.<br />
Ablauf der Zellatmung<br />
Zellatmung ist der Funktionskomplex aus Glykolyse, Citratzyklus und Atmungskette.<br />
Glykolyse und Citratzyklus schleusen Elektronen über das NADH in die Atmungskette (eine<br />
Elektronentransportkette) ein, und diese treibt die oxidative Phosphorylierung an. Die Glykolyse<br />
findet im Cytosol statt, der Citratzyklus in der Mitochondrienmatrix. Die Atmungskette<br />
ist in die innere Mitochondrienmembran eingelagert.<br />
Das NADH trägt die energiereichen Elektronen, die den Substratmolekülen in Glykolyse und<br />
Citratzyklus entzogen wurden, zur Atmungskette, die in die innere Mitochondrienmembran<br />
eingebettet ist. Der gelbe Pfeil zeigt in diesem Schema den Weg der Elektronen bis zum<br />
„unteren“ Ende der Kette, wo sie auf Sauerstoff übertragen werden und dadurch Wasser<br />
entsteht. Während ein Komplex die Elektronen aufnimmt und dann wieder abgibt, pumpt er<br />
Protonen aus der Mitochondrienmatrix in den Intermembranraum (rote Pfeile). Die aus den<br />
Nährstoffen gewonnene Energie wird also hier in eine protonenmotorische Kraft umgesetzt,<br />
die sich aus dem aufgebauten H + -Gradienten und dem Membranpotenzial zusammensetzt.<br />
Die Protonen vollenden ihren Kreislauf, indem sie ihrem Konzentrationsgradienten folgend<br />
durch einen H + -Kanal in der ATP-Synthase fliessen, die als weiterer Proteinkomplex in der<br />
Membran liegt. Die ATP-Synthase nutzt die protonenmotorische Kraft, um ADP zu ATP zu<br />
phosphorylieren. Den Mechanismus dieser Energiekopplung bezeichnet man als Chemiosmose:<br />
Chemische Energie wird zum Aufbau eines osmotischen Gradienten verwendet, mit<br />
dem dann Arbeit geleistet wird.<br />
Wichtig:<br />
Photophosylierung, Atmungskettenphosphorylierung und Substratkettenphosphorylierung<br />
führen alle zu ATP. Diese finden nur in lebenden Systemen statt.<br />
Chemiosmotische Theorie<br />
Die chemiosmotische Theorie ist ein Prozess in einer Membran bei der ein Elektronentransport<br />
erfolgt und Protonen durch die Membrantransportiert (innen -> aussen). Zusätzlich transportiert ein<br />
Enzym die Protonen zurück und bildet aus der gewonnenen Energie ATP. (Siehe Bild oben)<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 14 / 70
6 Photosynthese<br />
(Kapitel 10)<br />
Energie:<br />
autotroph<br />
Die Photosynthese im Gesamtbild der Natur<br />
Pflanzen und andere autotrophe Organismen sind die Primärproduzenten der Biosphäre.<br />
Autotrophe Lebewesen ernähren sich ohne organische Moleküle aufzunehmen. Photoautotrophe<br />
Organismen nutzen die Energie aus dem Sonnenlicht, um aus CO2 und H2O<br />
organische Moleküle zu synthetisieren (z.B. Pflanzen). Heterotrophe Lebewesen beziehen<br />
Energie und Kohlenstoff aus den organischen Molekülen anderer Organismen. (z.B. der<br />
Mensch)<br />
Chloroplasten sind bei Pflanzen die Orte der Photosynthese. Bei autotrophen Eukaryoten<br />
läuft die Photosynthese in den Chlorplasten ab, Organellen mit Thylakoidmembranen, die<br />
den Thylakoidinnenraum vom Stroma des Chloroplasten trennen. Die Thylakoide sind zu<br />
Grana gestapelt.<br />
Elektronentransport<br />
(führt später zum<br />
Calvin Zyklus)<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 15 / 70<br />
+ P<br />
Thylakoid<br />
Grana
Die Zelle verwendet die Protonen, um einen Protonengradienten aufzubauen. Der Aufbau<br />
eines Gradienten kostet Energie, es handelt sich um einen endothermen Vorgang. Aber die<br />
Elektronentransportkette liefert ja genug Energie. Wenn die Elektronen bergab fliessen (Elektronentransport),<br />
reicht die dabei frei werdende Energie aus, um Protonen bergauf zu transportieren.<br />
Es bildet sich so ein Protonengradient.<br />
Und ein Protonengradient ist nichts anderes als gespeicherte Energie: wenn die Protonen<br />
nun durch ein spezielles Enzym in Richtung des Protonengefälles fliessen, kann nebenbei<br />
ATP hergestellt werden.<br />
Ziel ist es einen Protonengradienten aufzubauen.<br />
Ablauf (chemiosmotische Theorie)<br />
1. Licht<br />
2. Elektronentransport<br />
3. Protonentransport und Aufbau eines Protonengradienten<br />
4. ADP + Phosphat -> ATP<br />
Die Reaktionswege der Photosynthese<br />
Nachdem man wusste, dass Chloroplasten Wassermoleküle spalten, konnte man Atome<br />
durch die Photosynthese verfolgen.<br />
Die Summengleichung der Photosynthese lautet:<br />
6 CO2 + 6 H2O -> C6H12O6 + 6 O2<br />
Wie man aus Experimenten weiss, wird das Wasser im Chloroplasten zu Wasserstoff und<br />
Sauerstoff gespalten, und die Elektronen des Wasserstoffs gehen in die Bindungen der<br />
Zuckermoleküle ein. Die Photosynthese ist ein Redoxvorgang: H2O wird oxidiert, CO2 wird<br />
reduziert.<br />
Die Lichtreaktionen und der Calvin-Zyklus wirken zusammen und setzen Lichtenergie in die<br />
chemische Energie der Nährstoffe um. Durch die Lichtreaktionen in den Grana entsteht ATP,<br />
und Wasser wird gespalten; dabei wird O2 frei, und durch Übertragung der Elektronen vom<br />
Wasser auf NAD + bildet sich NADPH. Der Calvin-Zyklus im Stroma bildet Zucker aus CO2,<br />
wobei ATP die Energie liefert und NADPH das Reduktionsmittel darstellt.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 16 / 70
Die Lichtreaktionen verwandeln Sonnenenergie in die chemische Energie von ATP und<br />
NADPH. Bei den Lichtreaktionen wird Sonnenenergie in chemische Energie umgewandelt.<br />
Das vom Chlorophyll absorbierte Licht treibt die Übertragung von Protonen und Elektronen<br />
vom Wasser auf den Akzeptor NADP + an, bei diesem Vorgang wird Wasser gespalten.<br />
Zusätzlich erzeugen die Lichtreaktionen ATP.<br />
Warum Blätter grün sind: Die Wechselwirkung von Licht und Chloroplasten. Die Pigmente<br />
der Chloroplasten schlucken (absorbieren) blaues und rotes Licht; diese Farben sind in der<br />
Photosynthese am wirksamste. Grünes Licht wird von den Pigmenten zurückgeworfen<br />
(reflektiert) oder durchgelassen (transmittiert); deshalb sehen Blätter grün aus.<br />
Chlorophyll Moleküle in den Thylakoid<br />
absorbieren Licht einer ganz bestimmten<br />
Wellenlänge, aber nicht das Grüne, das lassen<br />
sie durch.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 17 / 70
Im Calvin-Zyklus dienen ATP und NADPH dazu, Zucker aus CO2 herzustellen<br />
Ebenfalls wird der Calvin-Zyklus auch Dunkelreaktion genannt.<br />
Zusammenwirken von Lichtreaktionen und Calvin-Zyklus<br />
Grundlage der Photosynthese ist das Wechselspiel von zwei Reaktionsfolgen:<br />
Lichtreaktionen und Calvin-Zyklus. Das Chlorophyll und die anderen Moleküle, die für die<br />
Lichtreaktionen sorgen, sind in die Thylakoidmembran eingelagert. Die Enzyme, die den<br />
Calvin-Zyklus katalysieren, liegen dagegen im Stroma. Nachdem das Chlorophyll zunächst<br />
Licht aufgenommen hat, wandeln die Lichtreaktionen die Lichtenergie in chemische Energie<br />
in Form von ATP und NADPH um. Das ATP liefert die Energie für den Calvin-Zyklus, in dem<br />
Kohlendioxid zu Zucker umgesetzt wird, und das NADPH steuert dazu die notwendigen.<br />
Elektronen bei. Das ADP und das NADP + , die den Calvin-Zyklus verlassen, werden wieder<br />
in die Lichtreaktionen eingeschleust und dort zu ATP und NADPH regeneriert.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 18 / 70
7 Reproduktionsbiologie, Der Zellzyklus<br />
(Kapitel 12)<br />
Die Schlüsselfunktionen der Zellteilung<br />
Die Zellteilung dient zu Vermehrung, Wachstum und Regeneration. Einzellige Lebewesen<br />
vermehren sich durch Zellteilung. Vielzeller sind auf sie angewiesen, um sich aus der<br />
befruchteten Eizelle zu entwickeln, zu wachsen und sich bei Schäden zu regenerieren.<br />
Durch die Zellteilung werden gleichartige Chromosomensätze auf die<br />
Tochterzellen verteilt. Bei Eukaryoten gliedert sich die Zellteilung in die<br />
Mitose (Kernteilung) und die Cytokinese (Teilung des Cytoplasmas).<br />
Die DNA ist auf Chromosomen verteilt, sodass die Eukaryoten-zelle<br />
ihre riesige DNA-Menge leichter verdoppeln und aufteilen kann. Die<br />
Chromosomen bestehen aus Chromatin, einem Komplex aus DNA und<br />
Protein, der in der Mitose konden-siert. Bei der Verdoppelung<br />
entstehen aus jedem Chromosom zwei identische Schwesterchromatiden.<br />
Diese trennen sich in der Mitose und werden zu den<br />
Chromosomen der neuen Tochterzellen.<br />
Biogenese: Leben entsteht aus Leben<br />
Information für den Bau eines Lebewesens (= Erbinformation) ist im<br />
Zellkern lokalisiert. Grundlage für Fortpflanzung, Wachstum und<br />
Vermehrung ist die Weitergabe der ganzen Erbinformation. Die<br />
Weitergabe der Erbinformation erfolgt auf der Ebene der Zelle (Bild).<br />
Teilung<br />
Wachstum<br />
Teilung<br />
Klon<br />
Bei der Teilung der Zelle entstehen zwei identische Nachkommen. Diesen Vorgang der<br />
unveränderten und ganzheitlichen Weitergabe der Erbinformation nennen wir:<br />
vegetative, asexuelle, ungeschlechtliche Fortpflanzung.<br />
Ein Lebewesen, dass sich vegetativ fortpflanzt erzeugt einen Klon (Gruppe, identischer<br />
Lebewesen. Kann zu Mutationen führen).<br />
Es gibt auch etliche vielzählige Lebewesen, die sich vegetativ fortpflanzen:<br />
- Knospung (Hydra)<br />
- Ausläufer (Himbeere mit neuer Knospe)<br />
- Knollen (von Kartoffeln)<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 19 / 70
Zelle<br />
In allen eukaryotischen Zellen wird die DNS in Stücke geschnitten / unterteilt.<br />
Jede Art (Spezies) hat eine spezifische Anzahl Chromosomen.<br />
Beispiel:<br />
Art Anz. Chromosomen DNS-Länge<br />
Mensch 46 102 cm<br />
Hausmaus 40 102 cm<br />
Taufliege 8 6 cm<br />
Lilie 24 10200 cm<br />
Die Weitergabe des Genoms nennt man Replikation (Verdoppelung, kopieren).<br />
Der Vorgang im Zellkern, der zur Verdoppelung (Replikation) der Erbinformation führt nennt<br />
man Mitose.<br />
Zellzyklus und Mitose<br />
Im Zellzyklus wechseln Mitosephase und Interphase ab. Mitose und Cytokinese bilden die<br />
M-(Mitose-)Phase des Zellzyklus. Zwischen den Teilungen befindet sich die Zelle in der<br />
Interphase, die sich in G1-, S- und G2-Phase gliedert. Die Zelle wächst während der gesamten<br />
Interphase, die DNA wird aber nur in der S-(Synthese-)Phase verdoppelt. Die Mitose<br />
läuft ohne Unterbrechungen ab.<br />
Phasen der Mitose:<br />
- Prophase<br />
- Prometaphase<br />
- Metaphase<br />
- Anaphase<br />
- Telophase<br />
Erbinformation = Genom<br />
Zellkern<br />
Zellplasma<br />
Zellmembran<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 20 / 70
Prophase<br />
In der Prophase spielen sich in Zellkern und Cytoplasma Veränderungen ab. Im Zellkern<br />
winden sich die Chromatinfasern dichter zusammen und kondensieren zu einzelnen, lichtmikroskopisch<br />
erkennbaren Chromosomen. Jedes verdoppelte Chromosom ist als Paar<br />
verbundener Schwesterchromatiden zu erkennen. Im Cytoplasma bildet sich die Mitosespindel.<br />
Sie besteht aus Mikrotubuli, die von den beiden Centrosomen ausgehen. Die<br />
Centrosomen rücken auseinander, angetrieben offenbar von den länger werdenden Pol-<br />
Mikrotubuli zwischen ihnen, die sie auf der Oberfläche des Zellkerns entlang schieben.<br />
Chromosom<br />
Chromosomen bestehen aus zwei Schwesterchromatiden.<br />
Mitosespindel: Fäden bestehen aus Mikrotubuli<br />
Prometaphase<br />
Während der Prometaphase zerfällt die Kernhülle. Nun können die Mikrotubuli der Spindel in<br />
den Kernbereich hineinwachsen und mit den Chromosomen, die mittlerweile noch stärker<br />
kondensiert sind, in Wechselwirkung treten. Von beiden Polen erstrecken sich Mikrotubulibündel<br />
bis zur Mitte der Zelle. Die Chromatiden der einzelnen Chromosomen besitzen<br />
jeweils ein Kinetochor, eine spezialisierte Struktur im Centromerbereich. Manche Mikrotubuli<br />
heften sich an die Kinetochore und veranlassen die Chromosomen zu ruckartigen Bewegungen.<br />
Diejenigen Mikrotubuli, die nicht an den Kinetochoren verkehrt sind (Pol-Mikrotubuli),<br />
treten mit solchen vom gegenüberliegenden Zellpol in Wechselwirkung.<br />
Centrosomen bewegen sich zu den<br />
Polen. Mikrotubuli haben an Centromere<br />
(Kinetochor) angedockt und schieben<br />
nun die Chromosomen weg.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 21 / 70
Metaphase<br />
Die Centrosomen befinden sich jetzt an den beiden Zellpolen. Die Chromosomen finden sich<br />
zur Metaphaseplatte zusammen, einer Ebene, die von beiden Zellpolen gleich weit entfernt<br />
ist. Alle Centromere der Chromosomen liegen in der Metaphaseplatte. In jedem Chromosom<br />
sind die Kinetochore der beiden Schwesterchromatiden über Mikrotubuli mit den beiden<br />
Zellpolen verbunden. Den gesamten Mikrotubuliapparat bezeichnet man wegen seiner Form<br />
als Mitosespindel.<br />
Anaphase<br />
Die Anaphase beginnt sehr plötzlich: Die Centromere der einzelnen Chromosomen trennen<br />
sich, so dass die Schwesterchromatiden schliesslich freikommen. Die ehemaligen Chromosomenhälften,<br />
die jetzt eigenständige Chromosomen sind, wandern in Richtung der beiden<br />
Zellpole, wobei sich ihre Kinetochor-Mikrotubuli verkürzen. Da diese Mikrotubuli am Centromer<br />
angeheftet sind, wandern die Chromosomen mit dem Centromer voran mit etwa 1<br />
µm/min. Gleichzeitig werden die Pol-Mikrotubuli länger, und die Zellpole rücken auseinander.<br />
Am Ende der Anaphase befindet sich an jedem Zellpol der gleiche, vollständige<br />
Chromosomensatz.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 22 / 70
Telophase und Cytokinese<br />
In der Telophase verlängern sich die Pol-Mikrotubuli noch weiter, und an den Zellpolen<br />
bilden sich die Tochterzellkerne. Aus den Fragmenten der ursprünglichen Kernhülle und<br />
anderen Teilen des inneren Membransystems entstehen zwei neue Kernhüllen, und die<br />
Chromatinfasern der Chromosomen lockern ihre Spiralisierung, auch dies eine Umkehr der<br />
Vorgänge in der Prophase und Prometaphase. Die Mitose, das heisst die Teilung des<br />
Zellkerns in zwei gleichartige Tochterzellen, ist damit abgeschlossen. In der Regel hat<br />
mittlerweile auch die Cytokinese - die Teilung des Cytoplasmas - bereits begonnen, so dass<br />
kurz nach dem Ende der Mitose auch die beiden Tochterzellen fertig sind. Bei Tierzellen<br />
bildet sich während der Cytokinese eine Teilungsfurche, die durch Abschnüren für die<br />
Teilung sorgt.<br />
Die Mitosespindel verteilt die Chromosomen auf die Tochterzellen<br />
Die Mitosespindel, ein Apparat aus Mikrotubuli, lenkt in der Mitose die Bewegung der<br />
Chromosomen. Die Spindel geht von den Centrosomen aus, Organellen in der Nähe des<br />
Zellkerns, die bei Tierzellen die Centriolen enthalten. Mikrotubuli der Spindel heften sich an<br />
die Kinetochore der Chromatiden und dirigieren die Chromosomen in die Metaphaseplatte.<br />
In der Anaphase trennen sich die Schwesterchromatiden und wandern zu den Zellpolen.<br />
Mithilfe von Motorproteinen bewegen sich die Kinetochore an den kürzer werdenden Mikrotubuli<br />
entlang. Gleichzeitig gleiten Mikrotubuli, die von den Zellpolen ausgehen und nicht mit<br />
Kinetochoren verbunden sind (so genannte Pol-Mikrotubuli), aneinander vorbei und verleihen<br />
der Zelle eine längliche Form. In der Telophase bilden sich an den Zellpolen die Kerne<br />
der Tochterzellen.<br />
In der Cytokinese teilt sich das Cytoplasma<br />
Auf die Mitose folgt in der Regel die Cytokinese, die bei Tieren mithilfe einer Teilungsfurche<br />
und bei Pflanzen durch Ausbildung der Zellplatte erfolgt.<br />
Tierzelle<br />
Cytoplasma wird aufgeschnürt.<br />
In animals cells, cytokinesis<br />
begins with the formation of a<br />
cleavage furrow. At the site of<br />
the furrow, a ring of microfilaments<br />
contracts, much like<br />
the pulling of drawstrings. The<br />
cell is pinched in two, creating<br />
two identical daughter cells.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 23 / 70
Pflanzenzelle<br />
Mauer wird in der Mitte gemacht.<br />
Nach der Cytokinese beginnen die Zellen zu wachsen. (Aufnahme von Nährstoffen,<br />
Stoffwechsel, etc.)<br />
Falls sich die Zelle erneut teilt (in eine nächste Phase eintritt) wird die Wachstumsphase<br />
unterbrochen von einer Phase der DNS-Synthese (Replikation). Nach Ende der<br />
Teilungsphase beginnt die Zelle erneut zu wachsen. Siehe Zellzyklus!<br />
Die Mitose der Eukaryoten hat sich vermutlich aus der Zweiteilung der Bakterien entwickelt.<br />
Bei der Zweiteilung der Bakterien werden die Tochterchromosomen durch einen nicht genau<br />
geklärten Mechanismus auseinander gezogen.<br />
Die Kontrolle des Zellzyklus<br />
Ein molekulares Kontrollsystem treibt den Zellzyklus an. Als Uhrwerk für die Mitose dienen<br />
zyklische Veränderungen regulatorischer Proteine. Die entscheidenden Moleküle sind<br />
Cyclin-abhängige Kinasen (Cdks), Komplexe aus Cyclinen (deren Konzentration im Laufe<br />
des Zellzyklus zunimmt) und spezifischen Proteinkinasen, die nur dann aktiv sind, wenn sie<br />
sich mit einem Cyclin verbunden haben.<br />
Zur Regulation des Zellzyklus tragen innere und äussere Signale bei. An Zellkulturen konnte<br />
man die molekularen Einzelheiten der Zellteilung untersuchen. Sowohl innere Signale, die<br />
beispielsweise von den noch nicht mit der Spindel verbundenen Kinetochoren ausgehen, als<br />
auch äussere − beispielsweise Wachstumsfaktoren − greifen über Signalübertragungswege<br />
an den Kontrollpunkten in den Zellzyklus ein. Die dichteabhängige Hemmung ist unter<br />
anderem mit einem Mangel an Wachstumsfaktoren zu erklären.<br />
G0-Phase<br />
(Ruhephase)<br />
Zellen, die<br />
sich nicht<br />
mehr teilen,<br />
werden hier<br />
festgehalten<br />
In plant cells, cytokinesis begins<br />
when membrane-enclosed vesicles<br />
collect in the middle of the cell. The<br />
vesicles fuse, forming a large sac<br />
called the cell plate. The cell plate<br />
grows outward until its membrane<br />
fuses with the plasma membrane,<br />
separating the two daughter cells.<br />
The cell plate's contents join the<br />
parental cell wall. The result is two<br />
daughter cells, each bounded by<br />
its own continuous plasma<br />
membrane and cell wall.<br />
Regulation<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 24 / 70
Beispiele von Zellzyklus-Regulation:<br />
Zellkultur:<br />
Tierische Zellen teilen sich nur, wenn sie einen Untergrund haben. (= Haftungsabhängigkeit).<br />
Wenn eine Zellschicht ausgebildet ist hören die Teilungen auf. (= Dichteabhängigkeit).<br />
-> Nachbarzelle sendet „Stoppsignal“.<br />
Weitere Ursachen bzw. Regulationssignale für Teilungsstopp könnten sein:<br />
- Ungenügende Nährstoffkonzentration oder -zusammensetzung<br />
- Giftstoffe etc. (innere Gründe, Genom)<br />
- Chemikalien, Strahlen<br />
Die Zellzyklusregulation kann auch genetisch bedingt sein. Beispiele:<br />
- Nervenzellen: stoppen Teilung ganz und irreversibel<br />
- Leberzellen: können nach langer Ruhephase sich wieder teilen.<br />
- Hautzellen: Teilen sich lebenslang.<br />
Defekte in der Zellzyklus-Regulation führen zu Krebszellen!<br />
Krebszellen haben sich von der Kontrolle des Zellzyklus befreit. Krebszellen entziehen sich<br />
der normalen Steuerung und teilen sich unkontrolliert, sodass ein Tumor entsteht. Bösartige<br />
Tumore wandern in umgebendes Gewebe ein und können metastasieren, das heisst, sie<br />
entlassen Krebszellen in andere Körperteile.<br />
Benigner Tumor (gutartig):<br />
Bleibt an einem Ort und kann man wegschneiden.<br />
Maligner Tumor (bösartig):<br />
Bilden Ableger (= Metastase), kann man nichts machen, führt zum Tode.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 25 / 70
8 Reproduktionsbiologie, sexuelle Entwicklungszyklen<br />
(Kapitel 13)<br />
Bei der Fortpflanzung erhalten die Nachkommen die Erbinformation der Eltern.<br />
Die Erbinformation ist in Stücke aufgeteilt und kondensiert (verdichtet) in den Chromosomen.<br />
Bei der Fortpflanzung werden also Chromosomen auf die Nachkommen übertragen.<br />
Bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung werden die Chromosomen kopiert und alle<br />
Nachkommen erhalten einen identischen und vollständigen Satz Chromosomen.<br />
Die Nachkommen einer ungeschlechtlichen Fortpflanzung sind identische Kopien der Eltern.<br />
Bei der geschlechtlichen (sexuellen) Fortpflanzung werden die Erbinformationen (Genome)<br />
zweier Eltern zusammengeführt und anschliessend kopiert und aufgeteilt.<br />
Eine Einführung in die Vererbungslehre<br />
Die Nachkommen erhalten ihre Gene von den Eltern, indem sie deren Chromosomen erben.<br />
Genetik ist die Wissenschaft von der Vererbung. Sie untersucht Konstanz und Variabilität<br />
von Merkmalen in der Generationenfolge. Das genetische Material besteht aus DNA,<br />
angeordnet in Genen. Jedes Gen liegt an einem definierten Ort (Locus) auf einem<br />
bestimmten Chromosom.<br />
Ganz die Mutter? Der Unterschied zwischen asexueller und sexueller Fortpflanzung.<br />
Bei der asexuellen (ungeschlechtlichen, vegetativen) Fortpflanzung erzeugt ein Elternteil<br />
ausschliesslich durch Mitosen eine genetisch identische Nachkommenschaft. Bei der<br />
sexuellen (geschlechtlichen, generativen) Fortpflanzung werden Gene von zwei<br />
verschiedengeschlechtlichen Eltern rekombiniert, wodurch eine genetisch abweichende<br />
Nachkommenschaft entsteht.<br />
Die Rolle der Meiose in sexuellen Entwicklungszyklen<br />
Befruchtung und Meiose alternieren bei sexuellen Entwicklungszyklen. Die normalen<br />
Somazellen des Menschen enthalten 46 Chromosomen, die Hälfte stammt vom Vater, die<br />
andere Hälfte von der Mutter. Jedes der 22 Autosomen des mütterlichen Satzes hat sein<br />
entsprechendes homologes Chromosom im väterlichen Satz. Das 23. Chromosomenpaar,<br />
die Geschlechtschromosomen, bestimmen das Geschlecht als weiblich (XX) oder männlich<br />
(XY). Die einfachen, haploiden (n) Chromosomensätze des Eies und des Spermiums<br />
vereinigen sich bei der Befruchtung, und es entsteht eine diploide (2n) Zelle, die Zygote.<br />
Diese entwickelt sich durch Mitosen zu einem vielzelligen Organismus. Bei geschlechtsreifen<br />
Individuen produzieren die Gonaden, also Ovarien und Hoden, durch den Vorgang der<br />
Meiose haploide (n) Gameten. Die verschiedenen sexuellen Entwicklungszyklen sind durch<br />
Unterschiede im Zeitpunkt der Meiose und Befruchtung charakterisiert. Vielzellige<br />
Organismen können diploid (wie die meisten Tiere) oder haploid sein (wie die meisten<br />
Pilze), oder es kommt zum Generationswechsel von haploiden und diploiden Stadien (wie<br />
bei vielen Pflanzen).<br />
Jede Körperzelle (somatische Zelle) des Menschen hat 46 Chromosomen. Die Hälfte der<br />
Chromosomen (= 23) stammen vom Vater, die andere Hälfte von der Mutter.<br />
Homologe Chromosomen sehen gleich aus, haben gleiche Länge, gleiches Bändermuster,<br />
gleiche Zentromerposition, etc.<br />
Wenn man die homologen Chromosomen paarweise und der Grösse nach anordnet erhält<br />
man das „Chromosomenbild“, den Karyotyp.<br />
Homologe Chromosomen tragen dieselben Gene an derselben Stelle im Bändermuster. Das<br />
heisst, Gene für dieselben Erbmerkmale (Augenfarbe, etc.)<br />
Alles sind homologe Chromosomen (nennt man Autosomen) ausser das Geschlechtschromosom<br />
(Y, X - Chromosomen).<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 26 / 70
Prozesse der Befruchtung und der Meiose<br />
Prozess der Meiose (Halbierung der Chromosomen):<br />
Vor jeder Befruchtung muss der Chromosomensatz halbiert werden. Der Prozess in dem der<br />
Chromosomensatz halbiert wird nennt man Meiose. Beim Menschen findet die Meiose im<br />
Eierstock respektive in den Hoden statt.<br />
Die Zellen in der Hode sind haploid.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 27 / 70
In der Meiose wird der diploide Chromosomensatz zum haploiden Status reduziert: Die<br />
Meiose setzt sich aus zwei Zellteilungen zusammen, Meiose I und Meiose II. Es entstehen<br />
vier Tochterzellen, von denen jede den halben Chromosomensatz der Ursprungszelle enthält.<br />
Die Meiose reduziert also den diploiden Chromosomensatz zum haploiden. Die Meiose<br />
unterscheidet sich von der Mitose durch eine Reihe typischer Ereignisse während der Meiose<br />
I.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 28 / 70
Interphase<br />
Chromosomen verdoppeln sich<br />
Der Meiose geht eine Interphase voraus, während der jedes Chromosom sein genetisches<br />
Material verdoppelt. Dieser Vorgang ist der Chromosomenreplikation vor der Mitose ähnlich.<br />
Aus jedem Chromosom gehen zwei genetisch identische Schwesterchromatiden hervor, die<br />
durch ihre Centromere miteinander verbunden sind. Die Centrosomen replizieren sich auch,<br />
wie in der Abbildung zu sehen ist.<br />
Ablauf der Meiose I<br />
Prophase I<br />
Homologe Chromosomen paaren und tauschen Stücke aus.<br />
Die meiotische Prophase I dauert länger und ist komplizierter als die Prophase der Mitose.<br />
Die Chromosomen beginnen sich zu verdichten, und die homologen Chromosomen - jede<br />
bestehend aus zwei Schwesterchromatiden - paaren sich. In diesem als Synapsis bezeichneten<br />
Vorgang verbindet eine Proteinstruktur - der Synaptonemal-Komplex - die homologen<br />
Chromosomen fest miteinander über die ganze Länge. Wenn der Synaptonemal-Komplex in<br />
der späteren Prophase verschwindet, wird jedes Chromosomenpaar im Mikroskop als Tetrade<br />
sichtbar, einem Komplex aus vier Chromatiden. Über das ganze Chromosom verteilt<br />
überkreuzen sich die Chromatiden homologer Chromosomen. Diese Überkreuzungen<br />
werden Chiasmata (Einzahl Chiasma) genannt. Die Chiasmata halten die homologen<br />
Chromosomenpaare bis zur Anaphase I zusammen. Einzelne Segmente werden an den<br />
Chiasmata ausgetauscht.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 29 / 70
Metaphase I<br />
Tetradenbildung<br />
Die Chromosomen sind nun auf der Metaphaseplatte angeordnet, und noch immer sind die<br />
Homologen gepaart. Die Kinetochor-Mikrotubuli des einen Zellpols sind mit je einem Chromosom<br />
jedes Paares verbunden, während Mikrotubuli des anderen Zellpols mit dem jeweils<br />
anderen Chromosom Kontakt aufnehmen.<br />
Je nach Anordnung der homologen Chromosomen entstehen unterschiedlich<br />
zusammengesetzte Gameten.<br />
homologe Paare Anz. Unterschiedlicher Gameten<br />
1 2^ 1 = 2<br />
2 2^ 2 = 4<br />
3 2^ 3 = 8<br />
23 2^ 23 = 8'388’608<br />
Anaphase I<br />
Homologe Chromosomen trennen sich<br />
Wie bei der Mitose transportiert der Spindelapparat die Chromosomen zu den Polen. Die<br />
Schwesterchromatiden bleiben jedoch über ihr Centromer miteinander verbunden und bewegen<br />
sich als eine Einheit zum selben Pol. Die homologen Chromosomen bewegen sich zum<br />
entgegengesetzten Pol. (Dies ist anders als während der Mitose. In der Mitose erscheinen<br />
die Chromosomen eher einzeln auf der Metaphaseplatte anstatt in Paaren, und es werden<br />
die Schwesterchromatiden jedes Chromosoms getrennt).<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 30 / 70
Telophase I und Cytokinese<br />
Zwei haploide Zellen bilden sich; die Chromosomen sind immer noch doppelt<br />
Der Spindelfaserapparat fährt fort, die homologen Paare zu<br />
trennen, bis die Chromosomen schliesslich die Zellpole<br />
erreichen. An jedem Pol sammelt sich nun ein haploider Satz,<br />
aber jedes Chromosom – die jetzt in Wirklichkeit nicht mehr<br />
einzeln zu erkennen sind – besteht immer noch aus zwei<br />
Chromatiden. Gewöhnlich ereignet sich die Cytokinese (die<br />
Teilung des Cytoplasmas) gleichzeitig mit der Telophase I,<br />
wobei zwei Tochterzellen gebildet werden. Bei Tierzellen<br />
entsteht durch Einschnüren der Plasmamembran eine<br />
Teilungsfurche, bei Pflanzenzellen erscheint eine Zellplatte.<br />
Bei einigen Arten dekondensieren die Chromosomen und<br />
sowohl Kernmembran als auch Nucleoli bilden sich wieder. In<br />
keinem Falle jedoch gibt es eine weitere Replikation<br />
genetischen Materials vor Abschluss der Meiose II.<br />
Meiose II<br />
Während einer weiteren Runde der Zellteilung trennen sich schliesslich die Schwesterchromatiden;<br />
es bilden sich vier haploide Tocherzellen, die jeweils ein Chromosom<br />
enthalten.<br />
Prophase II<br />
Es bildet sich ein neuer Spindelapparat, und die Chromosomen bewegen sich zur<br />
Metaphaseplatte.<br />
Metaphase II<br />
Die Chromosomen ordnen sich auf der Metaphaseplatte an wie bei der Mitose, wobei die<br />
Kinetochore der Schwesterchromatiden jedes Chromosoms zu entgegengesetzten Polen<br />
zeigen.<br />
Anaphase II<br />
Die Schwesterchromatiden trennen sich am Centromer und bewegen sich zu<br />
entgegengesetzten Zellpolen. Sie sind nun zu individuellen Chromosomen geworden.<br />
Telophase II und Cytokinese<br />
An den beiden Zellpolen beginnen sich die Kerne zu bilden, und es findet die Cytokinese<br />
statt. Es sind nun vier Tocherzellen vorhanden, wovon jede einen haploiden<br />
Chromosomensatz trägt.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 31 / 70
Unterschiede zwischen Mitose und Meiose<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 32 / 70
Ursprünge genetischer Variabilität<br />
Sexuelle Entwicklungszyklen bewirken eine genetische Variabilität der Nachkommen.<br />
Die sexuellen Prozesse, die zur genetischen Variabilität einer Population beitragen, sind die<br />
freie Kombination von Chromosomen bei der Meiose I, das Crossing-over zwischen homologen<br />
Chromosomen während der Meiose I und die Zufälligkeit der Befruchtung eines Eies<br />
durch ein Spermium.<br />
Durch die Trennung der Schwesterchromatiden können genetisch neu Gameten entstehen<br />
durch das crossing-over.<br />
Evolutionäre Anpassung beruht auf der genetischen Variabilität einer Population.<br />
Die genetische Variabilität unter den Mitgliedern einer Population ist das Rohmaterial für die<br />
Evolution durch natürliche Selektion. Sexuelle Rekombination und Mutation sind die beiden<br />
Prozesse, die genetische Variabilität erzeugen.<br />
Fazit<br />
Genetische Variabilität entsteht durch:<br />
Rekombination der Chromosomen bei der Anordnung der Homologenpaare.<br />
Rekombination von Chromosomenabschnitten durch crossing-over.<br />
Zufälliges Zusammenkommen der Gameten bei der Befruchtung.<br />
2 23 Varianten von Samenzellen<br />
2 23 Varianten von Eizellen<br />
=> 2 46 mögliche Kombinationen von Zygoten (ca. 70'000 Mia. Ohne crossing-over)<br />
Wenn wir das crossing-over noch hinzunehmen nimmt die genetische Variabilität noch mehr zu.<br />
Man darf sicher sagen, dass zwei Menschen theoretisch mehr als 100 Billionen Varianten zeugen<br />
könnten.<br />
Sinn der sexuellen Fortpflanzung ist die Erzeugung einer grossen genetischen Variabilität.<br />
Die genetische Variabilität ist die Grundlage der Evolution!!<br />
Bei der asexuellen Fortpflanzung können schnell alle sterben, da alle gleich sind. Bei der sexuellen<br />
Fortpflanzung wird bestimmt ein Teil überleben, da sie nicht gleich sind. (Umwelteinflüsse wirken<br />
auf sie ein, Selektion).<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 33 / 70
9 Mendel und der Genbegriff<br />
(Kapitel 14)<br />
Gregor Mendels Entdeckungen<br />
Mendel führte das Experiment und die quantitative Auswertung in die Genetik ein.<br />
Die Gesetze, die von Gregor Johann Mendel im Jahre 1865 aufgestellt wurden, gehören in<br />
den Bereich der Vererbungslehre oder auch Genetik. Mit ihnen konnte Mendel als einer der<br />
ersten erklären, nach welchem Muster Eigenschaften der Eltern an ihre Nachkommen<br />
weitergegeben werden – dies bezieht sich sowohl auf Pflanzen, als auch auf Tiere.<br />
Mendel forschte an Erbsenpflanzen, die er künstlich bestäubte, um die Eigenschaften der<br />
unter diesen kontrollierten Bedingungen gezeugten Nachkommen zu vergleichen. Hierbei<br />
bezog er sich auf die Merkmale Blütenfarbe, Struktur der Samenschale und Wuchsform. Die<br />
Ergebnisse wertete er statistisch aus und leitete von den gewonnenen Zahlenverhältnissen<br />
die drei nach ihm benannten Gesetze ab:<br />
1.) Das Uniformitätsgesetz<br />
2.) Das Spaltungsgesetz<br />
3.) Das Gesetz von der freien Kombinierbarkeit der Gene<br />
Aus dem Samen entwickelt sich unter günstigen Bedingungen wieder eine Pflanze.<br />
Erben = Zwitterblüte (Alles beisammen: Samenbeutel und Staubbeutel)<br />
Allele, dominante und rezessive Vererbung<br />
Mendel prägte die Begriffe dominant und rezessiv - diese Eigenschaften von Genen spielen<br />
bei der Vererbung von Merkmalen eine entscheidende Rolle. Gene kommen in Körperzellen<br />
in der Regel in Paaren vor. Die beiden Gene können jedoch unterschiedlich sein, man nennt<br />
sie dann Allele. Allele sind alternative Zustandsformen eines Gens und sie sind es die, die<br />
genetische Variabilität bei Erbmerkmalen bedingen. Für jedes Merkmal besitzt ein<br />
Organismus zwei Allele, je eines von jedem Elternteil. Ihre Kombination bestimmt die<br />
Ausprägung eines Merkmals.<br />
Dominant ist ein Gen, wenn seine<br />
Wirkung die eines rezessiven Gens<br />
überwiegt, das dominante Gen wird also<br />
exprimiert. Es wird in Schemata mit<br />
einem großen Buchstaben dargestellt.<br />
Rezessive Gene werden umgekehrt<br />
von dominanten unterdrückt - ihre<br />
Merkmale sind nur dann sichtbar, wenn<br />
zwei rezessive Gene alleine kombiniert<br />
werden. Sie werden in Schemata mit<br />
kleinen Buchstaben dargestellt.<br />
Neben der dominant-rezessiven Vererbung, bei der sich die Eigenschaften eines Elternteils<br />
durchsetzen, gibt es noch die intermediäre - hierbei nimmt der Nachkomme eine<br />
Mittelstellung ein. Im Laufe der Entwicklung kann die Dominanz wechseln, zudem ist sie vom<br />
Einfluss anderer Gene und von Umweltfaktoren abhängig. Darüber hinaus gibt es<br />
Übergangsfälle zwischen dominant-rezessiver und intermediärer Vererbung.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 34 / 70
Homozygote Individuen besitzen<br />
zwei identische Allele für ein<br />
Merkmal und sind daher reinerbig.<br />
Heterozygote Individuen haben<br />
verschiedene Allele für ein<br />
Merkmal.<br />
Merkmal = Phän<br />
Wenn die Allele für ein Merkmal unterschiedlich sind, dann wird ein Allel exprimiert und das<br />
andere unterdrückt. Das exprimierte Allel nennt man dominant und das andere rezessiv.<br />
Die Allele trennen sich bei der Gametenbildung voneinander, so dass eine Spermazelle<br />
beziehungsweise eine Eizelle nur je ein Allel trägt. Sind die beiden Allele eines Elternpaares<br />
untereinander verschieden, so wird nach der Befruchtung in der Nachkommenschaft ein Allel<br />
(das dominante) voll exprimiert, das andere (rezessive) jedoch vollständig maskiert<br />
(dominant-rezessiver Erbgang).<br />
Uniformitätsgesetz<br />
Die Nachkommen homozygoter (also gleicherbiger, reinrassiger) Individuen sind<br />
untereinander gleich. Bei dominant-rezessiver Vererbung gleichen die Nachkommen oft<br />
völlig einem Elternteil, da sich nur das dominante Gen durchsetzt - die Merkmale des<br />
rezessiven sind zwar im Erbgut vorhanden, kommen jedoch in dieser Generation nicht zur<br />
Ausprägung. Die direkten Nachkommen werden F1-Generation genannt, was für 1.<br />
Filialgeneration. Nachkommen von zwei homozygoten Partnern, die sich genetisch in<br />
mindestens einem Merkmal unterscheiden, werden heterozygot (verschiedenerbig) genannt.<br />
Sie werden auch als Bastarde oder Hybriden bezeichnet. Kreuzt man Individuen, die sich in<br />
nur einem Merkmal unterscheiden, spricht man von einem monohybriden Erbgang, bei zwei<br />
Merkmalen von einem dihybriden und so weiter.<br />
Ergebnis:<br />
Beim Bestäuben der violetten Blüten<br />
mit Pollen von weissen Blüten<br />
entstehen nur Pflanzen mit violetten<br />
Blüten.<br />
Schlussfolgerung:<br />
Die Erbmerkmale werden nicht<br />
vermischt.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 35 / 70
Nach der „Spaltungsregel“ gelangen die beiden Allele für ein bestimmtes Merkmal in<br />
getrennte Gameten. Die Selbstbestäubung der Hybriden der F1-Generation führte Mendel<br />
zur Aufstellung der Spaltungsregel (1. Mendelsches Gesetz). Die Hybriden (F1) zeigten alle<br />
das dominante Merkmal (Uniformitätsregel). In der nächsten Generation (F2) zeigten 75 %<br />
der Nachkommen das dominante, 25 % das rezessive Merkmal; die Phänotypen spalteten<br />
also 3:1 auf (Spaltungsregel). Wie Mendel aus dieser Beobachtung folgerte, haben die Gene<br />
alternative Zustandsformen (die wir heute als Allele bezeichnen), und jeder Organismus erbt<br />
ein Allel jedes Gens von den beiden Eltern.<br />
Spaltungsregel<br />
Die Nachkommen einer Kreuzung mischerbiger Individuen sind nicht mehr gleichförmig,<br />
sondern spalten ihr äusseres Erscheinungsbild in einem bestimmten Zahlenverhältnis auf.<br />
Mendel kreuzte die Pflanzen der F1-Generation untereinander. In der folgenden Generation<br />
(F2) traten neben den roten wieder weisse Blüten auf, und zwar im Verhältnis 3:1. Somit<br />
konnte Mendel beweisen, dass die Information für die weissen Blüten nicht verloren<br />
gegangen war, sondern nur von dem roten Merkmal überdeckt wurde. Hierbei kann man<br />
unterscheiden zwischen dem phänotypischen (also auf das Aussehen) bezogenen und dem<br />
genotypischen (auf die Gene bezogenen) Verhältnis. Phänotypisch beträgt es 3:1, da<br />
statistisch drei der vier Nachkommen rote Blüten haben. Genotypisch jedoch ist das<br />
Verhältnis 1:2:1, denn auf eine homozygot rote Pflanze kommen zwei heterozygote, bei<br />
denen sich nur das dominante Gen durchsetzt, und eine homozygot weisse. Kreuzte Mendel<br />
die weissen Nachkommen nur untereinander weiter, blieben die Blüten weiss. Erst wenn er<br />
eine rotblütige Pflanze dazu nahm, trugen die Nachkommen erneut auch rote Blüten. Das<br />
Spaltungsgesetz besagt demnach, dass die Nachkommen einer Kreuzung mischerbiger<br />
Individuen nicht mehr gleichförmig sind, sondern ihr äusseres Erscheinungsbild in einem<br />
bestimmten Zahlenverhältnis aufspaltet. Dieses Verhältnis ist von Faktoren wie dem<br />
Erbgang und den Merkmalen der Elternpflanzen abhängig. Aus dieser Entdeckung konnte<br />
Mendel wichtige Informationen über die Gene als Träger des Erbgutes ableiten<br />
1) Erbträger können anwesend sein, ohne ausgeprägt zu werden<br />
2) Gene wirken in den Bastarden zwar zusammen, verschmelzen aber nicht<br />
miteinander zu etwas ganz anderem, da sie ja wieder aufgespaltet werden können<br />
3) Gene müssen in den Körperzellen reinrassiger Individuen doppelt(diploid)<br />
vorhanden sein, in den Keimzellen aber nur einfach(haploid), damit sie sich in den<br />
Nachkommen neu kombinieren können<br />
Eizelle<br />
Pollen<br />
V w<br />
V VV Vw<br />
W Vw ww<br />
Wo V drin ist, gibt es violette Blüten,<br />
da V dominant ist.<br />
Genotyp – Phänotyp<br />
Genotyp Phänotyp<br />
VV<br />
(homozygot)<br />
violett<br />
Vw<br />
(heterozygot)<br />
violett<br />
Vw<br />
(heterozygot)<br />
violett<br />
ww<br />
(homozygot)<br />
weiss<br />
Phänotyp = Erscheinungsbild<br />
Genotyp = genetische Grundlage<br />
Schlussfolgerung:<br />
Weisses Merkmal kommt wieder zum Vorschein.<br />
Violette und weisse Blüten kommen im Verhältnis 3:1 zum Vorschein.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 36 / 70
Rückkreuzung<br />
Wie würde man abklären, ob die Eltern für<br />
ein bestimmtes Merkmal rein- oder mischerbig<br />
sind? Eine Rückkreuzung wird durchgeführt,<br />
um den Genotyp eines Organismus<br />
zu bestimmen, der ein dominantes Merkmal<br />
zeigt, zum Beispiel die purpurfarbenen<br />
Blüten einer Erbsenpflanze. Solch ein Organismus<br />
könnte entweder homozygot oder<br />
heterozygot für das dominante Allel sein. Der<br />
beste Weg, um den Genotyp zu bestimmen,<br />
ist die Kreuzung dieses Organismus mit<br />
einem anderen, der das rezessive Merkmal<br />
zeigt. Da der Genotyp einer weibblütigen<br />
Pflanze homozygot sein muss, kann man<br />
den Genotyp der Pflanze mit purpurfarbenen<br />
Blüten aus den Phänotypen der Nachkommen<br />
ableiten.<br />
Gesetz der freien Kombinierbarkeit<br />
Mendel untersuchte nicht nur ein Merkmal - die Blütenfarbe - an den Erbsenpflanzen, sondern<br />
noch sechs andere. Damit konnte er herausfinden, ob die Erbanlagen einer Rasse mit<br />
all ihren Ausprägungen (Grösse, Wuchsform, Farbe etc.) eine Einheit bilden, oder ob sie auf<br />
einzelnen Genen liegen und somit frei kombinierbar sind. Mendel kreuzte Pflanzen, die sich<br />
in mehreren Merkmalen voneinander unterschieden und fand heraus, dass die Merkmale<br />
sich mischten: die Nachkommen einer roten, grossen Pflanze und einer weissen, kleinen<br />
konnten sowohl rot und klein als auch weiss und gross werden. Diese Kombinierbarkeit ist<br />
jedoch nur möglich, wenn die Merkmale auf verschiedenen Chromosomen liegen, was bei<br />
der Erbse der Fall war. Die phänotypischen Ausprägungen liegen hierbei in einem jeweils<br />
speziellen Verhältnis vor.<br />
Wenn sich Organismen nur in einem Merkmal unterscheiden nennt man sie monohybrid.<br />
Jedoch in zwei Merkmalen heissen sie dann dihybrid.<br />
Fazit:<br />
Die Merkmale für Farbe und Form werden unabhängig voneinander vererbt.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 37 / 70
Erweiterung der Mendel-Genetik<br />
Die Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp ist selten einfach. Manche heterozygote<br />
Genotypen bedingen unvollständige Dominanz. Diese Individuen zeigen ein Erscheinungsbild,<br />
das zwischen dem der Eltern liegt (intermediärer Phänotyp). Bei Codominanz bildet ein<br />
Organismus die Phänotypen beider Allele aus. Manche Gene besitzen multiple (mehrere bis<br />
zahlreiche) Allele. Unter Pleiotropie versteht man die Auswirkung eines einzelnen Gens auf<br />
multiple Merkmale. Bei Epistase beeinflusst ein Gen die phänotypische Ausprägung eines<br />
anderen. Einige Merkmale sind quantitativer Art, das heisst, sie zeigen eine kontinuierliche<br />
Variabilität des Phänotyps, wobei zwei oder mehr Gene für die Ausprägung eines einzelnen<br />
Merkmals verantwortlich sind. Quantitative Merkmale lassen auf polygene Vererbung schliessen.<br />
Die Umwelt beeinflusst ebenfalls die Ausprägung quantitativer Merkmale. Man spricht<br />
dann von multifaktoriellen Einflüssen.<br />
1. Dominant-rezessiver Erbgang<br />
Ein Allel bestimmt ganz das Merkmal (setzt sich zu 100% durch) und das andere<br />
verschwindet (wird ganz unterdrückt) ganz.<br />
2. Intermediärer Erbgang<br />
Der Intermediäre Erbgang ist ein Fall unvollständiger Dominanz.<br />
3. Codominante Erbgänge<br />
Beide Allele exprimieren sich ganz (100%) unabhängig voneinander.<br />
Bsp. rote Blutkörperchen<br />
1 Allel für M -> M-Blutgruppe<br />
1 Allel für N -> N-Blutgruppe<br />
2 Allele, je eines für N und M -> MN-Blutgruppe<br />
Genotyp Phänotyp Antikörper<br />
Agglutination<br />
A B AB 0<br />
AA, AI A anti-B - + + -<br />
BB, BI B anti-A + - + -<br />
AB AB - - - - -<br />
I I 0 anti-A und B + + + -<br />
Bis jetzt haben wir im weiteren angenommen, dass ein Gen für ein Phän codiert. Viele Gene<br />
zeigen aber Einfluss auf unterschiedliche Phäne. Man spricht hier von der Polyphämie oder<br />
Pleiotropie. (= Phänomen, dass ein Gen zwei oder mehrere voneinander unabhängige Merkmale<br />
beeinflussen kann. Siehe weiter unten.)<br />
Die Allele die sich zusammen in der Zelle befinden beeinflussen sich nicht gegenseitig auf<br />
DNS-Ebene. Dominanz und Rezessivität kommen erst durch die Expression der Allele zur<br />
Auswirkung. Die meisten Gene existieren in mehr als zwei allelen Formen. Die Häufigkeit<br />
eines Allels in einer Population ist von seiner Dominanz oder Rezessivität unabhängig. Des<br />
Weiteren kann die Ausprägung eines Gens durch die Nachbarschaft zu einem anderen Gen<br />
beeinflusst werden.<br />
Autosomal-dominanter Erbgang<br />
Kann keine Generation überspringen<br />
Gesunde besitzen das Defektallel nicht, ihre Eltern und Kinder sind gesund.<br />
Kranke sind heterozygot oder homozygot, von ihren Eltern ist mindestens einer krank,<br />
ihre Kinder sind gesund oder krank.<br />
Kinder von zwei gesunden Eltern können krank sein.<br />
Kinder von zwei kranken Eltern können gesund sein.<br />
Autosomal-rezessiver Erbgang<br />
Kann Generationen überspringen.<br />
Gesunde können ein Defektallel besitzen, ihre Eltern und Kinder sind gesund oder krank<br />
Kranke sind homozygot, ihre Eltern haben beide das Defektallel, ihre Kinder haben das<br />
Defektallel.<br />
Kinder von zwei gesunden Eltern können krank sein.<br />
Kinder von zwei kranken Eltern sind nie gesund.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 38 / 70
Pleiotropie<br />
Gene können nicht nur einen bestimmten sondern gleich für mehrere Phänotypen-Aspekte<br />
ausprägend sein. Die Befähigung eines Gens, den Phänotyp eines Organismus in vielfacher<br />
Weise zu beeinflussen wird als Pleiotropie bezeichnet. So verursachen Allele, die für bestimmte<br />
menschliche Erbkrankheiten verantwortlich sind, gewöhnlich vielfältige Symptome.<br />
Epistase<br />
Gehört zum Phänomen Polygenie bei der die Gene sich gegenseitig beeinflussen können<br />
Wenn ein Gen die phänotypische Ausprägung eines anderen Gens überlagert spricht man<br />
von Epistase. Ein Gen, das epistatisch über ein anderes ist kann die Ausprägung unabhängig<br />
vom Allel-Typ dieses Gens beeinflussen.<br />
Polygene Vererbung<br />
Polygene Vererbung ist das Gegenteil von Pleiotropie. Hier wirken mehrere Gene zusammen<br />
um einen Phänotyp zu prägen. Auf diese Art wird ein Kontinuum an Merkmalen gebildet,<br />
nicht bloss Entweder-Oder Werte. Beispiele hierfür sind die Körpergrösse und Hautfarbe<br />
beim Menschen. Man spricht auch von quantitativen Merkmalen. Alle Allele aller Gene haben<br />
eine kumulative Wirkung obwohl auch hier Dominante Allele anzutreffen sind. Diese<br />
unterdrücken die Rezessiven Allele jedoch nicht vollständig. Durch die zufällige Kombination<br />
aller Gene für einen Phänotyp entsteht in der Population eine Normalverteilung (Gauss-<br />
Kurve) der Ausprägung des Phänotyps, der jedoch auch von der Umwelt beeinflusst wird.<br />
Beitrag der Umwelt zum Phänotyp<br />
Der Einfluss der Umwelt auf den Phänotyp erkennt man leicht bei eineiigen Zwillingen, die<br />
denselben Genotyp besitzen, jedoch unterschiedliche Phänotypen aufzeigen, bedingt durch<br />
ihre individuellen Lebensumstände. Oft ist jedoch nicht klar wie gross der Anteil der Umwelt<br />
an einem bestimmten Phänotyp ist, denn aus einem Genotyp lassen sich nicht nur ein sondern<br />
eine ganze Bandbreite von Phänotypen bilden. Man nennt dies die Reaktionsnorm des<br />
Genotyps. Diese Reaktionsnorm kann den Wert Null annehmen, was bedeutet, dass die<br />
Umwelt keinerlei Einfluss ausübt, zum Beispiel bei den Blutgruppen. Bei allen Werten ungleich<br />
Null besitzt die Natur einen gewissen Einfluss. Im Allgemeinen zeigen polygen<br />
vererbte Merkmale die breiteste Reaktionsnorm. Wenn Umwelt und Genotyp Einfluss<br />
nehmen spricht man von multifaktoriellen Merkmalen.<br />
Beispiel: Körpergrösse<br />
Der Genotyp bestimmt nicht allein, er lässt Varietäten zu. Je nach Umwelt verändert<br />
sich somit die Körpergrösse.<br />
Wir sind ein Ergebnis von: Einfluss + Genotyp + Umwelt.<br />
Man spricht auch von der Modifikation des Phänotyps. Modifikationen sind nicht erblich.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 39 / 70
10 Chromosomen – Theorie der Vererbung<br />
(Kapitel 15)<br />
Geschlechtschromosomen<br />
Die chromosomale Basis der Geschlechtsbestimmung<br />
ist bei den Organismen<br />
unterschiedlich. Das Geschlecht ist ein<br />
phänotypisches Merkmal, das gewöhnlich<br />
von der Anwesenheit oder Abwesenheit<br />
spezifischer Chromosomen bestimmt<br />
wird; der genaue Mechanismus<br />
der Geschlechtsbestimmung ist bei<br />
verschiedenen Organismenarten unterschiedlich.<br />
Beim Menschen und anderen<br />
Säugern erfolgt die Geschlechtsbestimmung<br />
durch ein XY-System. Ein<br />
männliches Individuum (XY) erzeugt<br />
Spermien, die entweder ein X- oder ein<br />
Y-Chromosom enthalten; ein solches<br />
Spermium verschmilzt mit einer Eizelle,<br />
die ein X-Chromosom des weiblichen<br />
Partners (XX) erhält. Deshalb wird das<br />
Geschlecht der Nachkommen dadurch<br />
bestimmt, ob die Befruchtung durch ein<br />
Spermium mit einem X (weiblich)- oder<br />
einem Y (männlich)-Chromosom erfolgt.<br />
Das Geschlecht bestimmt das<br />
Spermium!!<br />
Geschlechtsbestimmung durch<br />
Umweltfaktoren:<br />
Beispiel: Reptilien (Schildkröten etc.)<br />
Bei < 30 Grad weiblich. Bei >30 Grad<br />
männlich.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 40 / 70
Geschlechtsgebundene Gene zeigen besondere Erbgänge. Auf dem X-Chromosom sind<br />
auch Gene lokalisiert, die nichts mit der Geschlechtsbestimmung zu tun haben. Hämophilie<br />
beispielsweise ist eine X-chromosomal vererbte Krankheit. Bei weiblichen Säugetieren wird<br />
eines der beiden X-Chromosomen der Somazellen während der frühen Embryonalentwicklung<br />
nach den Gesetzen des Zufalls zum Barr-Körperchen inaktiviert.<br />
X-chromosomal-dominanter Erbgang<br />
Mehr Frauen betroffen, bei Knaben oft letal.<br />
Heterozygote Frauen sind krank.<br />
Kranke Mädchen sind homo- oder heterozygot, ihre Mutter und/oder Vater ist krank.<br />
Kranke Knaben sind hemizygot, ihre Mutter ist krank.<br />
X-chromosomal-rezessiver Erbgang<br />
Mehr Männer betroffen.<br />
Heterozygote Frauen sind Überträgerinnen.<br />
Kranke Mädchen sind homozygot, ihr Vater ist krank, die Mutter Überträgerin.<br />
Kranke Knaben sind hemizygot, ihre Mutter ist Überträgerin.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 41 / 70
11 Evolutionsbiologie<br />
(Kapitel 22 – 26)<br />
Bibel: Welt und die Lebewesen wurden geschaffen und sind unveränderlich.<br />
Paläontologie: (Georges Cuvier)<br />
Charles Darwin (Pfarrer)<br />
Beobachtungen:<br />
1. Die Arten haben ein sehr grosses Fortpflanzungspotential (Überschuss an Nachkommen).<br />
Alle Arten weisen ein derart hohes Fortpflanzungspotenzial auf, dass ihre Populationsgrösse<br />
exponentiell zunehmen würde, wenn alle Individuen, die geboren werden, sich<br />
erfolgreich fortpflanzten.<br />
2. Die Umweltressourcen sind begrenzt.<br />
3. Die meisten Populationen bleiben in ihrer Abundanz (Grösse, Anzahl) konstant.<br />
Fazit: Knappe Ressourcen und hohe Anzahl Lebewesen (mehr als die Umwelt tragen kann) führt<br />
zu einem Kampf ums Überleben. D.h. Nur ein kleiner Teil der Geburten überleben. Darwin<br />
spricht von natürlicher Auslese. (= Selektion).<br />
Weitere Beobachtungen:<br />
4. Die Individuen einer Population zeigen grosse Variabilität in ihren Merkmalen.<br />
5. Ein Grossteil der Variabilität der Merkmale ist erblich.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 42 / 70
Fazit: Die Selektion bevorzugt die am besten an die Umwelt angepassten Individuen. -> Genpool<br />
verändert sich. Das Überleben im Existenzkampf beruht nicht auf Zufall, sondern hängt<br />
unter anderem von den Erbanlagen der überlebenden Individuen ab. Die durch ihre<br />
ererbten Merkmale am besten an die Umwelt angepassten Individuen hinterlassen<br />
wahrscheinlich mehr Nachkommen als weniger gut angepasste.<br />
Die ungleichen Überlebens- und Fortpflanzungsfähigkeiten von Individuen führen zu einem<br />
graduellen Wandel in einer Population, wobei sich vorteilhafte Merkmale im Laufe der<br />
Generationen anhäufen.<br />
Wir können Darwins Hauptideen wie folgt zusammenfassen.<br />
1. Die natürliche Selektion ist der unterschiedliche Fortpflanzungserfolg (die ungleichen Überlebens-<br />
und Fortpflanzungsfähigkeit von Individuen).<br />
2. Die natürliche Selektion erfolgt durch eine Wechselwirkung zwischen der Umwelt und der<br />
unter den einzelnen Organismen einer Population vorhandenen Variabilität.<br />
Das Produkt der natürlichen Selektion ist die Anpassung von Organismenpopulationen an ihre<br />
Umwelt.<br />
Theorie der Anpassung einer Art<br />
Wie entsteht diese grosse Variabilität innerhalb einer Population?<br />
1. Durch sexuelle Fortpflanzung bei:<br />
- der Homologenpaarung zu der Metaphase der Meiose I<br />
- beim Crossing-over<br />
- durch das zufällige verschmelzen der Gameten bei der Befruchtung<br />
2. Durch Mutation<br />
(= spontane Veränderungen im Erbgut)<br />
Wie entsteht aus einem Homozygot ein heterozygot? Durch Mutation. Allele eines Gens<br />
entstehen durch Mutation.<br />
Es gibt Mutationen auf unterschiedlichen strukturellen Ebenen.<br />
- Punktmutationen<br />
- Chromosomenmutationen<br />
- Genommutationen<br />
Punktmutation<br />
- Mutationen entstehen spontan<br />
- Arten haben spezifische Mutationsraten.<br />
- Mutationen können auch durch Umwelteinflüsse ausgelöst werden.<br />
Fazit: Die Fehler resp. die Mutationen sind die Ursache, resp. der Motor der Entwicklung<br />
(Veränderung). Mit anderen Worten: Das Leben ist Fehler freundlich.<br />
Punktmutationen sind die Ursache des Entstehens von Allelen (= Varianten eines Gens).<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 43 / 70
Chromosomenmutation Genommutationen<br />
Oft ist auch nur 1 Chromosom überzählig z.B. Trisomie 21 (beim Menschen) -> Mongoloie<br />
Beispiel wie sich Mutationen auswirken können:<br />
Resistenzbildung bei Insekten<br />
(Das gleiche passiert auch mit Antibiotika)<br />
Antibiotikum am besten in grosser Dosis so kurz wie möglich anwenden. In hoher<br />
Konzentration damit es überall hin gelangt, möglichst kurz, damit nicht zu viele Mutanten<br />
entstehen können.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 44 / 70
Evolution von Populationen<br />
Finken<br />
- Schnäbel auf der Insel kleiner, auf dem Festland grösser<br />
Evolution = Langsame Änderung der Merkmale einer Art.<br />
Revolution = schnelle Änderung<br />
1. Wie findet die Evolution statt?<br />
Auf der Insel sowie auf dem Festland wirkt eine natürliche Selektion (Umwelteinflüsse). Der<br />
grosse Schnabel ist jedoch schlecht für die kleinen Samen auf der Insel. Die Umwelt<br />
selektioniert also auf der Insel die Vögel mit grossen Schnäbeln.<br />
2. Worauf wirkt die Selektion?<br />
Selektion wirkt auf die Phänotypen.<br />
Das Merkmal „Schnabelgrösse“ variiert.<br />
3. Warum existieren Vögel mit unterschiedlicher Schnabelgrösse?<br />
Die Grundlage der phänotypischen Vielfalt ist die genetische Variabilität.<br />
4. Wie entsteht die genetische Variabilität?<br />
Die primäre Ursache genetischer Variabilität ist die Mutation. Mutationen sind zufällige<br />
Ereignisse auf der Ebene:<br />
• DNS (Punktmutation)<br />
• Chromosomen (-mutation)<br />
• Genom (-mutation)<br />
Nur Mutationen in Keimzellen (Gameten) sind relevant für die genetische Variabilität. Nicht jede<br />
Mutation im Körper ist relevant.<br />
Die sekundäre Ursache genetischer Variabilität ist die sexuelle Rekombination.<br />
5. Wie wirkt die natürliche Selektion auf der genetischen Ebene?<br />
• Jedes Merkmal eine Phänotypen wird durch ein Gen (oder mehrere Gene) determiniert bzw.<br />
bestimmt.<br />
• Durch Mutation verändert sich das Gen. Wir nennen ein mutiertes Gen Allel.<br />
• In einer Population können für das Gen eines Merkmals viele Allele existieren.<br />
• Ein Allel hat in einer Population eine Häufigkeit (Frequenz).<br />
Berechnung von Allel-Frequenzen<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 45 / 70
Berechnung der Allelfrequenz zu der Generation der Nachkommen:<br />
Fazit:<br />
- Allelfrequenzen ändern durch Fortpflanzung nicht.<br />
- Sexuelle Fortpflanzung hat keinen Einfluss auf den Genpool.<br />
Hardy-Weinberg-Gleichung zusammengefasst:<br />
p 2 + 2pq + q 2 = 1<br />
Die Hardy-Weinberg-Gleichung drückt den Gleichgewichtszustand der genetischen Struktur<br />
für ein Merkmal in einer Population aus.<br />
Um im Gleichgewicht zu sein, muss eine Population in erster Linie fünf Bedingungen<br />
erfüllen:<br />
Eine sehr grosse Population. In einer Population begrenzter Grösse kann genetischer<br />
Drift, das heisst zufällige Schwankungen im Genpool, die Häufigkeit von Genotypen im<br />
Laufe der Zeit ändern.<br />
Keine Migration. Der Genfluss, der Austausch von Allelen zwischen Populationen durch<br />
die Wanderung von Individuen oder Keimzellen, kann die Frequenz eines Genotyps, der<br />
unter den Immigranten häufig ist, erhöhen.<br />
Keinerlei Mutationen. Mutationen verändern den Genpool, indem sie ein Allel in ein<br />
anderes umwandeln.<br />
Völlig zufällige Paarungen. Wenn Individuen Geschlechtspartner mit bestimmten<br />
Genotypen auswählen, erfolgt kein zufälliges Vermischen der Gameten, wie es für das<br />
Hardy-Weinberg-Gleichgewicht erforderlich ist.<br />
Keine natürliche Selektion. Durch den unterschiedlichen Überlebens- und<br />
Fortpflanzungserfolg von Genotypen kann sich deren Frequenz ändern. Das kann zu<br />
einer messbaren Abweichung von den Häufigkeiten führen, die nach der Hardy-<br />
Weinberg-Gleichung zu erwarten sind.<br />
Änderungen im Genpool<br />
Die wichtigsten Ursachen die zu Änderungen der Allel-Frequenz von Generation zu Generation<br />
führen sind:<br />
Mutationen (6 rote -> 5 rote + 1 grünes)<br />
Die natürliche Selektion führt zu Veränderungen im Genpool. (4 rote -> 2 rote)<br />
Genfluss (Inmigration z.B. 4 grüne kommen dazu, ex-Migration: gehen weg)<br />
Genetische Drift<br />
Beispiel Münzen werfen<br />
Kopf Zahl<br />
bei 100'000 Würfen 50’000 50’000<br />
bei 1’000 500 500<br />
bei 10 5 5<br />
Umso kleiner die Anzahl an Würfen umso grösser die Abweichung vom theoretischen zu<br />
erwartenden Wert.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 46 / 70
Bei 1000 Individuen ca. 50:50 ist bei der nächsten Population wieder etwa eine<br />
Wahrscheinlichkeit bei 50:50. Jedoch bei nur 10 Individuen ist womöglich die<br />
Wahrscheinlichkeit bei 90:10.<br />
Je kleiner die Population umso wichtiger wird der Zufall, für die Fortpflanzung einzelner<br />
Individuen, resp. die natürliche Selektion.<br />
Was für Gründe führen zu drastischen Verkleinerungen von Populationen?<br />
Ursachen:<br />
Flaschenhalseffekt<br />
In der Umwelt sind das in der Regel Katastrophen mit der Folge, dass nur wenige Individuen<br />
überleben.<br />
Gründereffekt<br />
Auswanderung (freiwillig oder erzwungen)<br />
Fazit: Von allen aufgeführten Ursachen, die zu Änderungen im Genpool führen, wirkt nur die<br />
natürliche Selektion adaptiv. (eigentlich genetische Drift + natürliche Selektion!)<br />
Wie wirkt die natürliche Selektion auf eine Population?<br />
Die natürliche Selektion kann sich auf die Häufigkeit eines erblichen Merkmals auf drei unterschiedliche<br />
Weisen auswirken, je nachdem, welche Phänotypen in einer variablen Population begünstigt<br />
werden. Diese drei Selektionstrends bezeichnet man als gerichtete, disruptive und<br />
stabilisierende Selektion. Die gerichtete Selektion ist am häufigsten in Zeiten von Umweltveränderungen,<br />
oder wenn Vertreter einer Population in einen neuen Lebensraum mit anderen<br />
Umweltbedingungen abwandern. Sie verschiebt die Häufigkeitskurve für Variationen eines<br />
phänotypischen Merkmals in die eine oder die andere Richtung, indem sie zunächst relativ seltene<br />
Individuen begünstigt, die für dieses Merkmal vom Durchschnitt abweichen. Die disruptive<br />
Selektion tritt auf, wenn sich Umweltbedingungen auf eine Weise ändern, die Individuen an<br />
beiden Extremen eines phänotypischen Spektrums gegenüber den dazwischen liegenden<br />
Phänotypen begünstigt. Die stabilisierende oder optimierende Selektion wirkt gegen extreme<br />
Phänotypen und begünstigt die gewöhnlichen, dazwischen liegenden Varianten. Diese Form der<br />
Selektion verringert die Variabilität und erhält den Ist-Zustand für ein bestimmtes Merkmal.<br />
Obgleich wir diese drei Selektionstrends als Wirkungsweisen der Selektion bezeichnen, ist der<br />
grundlegende Mechanismus der natürlichen Selektion in jedem Fall der gleiche: Die Selektion<br />
begünstigt bestimmte erbliche Merkmale über einen unterschiedlichen Fortpflanzungserfolg.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 47 / 70
Evolution und Sexualität<br />
Beispiel:<br />
Grund: Sexuelle Fortpflanzung ist besser, obwohl sie viel weniger quantitativ fortpflanzt, dafür<br />
jedoch viel qualitativer. (genetische Variabilität)<br />
Evolution erzeugt ausgeprägte sexuelle sekundäre Geschlechtsmerkmale.<br />
sind Folgen intersexuellen Selektion zwischen männlichen und weiblichen Individuen<br />
Merkmale dominieren das Geschlecht. Z.B. Pfau mit Schweif<br />
intrasexuelle Selektion zwischen männlichen und weiblichen Individuen<br />
Bsp. Kämpfe um sexuellen Partner (Vögel, Gorillas)<br />
Die natürliche Selektion kann keine perfekten Organismen hervorbringen. Es gibt mindestens vier<br />
Gründe, warum die natürliche Selektion keine Vollkommenheit erzeugen kann.<br />
1. Die Evolution ist durch historische Einschränkungen limitiert.<br />
2. Anpassungen sind oft Kompromisse.<br />
3. Nicht jeder Evolutionsschritt ist adaptiv.<br />
4. Die Selektion kann nur existierenden Varianten begünstigen<br />
Wie kann sich die genetische Variabilität erhalten?<br />
Mutationsrate (es wird laufend neu erschaffen)<br />
Es existiert eine Art spezifische Mutationsrate. (Je grösser die Mutationsraten sind, desto<br />
grössere Variabilität entsteht.)<br />
Diploidie (rezessive werden nicht selektiert)<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 48 / 70
12 Die Entstehung der Arten<br />
Teilung der Population<br />
Was geschieht, wenn ein Teil einer Population sich während langer Zeit von der ursprünglichen<br />
Population getrennt entwickelt?<br />
Der Genpool der beiden<br />
Populationen entwickelt sich<br />
unterschiedlich.<br />
Was geschieht, wenn ein Teil der abgetrennten Population nach langer Zeit zur<br />
Ursprungspopulation zurückkehrt?<br />
1. Sie vermischen sich wieder mit der Ursprünglichen Population, d.h. sie haben untereinander<br />
fertile Nachkommen. (Bild links)<br />
2. Sie bleiben getrennt von der ursprünglichen Population, d.h. sie bilden keine gemeinsamen<br />
Nachkommen mehr. In diesem Fall ist eine neue Spezies, resp. Art entstanden. Daraus<br />
folgt, dass innerhalb einer Art Reproduktion möglich ist. (Bild rechts)<br />
Möglichkeiten der Artbildung<br />
geografische, resp. räumliche Trennung (Bsp. Gebirge, Inseln)<br />
Artbildung auf der Grundlage räumlicher Trennung nennt man allopatrische Artbildung.<br />
Artbildungen können auch innerhalb einer Population erfolgen, d.h. ohne räumliche<br />
Trennung. Diese nennt man sympatrische Artbildung.<br />
Allopatrische Artbildung<br />
Mehrere geologische Prozesse können eine Population in zwei oder mehr isolierte Populationen<br />
unterteilen. Aber auch ohne geologische Umgestaltung können geographische Isolation und<br />
allopatrische Artbildung auftreten, wenn Individuen ein neues, geographisch abgelegenes Gebiet<br />
besiedeln und dadurch von der Ausgangspopulation abgeschnitten werden. Welches Ausmass<br />
eine geographische Barriere aufweisen muss, um allopatrische Populationen voneinander<br />
getrennt zu halten, hängt von der Ausbreitungsfähigkeit der Lebewesen ab. Die<br />
Wahrscheinlichkeit für allopatrische Artbildung nimmt zu, wenn eine Population sowohl klein als<br />
auch isoliert ist. Der Genpool einer kleinen, isolierten Population wird sich viel eher durch<br />
genetischen Drift und natürliche Selektion erheblich ändern. Aber auf jede kleine Population, aus<br />
der eine neue Art hervorgeht, kommen viele andere, die in ihrer neuen Umgebung einfach<br />
zugrunde gehen. Eine entscheidende Frage hinsichtlich allopatrischer Populationen ist, ob sie<br />
unterschiedlich genug geworden sind, dass sie sich nicht mehr kreuzen und fruchtbare<br />
Nachkommen produzieren können. Wenn der Genpool einer isolierten Population durch<br />
genetischen Drift und natürliche Selektion evolviert, kann als Nebenprodukt der genetischen<br />
Veränderung eine reproduktive Isolation von der Ausgangsart entstehen. Solche<br />
Fortpflanzungsbarrieren verhindern selbst dann eine Kreuzung mit der Ausgangsart, wenn die<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 49 / 70
Populationen wieder miteinander in Kontakt kommen. Die Evolution mehrerer Arten aus einem<br />
gemeinsamen Vorfahren nennt man adaptive Radiation.<br />
Bsp. Drosophila (Fruchtfliegen)<br />
Fazit: Selektion des Umweltfaktors „Nährmedium“ zeigt auch Auswirkungen auf den Reproduktionserfolg.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 50 / 70
Sympatrische Artbildung<br />
Bei der sympatrischen Artbildung entstehen neue Arten innerhalb des Verbreitungsgebiets ihrer<br />
Ausgangspopulation, nicht in geographisch getrennten Populationen. Die Arten werden durch<br />
Fortpflanzungsbarrieren voneinander getrennt.<br />
Mögliche Ursachen, die zur Artbildung führen:<br />
Genetische Isolierung durch Polyploidisierung.<br />
Obiges Beispiel zeigt die Entstehung einer Ploidieänderung durch die Kombination eines<br />
Meiosefehlers mit anschliessender Selbstbefruchtung.<br />
Tetraploide sind i.d.R. lebensfähig und können sich asexuell vermehren. Sie können sich<br />
jedoch nicht geschlechtlich Fortpflanzen, d.h. eine Kreuzung mit diploiden Organismen der<br />
Ausgangspopulation ist nicht mehr möglich.<br />
4n 3n<br />
3n<br />
2n 3n<br />
Fazit: Triploide Gameten können keine Meiose durchführen (-> Sterilität der Nachkommen)<br />
Autopolyploid bezeichnet man ein Individuum mit mehr als zwei Chromosomensätzen.<br />
Wenn zwei Arten einer Polyploiden, Nachkommen schaffen, spricht man von Allopolyploidie.<br />
Beispiel einer Allopolyploidie:<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 51 / 70
Reproduktionsbarrieren<br />
Welches ist der trennende Mechanismus, der Populationen nicht mehr zusammenfinden lässt,<br />
resp. neue Arten entstehen lässt?<br />
Die Unmöglichkeit fruchtbare Nachkommen zu zeugen nennt man reproduktive Isolation.<br />
Reproduktionsbarrieren:<br />
Habitatisolation (Verschiedene Lebensräume)<br />
Zeitliche Isolation (Phasen der Fruchtbarkeit)<br />
Verhaltensisolation (Verhalten bei der Paarung)<br />
Mechanische Isolation (Auseinanderentwickeln der Geschlechtsorgane)<br />
Gametische Isolation<br />
Erkennen von Makromoleküle zwischen Spermium und Eizelle. Wenn es nicht die gleiche<br />
bzw. richtige Struktur hat, kann das Spermium nicht eindringen.<br />
Verminderte Lebensfähigkeit der Hybriden<br />
Während der Entwicklung kann der Verlauf gestoppt werden. Das führt dann zum Tode.<br />
Verminderte Fruchtbarkeit der Hybriden (z.B. durch Meioseprobleme)<br />
Beispiel:<br />
Pferd (männlich) + Esel (weiblich) = Maulesel<br />
Pferd (weiblich) + Esel (männlich) = Maultier<br />
Überblick Fortpflanzungsbarrieren:<br />
Verschiedene präzygotische (progame)<br />
Barrieren verhindern eine Paarung<br />
zwischen Arten oder die Befruchtung der<br />
Eizelle, sofern Vertreter unterschiedlicher<br />
Arten versuchen sollten, sich zu paaren.<br />
1. Habitatisolation. Zwei Arten, die in<br />
demselben Gebiet in unterschiedlichen<br />
Habitaten leben, treffen<br />
möglicherweise selten, wenn überhaupt,<br />
aufeinander, selbst wenn sie<br />
rein formal nicht geographisch<br />
isoliert sind.<br />
2. Verhaltensisolation. Spezielle<br />
Signale, die Partner anlocken, wie<br />
auch hoch entwickelte Verhaltensweisen,<br />
die spezifisch für eine Art<br />
sind, zählen vermutlich zu den<br />
bedeutendsten Fortpflanzungsbarrieren<br />
unter nahe verwandten<br />
Tierarten Verhaltensisolation beruht<br />
oft auf ausgeklügelten Balzritualen.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 52 / 70
3. Zeitliche Isolation. Zwei Arten, die sich zu verschiedenen Tageszeiten, Jahreszeiten oder in<br />
unterschiedlichen Jahren paaren, können ihre Keimzellen nicht kombinieren.<br />
4. Mechanische Isolation. Bisweilen versuchen Individuen nah verwandter Arten, sich<br />
miteinander zu paaren, können die Kopulation aber nicht vollziehen, weil sie anatomisch<br />
nicht zueinander passen.<br />
5. Gametische Isolation. Selbst wenn die Gameten verschiedener Arten aufeinander treffen,<br />
verschmelzen sie selten zu einer Zygote. Die Gameten erkennen sich an artspezifischen<br />
Makromolekülen auf der Plasmamembran der Samenzellen und Eihülle.<br />
Postzygotische Barrieren<br />
Wenn trotz progamer Barrieren eine Spermazelle eine artfremde Eizelle befruchtet, verhindern<br />
gewöhnlich postzygotische (metagame) Barrieren, dass die Bastardzygote sich zu einem<br />
lebensfähigen, fertilen Erwachsenen entwickelt.<br />
6. Verminderte Lebensfähigkeit. Wenn<br />
Hybridzygoten gebildet werden, kann<br />
es sein, dass die Entwicklung der<br />
Hybriden durch genetische Unverträglichkeit<br />
(Inkompatibilität) zwischen den<br />
beiden Arten in irgendeinem Embryonalstadium<br />
abgebrochen wird<br />
(Hybridsterblichkeit).<br />
7. Verminderte Fruchtbarkeit. Selbst<br />
denn zwei Arten sich paaren und<br />
widerstandsfähige Bastardnachkommen<br />
hervorbringen, ist die<br />
reproduktive Isolation intakt, sofern<br />
die Hybriden völlig oder grösstenteils<br />
steril sind. Da die unfruchtbaren<br />
Bastarde sich nicht mehr mit einer der<br />
Elternarten rückkreuzen können, ist kein freier Genfluss zwischen den Arten möglich. Als<br />
eine der Ursachen für diese Barriere bilden die Hybriden bei der Meiose keine normalen<br />
Gameten, wenn die Chromosomen der beiden Elternarten sich in ihrer Anzahl oder Form<br />
voneinander unterscheiden (Bastardsterilität).<br />
8. Hybridenzusammenbruch. In einigen Fällen, in denen Arten sich kreuzen, sind die Hybriden<br />
der ersten Generation lebensfähig und fruchtbar, doch wenn diese Bastarde sich<br />
untereinander oder mit einer der beiden Elternarten paaren, sind die Nachkommen der<br />
nächsten Generation schwach oder steril (Bastardzusammenbruch).<br />
Wie entstehen die Fortpflanzungsbarrieren?<br />
Genotyp ist verantwortlich für den Phänotypen.<br />
Grün: 1 Allel zuständig für 1 Merkmal<br />
Orange: 1 Allel/Gen für mehrere Merkmale codiert<br />
Blau: Auch mehrere Gene für 1 Merkmal verantwortlich<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 53 / 70
Makroevolution<br />
Evolutionsbiologen fassen unter dem Begriff "Makroevolution" Mechanismen zusammen, durch<br />
die neue höhere Taxa wie Gattungen, Familien, Ordnungen, Klassen oder Stämme entstehen,<br />
neue Anpassungszonen besiedelt werden oder Neubildungen wie die Flügel bei Vögeln oder die<br />
Beine bei landlebenden Wirbeltieren (Tetrapoden) auftreten.<br />
Im Gegensatz dazu stehen die Vorgänge der Mikroevolution, die z.B. dazu führen, dass sich<br />
getrennte Populationen einer Art genetisch so auseinander entwickeln, dass sie zunächst<br />
Unterarten, bzw. getrennte Populationen, bilden und im weiteren Verlaufe eigene Arten ausbilden.<br />
Unterschied:<br />
Ein Beispiel soll den Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution illustrieren: Mikroevolution<br />
wäre die Variation der Form des Hornschnabels von Vögeln. Ein Vogelschnabel kann kurz und<br />
dick sein (gut zum Knacken harter Kerne), er kann aber auch fein und lang sein (was zum Beispiel<br />
gut für das Stochern nach Insekten in Baumrinden ist).<br />
Makroevolution dagegen ist die Entstehung des Hornschnabels aus einem bezahnten Kiefer eines<br />
Vorläuferreptils. Dabei wären in mehrfacher Hinsicht Umbauten erforderlich, die mit blossen<br />
Variationen (dicker, dünner, länger, kürzer) nicht zu erreichen sind. Ein Hornschnabel ist aus<br />
anderem Material als Zähne aufgebaut; die Muskulatur muss angepasst sein, das Verhalten<br />
(Nahrungserwerb, Fressbewegungen) muss entsprechend abgestimmt sein, die Integration des<br />
Schnabels im Schädel ist anders als bei einem Zahnkiefer usw.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 54 / 70
13 Phylogenie und Systematik<br />
Fossilbelege und geologische Zeit<br />
Sedimentgesteine sind die reichhaltigsten Quellen für Fossilien. Die Fossilfunde liefern das<br />
historische Archiv, anhand dessen Biologen die Geschichte des Lebens erforschen.<br />
Paläontologen verfügen über eine Vielzahl von Methoden, um Fossilien zu datieren.<br />
Sedimentschichten offenbaren das relative Alter von Fossilien in aufeinander folgenden<br />
geologischen Perioden. Das absolute Alter von Fossilien in Jahren kann man durch<br />
radiometrische Datierung und andere Methoden bestimmen. Die geologischen Zeitalter und<br />
Perioden entsprechen jeweils einem grösseren Übergang in der Zusammensetzung der<br />
Fossilienarten. Die Chronologie der geologischen Perioden und Zeitalter bildet die<br />
geologische Zeitskala.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 55 / 70
Die Fossilbelege stellen eine wesentliche, aber unvollständige Chronik der Stammesgeschichte<br />
dar. Fossilbelege gibt es vor allem von Arten, die für lange Zeit existierten, häufig<br />
und weit verbreitet waren und Schalen oder harte Skelette besassen.<br />
Man kann genau sagen, wie alt die Fossile im Boden sind.<br />
Die Phylogenie hat eine biogeographische Triebfeder in der Kontinentaldrift. Die Kontinentalverschiebung<br />
hatte bedeutende Auswirkungen auf die Geschichte des Lebens, weil sie zu<br />
grossen geographischen Neuordnungen führte, die sowohl die Biogeographie als auch die<br />
Evolution beeinflussten. Die Bildung des Superkontinents Pangaea während des späten<br />
Paläozoikum und sein nachfolgendes Auseinanderbrechen während des frühen Mesozoikum<br />
erklären viele biogeographische Rätsel.<br />
Die Geschichte des Lebens ist geprägt durch wiederholte Massenaussterben. Die Stammesgeschichte<br />
war charakterisiert durch lange, relativ stabile Perioden, unterbrochen von<br />
Intervallen beträchtlichen Artenumschwungs - mit Massenaussterben, denen grosse<br />
Episoden adaptiver Radiationen folgten.<br />
Eine Art kann aussterben, weil ihr Lebensraum zerstört wurde oder sich in eine für sie<br />
ungünstige Richtung veränderte. Wenn die Meerestemperaturen nur um wenige Grad fallen,<br />
kommen viele ansonsten hervorragend angepasste Arten um. Doch selbst wenn die physikalischen<br />
Faktoren der Umwelt stabil sind, können sich die biologischen Faktoren ändern.<br />
Zur Umwelt, in der eine Art lebt, gehören auch die anderen dort lebenden Organismen, und<br />
eine evolutionäre Veränderung bei einer Art wird sich wahrscheinlich auch auf die anderen<br />
Arten der Lebensgemeinschaft auswirken. Die Evolution von harten Körperteilen wie Kiefer<br />
oder Schalen durch Tiere des Kambriums könnte dazu beigetragen haben, dass manche<br />
Lebewesen ohne solche Hartteile eher Räubern zum Opfer fielen und daher eher vom<br />
Aussterben bedroht waren. Aussterben ist in einer sich verändernden Welt praktisch<br />
unvermeidlich, und es gab Krisen in der Geschichte des Lebens, in denen die globalen<br />
Umweltveränderungen derart rasch und zerrüttend erfolgten, dass die Mehrzahl der Arten<br />
ausgelöscht wurde.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 56 / 70
14 Die junge Erde und die Entstehung des Lebens<br />
Einführung in die Geschichte des Lebens<br />
Vor 3,5 bis 4 Milliarden Jahren entstand das Leben auf der Erde. Die Erde bildete sich vor<br />
4,5 Milliarden Jahren. Die ältesten Fossilien von Prokaryoten sind 3,5 Milliarden Jahre alt.<br />
Die Prokaryoten bestimmten die Evolutionsgeschichte von Beginn an für etwa 1,5 Milliarden<br />
Jahre allein. Die beiden Domänen der Prokaryoten, Bacteria und Archaea, entwickelten sich<br />
aus einem Spektrum unterschiedlicher metabolischer Typen heraus. Sie traten in der Nähe<br />
unterseeischer hydrothermaler Schlote auf oder lebten in Flachwassergemeinschaften, die<br />
Stromatolithen genannte Fossilien zurückliessen.<br />
Sauerstoff begann sich in der Atmosphäre vor 2,7 Milliarden Jahren anzureichern. Mit den<br />
Cyanobakterien entstand die Sauerstoff produzierende (oxygene) Photosynthese. Mit der<br />
Akkumulation von O2 in der Atmosphäre war eine beträchtliche Herausforderung an das<br />
entstandene Leben verbunden.<br />
Eukaryotisches Leben bildete sich vor 2,1 Milliarden Jahren. Die ältesten Fossilien von<br />
Eukaryoten werden auf 2,1 Milliarden Jahre zurückdatiert. Die eukaryotische Zelle<br />
entwickelte sich aus einem prokaryotischen Vorfahren, in dessen Cytoplasma kleinere<br />
Prokaryoten lebten.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 57 / 70
Vielzellige Eukaryoten erschienen vor 1,2 Milliarden Jahren. Von vielzelligen Algen gibt es<br />
1,2 Milliarden Jahre alte Fossilien. Die ältesten Fossilien von Tieren sind ungefähr 600<br />
Millionen Jahre alt.<br />
Die Vielfalt der Tiere vergrösserte sich explosionsartig während des frühen Kambrium. Die<br />
meisten Tierstämme hinterliessen erste fossile Spuren in der relativ kurzen Spanne<br />
zwischen 540 und 520 Millionen Jahren vor unserer Zeit.<br />
Pflanzen, Pilze und Tiere eroberten das Festland vor etwa 500 Millionen Jahren.<br />
Symbiontische Beziehungen zwischen Pflanzen und Pilzen trugen zur Eroberung des<br />
Festlands bei. Pflanzenesser und Raubtiere folgten.<br />
Kurz zusammengefasst:<br />
1. Ursprung des Lebens<br />
2. Prokaryoten<br />
3. atmosphärischer Sauerstoff<br />
4. Eukaryoten<br />
5. vielzellige Eukaryoten<br />
6. Tiere<br />
7. Landpflanzen<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 58 / 70
Der Ursprung des Lebens<br />
Die ersten Zellen könnten durch chemische Evolution auf der jungen Erde entstanden sein:<br />
Obwohl sich gegenwärtig das Leben allein durch Biogenese reproduziert, könnten die ersten<br />
Zellen Produkte einer präbiotischen chemischen Evolution gewesen sein.<br />
Die spontane abiotische Entstehung von Biomonomeren ist eine überprüfbare Hypothese.<br />
Führt man im Labor Simulationsexperimente unter Bedingungen durch, die denen auf der<br />
Ur-Erde ähneln, dann entsteht aus anorganischen Vorstufen eine Vielfalt organischer<br />
Verbindungen.<br />
Bei experimenteller Simulation der Bedingungen auf der Ur-Erde kondensieren<br />
Biomonomere zu Makromolekülen. Kleine organische Moleküle können Polymere bilden,<br />
wenn sie sich auf heissem Sand, Stein oder Ton durch die Verdunstung des Wassers<br />
konzentrieren. Ein Beispiel sind Proteinoide.<br />
Das erste genetische Material war vermutlich nicht DNA, sondern RNA. Die ersten Gene<br />
könnten aus abiotisch gebildeter RNA bestanden haben. Ihre Basensequenz diente als<br />
Matrize sowohl bei der Synthese von Polypeptiden aus Aminosäuren als auch bei einer<br />
primitiven Form der Selbstreplikation aus komplementären Basen.<br />
Protobionten konnten sich durch Selbstassemblierung bilden, wie Simulationsexperimente<br />
zeigen. Organische, im Labor synthetisierte Moleküle lagern sich je nach Bedingungen<br />
spontan zu verschiedenartigen Tröpfchen oder Hohlkugeln zusammen (Koazervate,<br />
Mikrosphären, Liposomen), die einige der Eigenschaften des Lebens zeigen und als<br />
Protobionten-Modelle dienen.<br />
Mit Erbinformation ausgestattete Protobionten wurden durch die natürliche Selektion<br />
angepasst. Diejenigen molekularen Aggregate, die am effektivsten in der<br />
Ressourcennutzung waren und die sich am häufigsten reproduzierten, reicherten sich in<br />
dem Gemisch verschiedener Protobionten an.<br />
Die Diskussion über die Entstehung des Lebens geht weiter. Unter den Wissenschaftlern<br />
wird die Debatte darüber fortgesetzt, wie sich die schrittweise Entstehung des Lebens<br />
tatsächlich vollzogen haben mag.<br />
Die Hauptlinien des Lebens<br />
Das Fünf-Reiche-System spiegelte das zunehmende Wissen über die Diversität des Lebens<br />
wider. Das traditionelle System der fünf Reiche unterteilt die Organismen in Monera<br />
(Prokaryoten), Protista (einzellige Eukaryoten), Plantae, Fungi und Animalia.<br />
Das Einteilen der Organismen in Reiche ist noch nicht abgeschlossen. Eine<br />
Weiterentwicklung ist das System aus drei Domänen (Bacteria, Archaea und Eukarya) und<br />
die Aufspaltung der Prokaryoten und der Protisten in viele Reiche.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 59 / 70
15 Verhaltensbiologie<br />
(Kapitel 51)<br />
Einführung in das Verhalten und die Verhaltensökologie<br />
Verhalten ist, was ein Tier tut und wie es dies tut.<br />
Verhalten besteht in erster Linie aus beobachtbaren, von Muskeln erzeugten Bewegungen.<br />
Jede Verhaltensweise hat sowohl ultimate als auch proximate Ursachen. Zu den proximaten<br />
(direkten, unmittelbaren) Ursachen gehören die hormonellen und neuronalen Stimuli sowie<br />
die Reize aus der Umwelt, die im Leben eines Tieres ein bestimmtes Verhaltensmuster<br />
auslösen. Als ultimate (indirekten, mittelbaren) Ursachen bezeichnet man die Gründe für die<br />
Evolution des Verhaltensmusters im Laufe entwicklungsgeschichtlicher Zeiträume.<br />
Verhalten resultiert aus genetischen und Umweltfaktoren. Das Verhalten eines Individuums<br />
entwickelt sich unter dem Einfluss von Genen und Umwelt.<br />
Angeborenes Verhalten<br />
Angeborenes Verhalten ist durch die Entwicklung fixiert. Angeborene Verhaltensweisen<br />
treten bei allen Individuen einer Population auf, ungeachtet individueller Unterschiede in der<br />
Erfahrung.<br />
Verhalten dient dem Überleben und der Fortpflanzung.<br />
Verhalten hat sich im Verlaufe der Erdgeschichte entwickelt. Es wird durch Umwelt<br />
selektioniert (im Sinne von bestraft) oder belohnt.<br />
Ist das Verhalten genetisch bedingt oder wird es durch die Umgebungsbedingungen<br />
bestimmt? Experiment:<br />
Fazit: Das Verhalten zeigt genetische Grundlagen. Kommt also aus dem Erbgut.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 60 / 70
Die klassische Ethologie deutete bereits eine evolutionsbiologische Komponente der<br />
Verhaltensbiologie an. Die ersten Ethologen erforschten vor allem Erbkoordinationen;<br />
darunter versteht man im Wesentlichen unveränderlich ablaufende Verhaltensweisen, die<br />
nach Auslösung durch einen äusseren sensorischen Reiz (Schlüsselreiz) in der Regel<br />
komplett ablaufen.<br />
Die genetischen Grundlagen bilden das angeborene Verhalten.<br />
Beispiele:<br />
Erbkoordination (Verhalten wird abgespielt nach Schlüsselreiz)<br />
Beispiele:<br />
- Nachtfalter Klappt Flügel bei Gefahr zusammen und lässt sich zu<br />
- Fledermaus Boden fallen. -> überlebt vielleicht so.<br />
- Stichling (reagiert auf alles Rote aggressiv)<br />
Die natürliche Selektion hat Verhaltensmuster begünstigt, welche die Überlebenswahrscheinlichkeit<br />
und den Fortpflanzungserfolg steigern.<br />
Optimales Verhalten maximiert die reproduktive Fitness.<br />
Beispiele:<br />
- Raben<br />
- Schnecken<br />
Neben angeborenem Verhalten gibt es das Lernen.<br />
In der Verhaltensökologie stehen evolutionsbiologische Hypothesen im Vordergrund.<br />
Nach der Theorie der Verhaltensökologie verhalten sich Tiere so, dass ihre Darwin-Fitness<br />
(ihr Fortpflanzungserfolg) maximiert wird.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 61 / 70
Lernen<br />
Lernen ist auf Erfahrung basierende Modifikation von Verhalten. Unter Lernen versteht<br />
man eine Veränderung des Verhaltens aufgrund von spezifischen Erfahrungen. Manche<br />
scheinbaren Lernprozesse sind in Wirklichkeit auf Reifung zurückzuführen. Als Habituation<br />
bezeichnet man eine einfache Form des Lernens, bei der die Sensibilität für unwichtige<br />
Reize abstumpft.<br />
Anders gesagt: Lernen ist eine Modifikation des Verhalten, die sich aufgrund bestimmter<br />
Erfahrungen ergeben.<br />
Es gibt:<br />
- Prägung<br />
- assoziatives Lernen<br />
Als Prägung bezeichnet man auf eine sensible Phase begrenztes Lernen. Prägung findet<br />
bei verschiedenen Tieren statt und kann ebenso auf Geschlechtspartner erfolgen wie auf<br />
die Eltern.<br />
Beispiel wären die Graugänse von Konrad Lorenz:<br />
"Wenn Sie eine junge Gans (...) in Obhut des Menschen aus dem Ei schlüpfen lassen, so<br />
dass der Mensch das erste Lebewesen ist, das ihm begegnet, dann fixiert die junge Gans<br />
in nicht mehr rückgängig zu machender Weise ihre kindliche Anhänglichkeit an den<br />
Menschen, dem sie als erstes begegnet ist, und folgt ihm während ihrer ganzen Jugend so<br />
getreu nach, wie sie normalerweise den Eltern nachfolgen würde."<br />
Einige Tiere haben spezielle Zeitfenster von ca. 2-3 Tagen. In dieser Zeit werden<br />
Umwelteinflüsse und -eindrücke wahrgenommen und „fixiert“. Man spricht von Prägung.<br />
Prägung ist irreversibel.<br />
Es gibt auch Arten, die mehrere Prägungszeiten haben, sowie unterschiedlich lange.<br />
Fazit:<br />
Die Prägungsexperimente zeigen, dass das Verhalten auch von der Umwelt beeinflusst<br />
werden kann.<br />
Der Vogelgesang kann als Modellsystem für die Entwicklung von Verhalten dienen.<br />
Biologen haben zwei Formen der Entwicklung des Vogelgesangs beschrieben: Lernen<br />
während einer sensiblen Phase (wie bei der Dachsammer) und unbegrenztes Lernen (wie<br />
beim Kanarienvogel); bei letzterer Form fügt der Vogel seinem Gesang jedes Jahr wieder<br />
neue Komponenten hinzu.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 62 / 70
Viele Tiere können lernen, einen Reiz mit einem anderen zu assoziieren. Beim<br />
assoziativen Lernen wird ein Reiz mit einem anderen verknüpft. Bei der operanten<br />
Konditionierung („Lernen durch Versuch und Irrtum") lernt ein Tier, eine seiner<br />
Verhaltensweisen mit Belohnung oder Bestrafung in Verbindung zu bringen, und verändert<br />
sein Verhalten entsprechend.<br />
Beispiele:<br />
- Pawlow’s Hunde<br />
- Versuche mit Ratten<br />
Kognitive Fähigkeiten von Tieren<br />
Das Studium der Kognition verbindet die Funktionsweise des Nervensystems mit dem<br />
Verhalten. Unter Kognition versteht man die Fähigkeit des Nervensystems eines Tieres,<br />
durch Sinnesrezeptoren gesammelte Informationen wahrzunehmen, zu speichern und zu<br />
verarbeiten.<br />
Zur Fortbewegung im Raum bedienen sich Tiere verschiedener kognitiver Mechanismen.<br />
Viele Tiere orientieren sich im Raum, indem sie sich Landmarken einprägen. Ein effizienterer<br />
Mechanismus zur Orientierung sind kognitive Karten (auch als innerer Atlas bezeichnet) −<br />
innere Repräsentationen der räumlichen Beziehungen zwischen Objekten in der Umwelt der<br />
Tiere. Einige Zugvögel und manche anderen Tiere nutzen verschiedene Parameter zur<br />
Kompassorientierung: das Magnetfeld der Erde sowie den Stand der Sonne und der Sterne.<br />
Sozialverhalten und Soziobiologie<br />
Die Soziobiologie untersucht Sozialverhalten im evolutionsbiologischen Kontext.<br />
Der Begriff Sozialverhalten umfasst alle Interaktionen zwischen zwei oder mehr - in der<br />
Regel artgleichen - Tieren.<br />
Sozialverhalten ist Interaktion zwischen zwei oder mehreren Tieren der gleichen Art. Zu<br />
Sozialverhalten zählen wir:<br />
- Aggression<br />
- Kooperation<br />
- Balzverhalten<br />
Beim konkurrierenden Sozialverhalten geht es oft um die Verteilung von Ressourcen.<br />
= Agonistisches Verhalten ist das Verhalten bei Auseinandersetzungen um den Zugang zu<br />
begrenzten Ressourcen, beispielsweise zu Nahrung oder einem Geschlechtspartner. Bei<br />
manchen Tierarten existieren Rangordnungen, bei denen ranghohe Individuen bevorzugt<br />
Zugang zu Ressourcen erhalten. Territorialität ist ein Verhalten, bei dem ein Tier einen<br />
bestimmten Teil seines Streifgebiets gegen Artgenossen verteidigt.<br />
Es geht um:<br />
- Nahrung<br />
- Fortpflanzungspartner<br />
- Territorien<br />
- Randordnung<br />
Beispiele:<br />
Schlangen, Schimpansen, Wölfe<br />
Fazit:<br />
Keine Toten oder Verletzte.<br />
Die Kämpe sind ritualisiert, damit können klare Rangordnungen gemacht werden.<br />
Territorien<br />
-> werden markiert i.d.R. mit Urin oder Talkdrüsen<br />
-> Wölfe und andere Tiere markieren sehr genau. Dringt ein Fremder ein, wird er<br />
umgebracht.<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 63 / 70
Die natürliche Selektion begünstigt ein Paarungsverhalten, das die Zahl oder die Qualität<br />
der Geschlechtspartner maximiert. Das Balzverhalten dient dazu, dass sich Individuen als<br />
Artgenossen erkennen und die Fortpflanzungsbereitschaft des anderen feststellen.<br />
Zustande gekommen sind die komplexen Balzverhaltensweisen durch sexuelle Selektion,<br />
insbesondere infolge der Partnerwahl durch die Weibchen. Bei der Balz kann ein<br />
Männchen seine genetischen Qualitäten zur Schau stellen sowie (bei Arten mit elterlicher<br />
Fürsorge) seine Bereitschaft, sich um die Nachkommen zu kümmern. Im Tierreich findet<br />
man ein breites Spektrum verschiedener Paarungssysteme, je nachdem, wie sich<br />
Männchen und Weibchen einer Art zur Fortpflanzung zusammenschliessen; hierzu<br />
gehören Promiskuität, Monogamie und Polygamie. Welches Paarungssystem sich<br />
ausbildet, hängt unter anderem vom jeweiligen Elternaufwand der Männchen und<br />
Weibchen ab.<br />
Balzverhalten = werbendes Verhalten<br />
Beispiele:<br />
Albatrosse, Blaufusstölpel<br />
Charakteristiken:<br />
1. hoch ritualisiert (klar determiniert in seinem Ablauf)<br />
2. Wichtig für die Erkennung der eigenen Art<br />
3. die Selektion von fitten Männchen von den Weibchen. Balzrituale zeigen dem<br />
Weibchen, ob das Männchen etwas taugt. (Die natürliche Selektion durch das<br />
Weibchen.)<br />
Paarungssysteme<br />
Promiskuitive Paarungssysteme zeigen keine dauerhafte Paarbeziehung und Paarbindung.<br />
Langfristige Beziehungen mit Paarbindung existieren in zwei Arten:<br />
1. Monogamie (Paarbeziehung für ein Leben)<br />
z.B. Vögel wegen Brutpflege. So zu sagen, selektionierendes Phänomen der<br />
Brutpflege.<br />
2. Polygamie (Einer der beiden Partner hat mehrere Beziehungen)<br />
Polygamiebeziehungen existieren in zwei Formen:<br />
Polygynie<br />
Männchen hat viele Weibchen.<br />
-> Totale Anzahl Nachkommen grösser als bei Polyandrie.<br />
-> grössere Konkurrenz führt zu grösserer Fitness<br />
Polyandrie<br />
Weibchen hat viele Männchen.<br />
z.B. Spinnen, Krebse<br />
-> Variabilität vom Genpool kleiner<br />
-> führt zu Polymorphologie (Männchen grösser als Weibchen.)<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 64 / 70
16 Glossar<br />
Chromosomenschäden oder falsche<br />
Aberration<br />
Chromosomenzahl<br />
Die Bewegung einer Substanz durch eine<br />
Biomembran gegen ihre Konzentrations- oder<br />
aktiver Transport<br />
elektrochemischen Gradienten mithilfe von<br />
Energiezufuhr und spezifischen<br />
Transportproteine.<br />
Allele Die Zustandsformen eines Gens<br />
Häufige Form der Polyploidie, entsteht durch<br />
Allopolyploidie<br />
Kreuzung verschiedener Arten und Kombination<br />
ihrer Chromosomen<br />
Einfache Verbindungen werden mit Energie<br />
zu komplexen Gebilden (mit hoher Enthalpie)<br />
Anabolismus<br />
Ordnung erhöht sich<br />
(z.B. Polypeptidbildung)<br />
Form des evolutionären Wandels, bei der ganze<br />
Anagenese<br />
Populationen sich verändern<br />
Die Teilphase der Mitose bei der sich die<br />
Chromatiden jedes Chromosoms aufgetrennt<br />
Anaphase<br />
haben und die Tochterchromosomen an die<br />
Zellpole wandern<br />
Eine Aberration bei der von einem Chromosom zu<br />
Aneuploidie<br />
viele oder zu wenige Exemplare vorhanden sind<br />
Die Überführung fremder Stoffe in körpereigene<br />
Assimilation<br />
Substanzen.<br />
Aster Spindelpol<br />
Adeninhaltiges Nucleosidtriphosphat, das bei<br />
ATP<br />
Hydrolyse seiner Phosphatbindungen Freie<br />
Energie abgibt.<br />
Der Besitz von mehr als zwei homologen<br />
Autopolyploidie<br />
Chromosomensätzen (z.B. aus Verdopplung der<br />
Chromosomen durch Fehler bei der Meiose)<br />
Alle nicht Geschlechtsbestimmenden<br />
Autosomen<br />
Chromosomen<br />
Das inaktivierte X-Chromosom in den Zellen<br />
Barr-Körperchen<br />
weiblicher Säuger, das als dichtes Objekt<br />
erkennbar an der Innenseite der Kernhülle liegt<br />
Bastard Nachkomme zweier verschiedener Arten<br />
Pflanzen; Organismen, die organische Moleküle<br />
autotroph<br />
aus Rohstoffen selbst herstellen<br />
Biodiversität Vielfalt der Lebewesen auf der Erde<br />
Biogenese Leben entsteht nur aus Leben<br />
Die durch Stoffwechsel aufgebaute Materie eines<br />
Biomasse<br />
Lebewesen.<br />
Biozönose Lebensgemeinschaft<br />
Die thermisch getriebene Eigenbewegung von<br />
Brown’sche Molekularbewegung<br />
Teilchen.<br />
Calvin-Zyklus Der Prozess in dem Zucker hergestellt wird.<br />
Strukturen in Tierzellen, die an der Bildung des<br />
Centriolenpaar<br />
Spindelapparats beteiligt sind<br />
Der Bereich, in dem Schwesterchromatiden<br />
Centromer<br />
miteinander verbunden sind<br />
Im Cytoplasma aller Eukaryotenzellen<br />
vorhandenes, für die Zellteilung wichtiges<br />
Centrosom<br />
Material, auch als Mikrotubuli-<br />
Organisationszentrum bezeichnet<br />
Chiasmata Der X-förmige Bereich der Überkreuzung<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 65 / 70
homologer Chromatiden, die durch Crossing-Over<br />
während der Meiose genetisches Material<br />
ausgetauscht haben<br />
chemiosmotische Theorie<br />
erklärt wie aus Sonnenenergie, chemische<br />
Energie entsteht<br />
Chlorophyll Das grüne Pigment in den Blättern<br />
Chloroplasten Zuständig für die Photosynthese.<br />
Chromosom<br />
Fadenartige, Gene tragende Strukturen im<br />
Zellkern. Jedes Chromosom besteht aus einem<br />
sehr langen DNA-Molekül und damit assoziierte<br />
Proteine.<br />
Codominanz Beide Allele exprimieren unabhängig voneinander<br />
Der gegenseitige Austausch von genetischem<br />
Crossing-Over<br />
Material zwischen Nicht-Schwesterchromatiden<br />
während der Meiose I<br />
Cytokinese Zellteilung<br />
Cytoplasma<br />
Plasma zwischen Zellmembran und Kern,<br />
Cytoskelett<br />
Darwin-Fitness<br />
bestehend aus Cytosol<br />
Ein Netzwerk aus Mikrotubuli, Mikrofilamenten<br />
und Intermidiärfilamenten, die sich durch das<br />
gesamte Cytoplasma verzweigen und zahlreiche<br />
mechanische Funktionen und Transportaufgaben<br />
erfüllen.<br />
Mass für den relativen Beitrag eines Individuums<br />
zum Genpool der nächsten Generation<br />
Defektallel<br />
Allel mit zu defekten führendem genetischen<br />
Code<br />
Deletion Verlust von Genen auf einem Chromosom<br />
Dichteabhängigkeit<br />
Zellen teilen sich nur bis der gesamte Platz belegt<br />
Diffusion<br />
ist<br />
Die spontane Tendenz beweglicher Teilchen, sich<br />
ihrem Konzentrationsgradienten folgend aus<br />
Bereichen höherer in Bereiche niedrigerer<br />
Konzentration zu bewegen.<br />
Zellen teilen sich nur bis der gesamte Platz belegt<br />
ist.<br />
Dihybrid<br />
Dihybrid: Bezeichnung für Organismen, die<br />
hinsichtlich zweier bestimmter Gene heterozygot<br />
sind (AaBb)<br />
Diploid Zwei Chromosomensätze<br />
Dissimilation Die Zersetzung von organischen Molekülen<br />
DNS Desoxyribonucleinsäure<br />
Dominant Das Allel das vollständig Exprimiert wird<br />
Drift<br />
Auf Zufallsereignisse zurückzuführende<br />
Veränderungen im Genpool kleiner Populationen<br />
Dunkelreaktion Calvin-Zyklus<br />
Duplikation Verdopplung von Genen auf einem Chromosom<br />
Emergenz<br />
lat. emergere auftauchen, emporsteigen; die<br />
Endergonische Reaktion<br />
Summe ist mehr als die einzelnen Teile<br />
Prozess, bei dem freie Energie aus der<br />
Umgebung aufgenommen wird. Kann nur in<br />
Kombination mit einer exergonischen Reaktion<br />
stattfinden.<br />
Enthalpie<br />
Die Enthalpie ist ein Mass für die Energie eines<br />
Systems.<br />
Entropie Unordnung = Mass für Ordnung<br />
Enzyme<br />
Eine Klasse von Proteinen die als Katalysator<br />
Epistase<br />
dienen.<br />
Das Phänomen, das en Gen die Expression eines<br />
anderen, unabhängig vererbten Gens beeinflusst<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 66 / 70
Eukaryoten Protisten, Pflanzen, Pilze und Tiere<br />
Die Veränderung des Lebewesens an seine sich<br />
ändernde Umwelt. Dieser Prozess führt zur<br />
Evolution<br />
Vielfalt des Lebens. Das Produkt der Evolution,<br />
die Phylogenese, ergibt sich aus Variabilität und<br />
Selektion.<br />
Nutzbarmachung einer Eigenschaft für eine<br />
Exaptation<br />
Funktion, die nicht vorgesehen war<br />
Spontan ablaufende chemische Reaktion mit<br />
Exergonische Reaktion<br />
Nettoabgabe von freier Energie.<br />
Exprimierung Das Ausbilden eines Phänotyps<br />
Der genetische Drift, der sich aus der<br />
Flaschenhalseffekt<br />
Reduzierung einer Population ergibt<br />
Das Modell der Membranstruktur, dem zufolge die<br />
Membran ein Mosaik aus Proteinmolekülen ist,<br />
Flüssig-Mosaik-Modell<br />
die einzeln in eine flüssige Phospholipid-<br />
Doppelschicht eingebettet sind und sich lateral in<br />
ihr bewegen können.<br />
Eine Energiemenge symbolisiert durch G, die<br />
Entropie (S) und Gesamtenergie des Systems (H)<br />
zueinander in Beziehung setzt. Die Änderung der<br />
freie Energie<br />
freien Energie eines Systems berechnet sich<br />
nach der Gleichung, ∆G = ∆H-T∆S, wobei T die<br />
absolute Temperatur ist.<br />
Die zufällige Ausrichtung der Chromosomen vor<br />
freie Rekombination<br />
der Zellteilung<br />
Frequenz Häufigkeit eines Allels<br />
Gameten Haploide Keimzelle<br />
Genetische Last Defektes Allel<br />
Genetik Übertragung von Informationen<br />
Genom Gesamtheit aller Erbfaktoren eines Organismus<br />
Die Gesamtheit aller Erbanlagen eines<br />
Genotyp<br />
Organismus.<br />
Die Gesamtheit aller Gene in einer Population zu<br />
Genpool<br />
einem bestimmten Zeitpunkt.<br />
Geschlechtschromosomen Die Geschlechtsbestimmenden Chromosomen<br />
Produktion von Proteinen und Verteilung. Er kann<br />
Golgi-Apparat<br />
Stoffe abgeben und verteilen.<br />
Gonaden Die Gameten produzierenden Organe<br />
Grana Thylakoidstapel in den Chloroplasten<br />
Genetischer Drift infolge der Kolonisierung eines<br />
Gründereffekt<br />
Lebensraumes durch eine begrenzte Zahl von<br />
Individuen<br />
Haftungsabhängigkeit Zellen teilen sich auf festem Untergrund<br />
Axiom, dem zufolge der sexuelle Austausch von<br />
Genen allein nicht die genetische<br />
Hardy-Weinberg-Gesetz<br />
Gesamtzusammensetzung einer Population<br />
verändern kann<br />
Hemizygot Im Besitz von X- und Y-Chromosom<br />
Evolutionäre Veränderungen im zeitlichen Ablauf<br />
Heterochronie<br />
oder in der Geschwindigkeit der Entwicklung<br />
Heterosiseffekt siehe Heterozygotenvorteil<br />
haploid Zelle mit einem einzigen Chromosomensatz<br />
heterotroph Tiere, Menschen<br />
Allele sind unterschiedlich (mischerbig)<br />
heterozygot<br />
Mit zwei verschiedenen Allelen für ein bestimmtes<br />
genetisches Merkmal ausgestattet<br />
Ein Mechanismus, der die Variabilität in<br />
Heterozygotenvorteil<br />
Eukaryotengenpools erhält. Das Phänomen, dass<br />
Heterozygote einen grösseren<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 67 / 70
Hominiden<br />
Fortpflanzungserfolg haben als Individuen, die für<br />
eines der betreffenden Allele homozygot sind<br />
Echte Menschen<br />
Hominoiden Menschenartig<br />
Homologe Chromosomen<br />
Die Chromosome welche die gleichen Gene<br />
tragen<br />
Homologien<br />
Die Ähnlichkeit bestimmter Merkmale infolge<br />
Homöotische Gene<br />
Hox-Gene<br />
gemeinsamer Abstammung<br />
Gene, die den Gesamtbauplan von Tieren<br />
festlegen, indem sie das Entwicklungsschicksal<br />
von Zellgruppen kontrollieren<br />
Gene, die andere Gene beeinflussen; siehe<br />
Homöotische Gene<br />
Homöostase Zustand möglichst konstant halten wollen<br />
Allele sind völlig identisch (reinerbig)<br />
homozygot<br />
Mit zwei identischen Allelen für ein bestimmtes<br />
genetisches Merkmal ausgestattet<br />
hydrophil Wasser anziehend, in Wasser löslich<br />
hydrophob Wasser abstossend, in Wasser nicht löslich<br />
hypertonische Umgebung<br />
Imprinting<br />
Intermediäre Exprimierung<br />
Interphase<br />
isotonische Umgebung<br />
Eine Lösung mit einer höheren Konzentration<br />
eines gelösten Stoffes als eine hypotonische<br />
Lösung<br />
Das geschlechtsspezifische Markieren von<br />
Chromosomen<br />
Der Bereich zwischen vollständiger Dominanz<br />
und Codominanz<br />
Der Teil des Zellzyklus, während dessen sich die<br />
Zelle nicht teilt<br />
Gleiche Konzentration gelöster Stoffe auf beiden<br />
Seiten der Membran<br />
Karyotyp Die Gesamtheit der cytologisch erkennbaren<br />
Katabolismus<br />
Kinetochor<br />
Kladogenese<br />
Komplexe Moleküle werden unter<br />
Energiegewinn zu einfachen Formen<br />
abgebaut<br />
Unordnung (Entropie) erhöht sich<br />
(z.B. Zellatmung)<br />
Spezialisierter Teil des Centromers, der eine<br />
Schwesterchromatide mit der Mitosespindel<br />
verbindet<br />
Artbildung durch Abspaltung von einer<br />
weiterexistierenden Art<br />
Klon Genetisch identischer Nachkomme<br />
Konditionierung<br />
Form des assoziativen Lernens. Die Assoziation<br />
unwichtiger Reize mit feststehender<br />
Verhaltensantwort<br />
Locus Ort eines Gens auf dem Chromosom<br />
Makroevolution<br />
Matrix<br />
Entstehung neuer Baupläne, Evolutionstrends,<br />
adaptive Radiation und Artensterben<br />
siehe Stroma) Grundsubstanz der Chloroplasten<br />
Membran Trennschicht<br />
Metabolismus<br />
Stoffwechsel, die Gesamtheit aller chemischen<br />
Metaphaseplatte<br />
Mikroevolution<br />
Mikrotubuli<br />
Prozesse in einem Organismus<br />
Eine imaginäre Ebene während der Metaphase,<br />
bei der die Centromere aller duplizierten<br />
Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen<br />
liegen<br />
Die Veränderung des Genpools einer Population<br />
im Laufe einiger Generationen<br />
Hohle Stäbe im Cytoplasma aller<br />
Eukaryotenzellen<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 68 / 70
Mikrotubuli-Organisationszentrum (MTOC) Centrosom<br />
in ihnen wird Zucker verbrannt. Sie sind<br />
Mitochondrium<br />
Organellen, die sich frei in der Zelle bewegen<br />
können.<br />
Eine Ansammlung von Mikrotubuli, die an den<br />
Mitosespindel<br />
Bewegungen der Chromosomen während der<br />
Mitose beteiligt sind<br />
Bezeichnung für einen Organismus, der<br />
Monohybrid<br />
hinsichtlich eines bestimmten einzelnen Gens<br />
heterozygot ist<br />
Bezeichnung für die Situation, bei der in einer<br />
Monosomie<br />
Zelle statt der normalen zwei nur eine Kopie eines<br />
Chromosoms vorhanden ist<br />
Morphen Bestimmte Körperformen und -merkmale<br />
mtDNS Mitochondriale DNS<br />
Multifaktorielle Merkmale<br />
Ein phänotypisches Merkmal das durch<br />
genetische und Umweltfaktoren beeinflusst wird<br />
Neotenie Eintritt der Geschlechtsreife<br />
Nichtreziprokes Crossing-Over Deletion und Duplikation<br />
Fehler, bei dem sich in der Meiose I ein<br />
Nondisjunction<br />
homologes Chromosomenpaar oder in der<br />
Meiose II ein Schwesterchromatidenpaar nicht<br />
trennt<br />
Ontogenese eine Lebensphase<br />
Osmose passive Transport von Wassermolekülen<br />
Paläontologie Erforschung von Fossilien<br />
passiver Transport<br />
Die Diffusion einer Substanz durch eine<br />
Biomembran.<br />
Phänotyp<br />
Die Gesamtheit der physischen, physiologischen<br />
und molekularen Merkmale eines Lebewesens.<br />
Phylogenie Erforschung der Evolutionsgeschichte<br />
Pleiotropie<br />
Die Erscheinung, das ein Gen mehrere Effekte<br />
hat<br />
Polyandrie Ein Weibchen paart sich mit mehreren Männchen<br />
Polygene Vererbung<br />
Der Additive Einfluss von zwei oder mehr Genloci<br />
auf ein phänotypisches Merkmal<br />
Polygynie Ein Männchen paart sich mit mehreren Weibchen<br />
Polymorphismus<br />
Koexistenz von zwei oder mehr deutlich<br />
verschiedenen Formen eines Merkmals<br />
Das Vorliegen von mehr als zwei kompletten<br />
Polyploidie<br />
Chromosomensätzen in den Zellen eines<br />
Organismus<br />
Eine spezielle Form des Lernens mit signifikanter<br />
Prägung<br />
angeborener Komponente, die nur während einer<br />
begrenzten sensiblen Phase möglich ist<br />
Phylogenese ganze Lebensgeschichte<br />
Prokaryoten besitzen keinen echten Zellkern und<br />
Prokaryotische Zelle<br />
weisen eine einfachere innere Organisation im<br />
Gegensatz zu den Eukaryoten auf<br />
Dreidimensionale Biopolymere, die aus zwanzig<br />
Proteine<br />
verschiedenen, als Aminosäuren bezeichneten<br />
Monomeren aufgebaut ist<br />
Aktiver Transportmechanismus in<br />
Protonenpumpe<br />
Zellmembranen, der Protonen auf der Zelle<br />
befördert und dabei ein Membranpotential<br />
Qualitative Merkmale Diskrete Merkmale<br />
Racemisierung Chemische Umwandlung von Proteinen<br />
Die Bandbreite verschiedener Phänotypen, die<br />
Reaktionsnorm<br />
infolge von Umwelteinflüssen aus einem einzigen<br />
Genotyp entstehen können<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 69 / 70
Replikation Verdopplung der Chromatiden<br />
Rezessiv Unterdrücktes Allel<br />
Aus zwei Untereinheiten bestehende<br />
Ribosomen<br />
Zellorganellen aus rRNA und Proteinmolekülen,<br />
die im Zellkern aufgebaut werden und an denen<br />
die Proteinsynthese im Cytoplasma erfolgt.<br />
rRNA Nucleinsäuretyp<br />
Schlüsselreiz<br />
Externen Sinnesreiz, der eine Erbkoordination<br />
auslöst<br />
Die replizierten Formen eines Chromosoms, die<br />
Schwesterchromatiden<br />
durch das Centromer zusammengehalten werden<br />
und sich während der Mitose oder Meiose II<br />
trennen<br />
Die unvorhersehbare Verteilung von mütterlichen<br />
Segregation<br />
und väterlichen Chromosomen auf die<br />
Tochterzellen<br />
Die Eigenschaft von Biomembranen, dass<br />
Selektiv Permeabel<br />
manche Substanzen leichter hindurch treten<br />
können als andere<br />
Somatische Zelle Alle Zellen mit Ausnahme der Keimzellen<br />
Speziation Artbildung<br />
Strata Sedimentschicht<br />
Stroma<br />
Die Flüssigkeit, in die im Chloroplasten die<br />
Thylakoidmembranen eingebettet sind<br />
Synapsis Die Paarung homologer Chromosomen<br />
Syngamie Zellverschmelzung bei der Befruchtung<br />
Taxonomie<br />
Benennung und Klassifizierung der<br />
Lebensformen<br />
Abgeflachte Membranzisternen in den<br />
Thylakoid<br />
Chloroplasten, in denen Lichtenergie in<br />
chemische Energie umgewandelt wird<br />
Translokation<br />
Anheftung eines Chromosomenfragments an ein<br />
nicht-homologes Chromosom<br />
Transportprotein<br />
Membranproteine mit deren Hilfe bestimmte<br />
Substanzen die Membran passieren können<br />
Bezeichnung für die Situation, bei der in einer<br />
Trisomie<br />
Zelle statt der normalen zwei, drei Kopien eines<br />
Chromosoms vorhanden sind<br />
Vakuole (tierische Zelle) Vorratsspeicherort von Zellsäften.<br />
X-chromosomale Vererbung Vererbung von Genen auf dem X-Chromosom.<br />
trägt Erbinformationen auf Chromosomen. Gibt<br />
Zellkern<br />
Informationen (Befehle) an die Zelle weiter. Er ist<br />
der „Chef“.<br />
Zellmembran<br />
Aussenhülle der Zelle, Formlos, Semipermeabel<br />
(halbdurchlässig)<br />
Zellplatte<br />
Struktur, aus der während der Cytokinese die<br />
neuen Zellwände entstehen<br />
Zellteilung Die Reproduktion von Zellen<br />
Zellwand (nur pflanzlich)<br />
ist durchlässig. Hält die Zelle zusammen. Bei<br />
pflanzlichen Zellen gibt sie die Form an.<br />
Eine zyklisch operierende Gruppe von Molekülen<br />
Zellzyklus-Kontrollsystem<br />
in der Zelle, welche die entscheidenden<br />
Ereignisse des Zellzyklus auslösen und<br />
kontrollieren<br />
Zygote Befruchtete Eizelle<br />
<strong>Biologie</strong>ZF.doc Irène Stücheli Seite 70 / 70



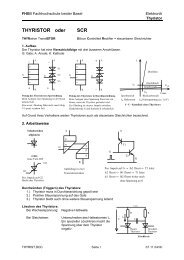





![informationswirtschaft, Personalfreistellung] → Zielsystem ...](https://img.yumpu.com/20670424/1/184x260/informationswirtschaft-personalfreistellung-zielsystem-.jpg?quality=85)