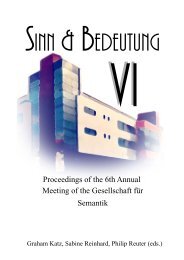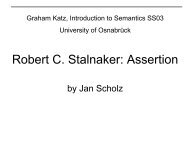Wissenschaftsphilosophie der ... - Cognitive Science
Wissenschaftsphilosophie der ... - Cognitive Science
Wissenschaftsphilosophie der ... - Cognitive Science
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> <strong>der</strong> Kognitionswissenschaft<br />
Vorlesung 4. Reduktive Erklärungen und „Interfield Theories“<br />
In <strong>der</strong> heutigen Stunde erwartet Sie:<br />
• Einleitung<br />
• Was sind reduktive Erklärungen?<br />
• Gegenstand, Gegensatzklasse und explanatorische Relevanz<br />
• Interfield Theories<br />
Vor einem halben Jahrhun<strong>der</strong>t, etwas genauer: im Jahre 1958, ermunterte uns Herbert Feigl zu<br />
dem folgenden Gedankenexperiment:<br />
Suppose we could predict the detailed chemical structure of an entirely new perfume<br />
which will be manufactured in Paris in the year 1995. Suppose, furthermore, that we<br />
could equally exactly predict the neurophysiological effects of this perfume on the mucous<br />
membranes of a human nose, as well as the resulting cortical processes in the person<br />
thus smelling the perfume. Could we then also predict the quality of the experienced<br />
fragrance? (Feigl 1958; 1967, 48-49)<br />
Üblicherweise – so Feigl damals – falle die Antwort auf seine Frage negativ aus, weil angenommen<br />
werde, daß es sich bei dem in Frage stehenden Duft um eine „emergente Neuartigkeit“<br />
handele. Und solche Neuartigkeiten, so glaubte man, seien nicht vorhersagbar. Aber – so<br />
Feigls Antwort – Physikalisten brauchten keineswegs <strong>der</strong>art pessimistisch zu sein (ich zitiere<br />
weiter):<br />
For given the presuppositions of our questions it should also be possible to predict the<br />
answers to questionnaire items like „Is the fragrance more similar to Chanel 5 or to Nuit<br />
d’Amour?“ That is to say, we should be able to predict the location of the quality in the<br />
topological space of odors, provided we have a sufficiency of psychophysiological correlation<br />
laws to make this particular case one of interpolation or (limited) extrapolation.<br />
(ib., 49)<br />
Feigl hielt also eine Antwort auf die Frage: „Wird <strong>der</strong> bis dahin ungerochene Duft <strong>der</strong> neuartigen<br />
Substanz S dem Geruch von Substanz A o<strong>der</strong> dem Geruch von Substanz B mehr ähneln?“<br />
prinzipiell für möglich. Und damit dürfte er auch eine Antwort auf die folgende Frage<br />
für möglich gehalten haben: „Welchen bereits bekannten Gerüchen wird <strong>der</strong> Duft <strong>der</strong> neuartigen<br />
Substanz S am nächsten kommen?“<br />
Extrapolieren wir noch ein wenig mehr, so sollte es im Prinzip auch Antworten auf die<br />
folgende Frage geben: „Welcher bereits bekannten phänomenalen Qualität wird die durch<br />
Vorkommnis V (Substanz, Ereignis, Prozeß) ausgelöste am nächsten kommen?“<br />
Nehmen wir an, aus Feigls Überlegungen wäre ein Forschungsprogramm entstanden:<br />
das Feigl-Programm. Bei erfolgreichem Verlauf verfügten wir dann nicht nur über beliebig<br />
viele psychophysiologische Korrelationsbeziehungen, son<strong>der</strong>n wären sogar in <strong>der</strong> Lage, aufgrund<br />
<strong>der</strong> bereits bestehenden Korrelationen künftige korrekt vorherzusagen (in die verschiedenen<br />
topologischen Räume phänomenaler Erlebnisse einzubetten). Zwischen den verschiedenen<br />
phänomenalen Zuständen und ihren neuronalen Korrelaten hätten wir folglich ein Netz<br />
von Brückengesetzen etabliert, das den gesamten phänomenalen Raum aufspannen würde.<br />
Dürften wir dann nicht berechtigterweise <strong>der</strong> Meinung sein, wir hätten alle wesentlichen Pro-<br />
© Achim Stephan
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> <strong>der</strong> Kognitionswissenschaft. Vorlesung 4. Reduktive Erklärung<br />
bleme, die sich um phänomenale Qualitäten ranken könnten, gelöst? Phänomenale Qualitäten<br />
also reduktiv eingebettet?<br />
Sicher gibt es den einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Kollegen, <strong>der</strong> ein erfolgreich abgeschlossenes<br />
Feigl-Programm so einschätzen würde; unbestritten größer ist jedoch die Zahl <strong>der</strong>jenigen, die<br />
den Eindruck haben, als fange die philosophische Arbeit dann erst an. Und ein Großteil dieser<br />
Kollegen ist wie<strong>der</strong>um <strong>der</strong> Meinung, daß das Problem <strong>der</strong> phänomenalen Qualitäten nur dann<br />
gelöst wäre, wenn wir eine reduktive Erklärung für sie angeben könnten. Und genau diese<br />
scheint aus prinzipiellen Gründen nicht zur Verfügung zu stehen.<br />
In meiner heutigen Vorlesung möchte ich das argumentative Terrain, auf dem wir uns<br />
hier befinden, etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich werde zunächst diskutieren, was<br />
sinnvollerweise unter einer reduktiven Erklärung verstanden werden sollte, und wie <strong>der</strong>en<br />
Gebrauchsanleitung aussieht. Im Anschluß daran stelle ich einige Beispiele aus <strong>der</strong> Hirnforschung<br />
vor, in denen das Vorhandensein bzw. die Abwesenheit bestimmter phänomenaler Zustände<br />
– prima facie – zufriedenstellend reduktiv erklärt werden kann. Es stellt sich dann die<br />
Frage, worin genau die Unterschiede in den philosophisch gefor<strong>der</strong>ten und den wissenschaftlich<br />
gegebenen Erklärungen liegen. Als sehr hilfreich wird sich dabei die Terminologie erweisen,<br />
die Bas van Fraassen im Rahmen seiner pragmatischen Theorie wissenschaftlicher Erklärung<br />
vorgeschlagen hatte. Im abschließenden Teil wende ich mich noch kurz dem von Darden<br />
und Maull vorgeschlagenen Konzept <strong>der</strong> Interfield Theories zu.<br />
Was sind reduktive Erklärungen?<br />
In den letzten Jahren sind verschiedene Vorschläge unterbreitet worden, den Begriff <strong>der</strong> reduktiven<br />
Erklärung zu präzisieren bzw. eine Art Gebrauchsanweisung zur Verfügung zu stellen,<br />
nach <strong>der</strong> man zu einer reduktiven Erklärung gelangen könnte. In diesen Vorschlägen werden<br />
im wesentlichen Ideen aufgegriffen, die C. D. Broad in den zwanziger Jahren im Rahmen<br />
seiner Diskussion emergentistischer Positionen entwickelte und als mechanische Erklärungen<br />
bezeichnete. Reduktive Erklärungen sollten nicht mit Theorie-Reduktionen des Nagel-Typs<br />
verwechselt werden.<br />
Wenden wir uns also zunächst <strong>der</strong> Frage zu, was genau unter einer reduktiven Erklärung<br />
zu verstehen ist. Die Frage nach reduktiven Erklärungen stellt sich üblicherweise, wenn wir<br />
verstehen wollen, weshalb eine bestimmte Entität eine bestimmte Eigenschaft hat, und zwar<br />
eine Eigenschaft, die in <strong>der</strong> Regel nur dem Systemganzen zugeschrieben wird. In trivialen<br />
Fällen genügt die einfache Addition <strong>der</strong> entsprechenden Eigenschaften <strong>der</strong> Komponenten: So<br />
ergibt sich das Gewicht eines Daches aus dem Gewicht <strong>der</strong> Ziegel, <strong>der</strong> Balken und <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
verwendeten Materialien, aus denen es besteht. Die weitaus interessantere Eigenschaft des<br />
Daches, nämlich Schutz vor Regen zu bieten, läßt sich dagegen nicht ganz so einfach erklären.<br />
Denn hier kommt es entscheidend darauf an, wie die einzelnen Bestandteile arrangiert<br />
sind. Erst die richtige Organisation <strong>der</strong> entsprechenden Teile garantiert diese Eigenschaft des<br />
ganzen Systems. Eine solche Eigenschaft gilt dann als reduktiv erklärt, wenn unter Einbeziehung<br />
<strong>der</strong> Bestandteile des fraglichen Systems, unter Berücksichtigung ihres Arrangements,<br />
ihrer Wechselwirkungen und Eigenschaften, vollständig erklärt werden kann, weshalb das<br />
System die genannte Eigenschaft hat. Noch komplizierter gestalten sich solche Erklärungen<br />
für die systemischen Eigenschaften dynamischer Systeme, insbeson<strong>der</strong>e für Lebewesen.<br />
Der Gegenstand einer reduktiven Erklärung ist folglich eine spezifische Eigenschaft o<strong>der</strong><br />
eine spezifische Verhaltensweise eines systemischen Ganzen. Um deutlich zu machen, daß es<br />
sich dabei um die Eigenschaften (o<strong>der</strong> Verhaltensweisen) eines Ganzen handelt, werden diese<br />
auch häufig als Makro-Eigenschaften o<strong>der</strong> als höherstufige Eigenschaften bezeichnet.<br />
2
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> <strong>der</strong> Kognitionswissenschaft. Vorlesung 4. Reduktive Erklärung<br />
Das Ziel einer reduktiven Erklärung besteht nun darin, die höherstufige Eigenschaft allein<br />
durch Rekurs auf die Bestandteile des Systems, <strong>der</strong>en Eigenschaften und Dispositionen, sowie<br />
<strong>der</strong>en Arrangement zu erklären (o<strong>der</strong> gegebenenfalls vorherzusagen). Dazu müssen wir<br />
(i) wissen, welche Eigenschaften die Bestandteile des Systems haben (bzw. wie sich<br />
diese verhalten), wenn sie Bestandteile genau eines solchen Systems, sagen wir eines<br />
Systems mit <strong>der</strong> Mikrostruktur MS(S) = , sind (hier stehe Ci für<br />
eine Komponente und R für die spezifische Anordnung aller Systembestandteile);<br />
und<br />
(ii) muß bekannt sein, welche höherstufige Eigenschaft (bzw. welches Verhalten) mit<br />
genau diesem kollektiven Verhalten <strong>der</strong> Systembestandteile einhergeht.<br />
Nun wäre die reduktive Erklärung jedoch ad hoc und unbefriedigend, wenn sich For<strong>der</strong>ung (i)<br />
allein aus dem Studium von Systemen desselben Typs ergäbe, wenn wir folglich nur Gesetze<br />
<strong>der</strong> folgenden Sorte zur Verfügung hätten: Ist Ci Element des Systems S mit <strong>der</strong> Mikrostruktur<br />
, dann zeigt Ci Verhalten/Eigenschaft Ei. Gesetzmäßigkeiten dieses Typs könnten<br />
nämlich selbst einen versteckten holistischen Charakter haben, nämlich dann, wenn sich<br />
die Ci in S an<strong>der</strong>s verhalten als in an<strong>der</strong>en Systemen, und dies nicht auf ihre Eigenschaften<br />
und wechselseitigen Einflüsse zurückgeführt werden kann. Es ist deshalb eine zentrale Anfor<strong>der</strong>ung<br />
an reduktive Erklärungen, daß sich das Verhalten (bzw. die Eigenschaften) <strong>der</strong> Ci in S<br />
aus den allgemein für sie geltenden einfachen Gesetzen und aus den Interaktionsgesetzen ergibt.<br />
Darauf hat Ansgar Beckermann wie<strong>der</strong>holt in seinen Arbeiten hingewiesen. (Beispiel:<br />
einfache Gesetze erhält man z. B., wenn man Neurone isoliert studiert und immer nur eine<br />
Variable variiert; Interaktionsgesetze, wenn man ihre gegenseitigen Wechselwirkungen studiert).<br />
Angenommen nun, aus den einfachen Gesetzen und den Interaktionsgesetzen folgte, wie sich<br />
alle Bestandteile eines bestimmten Systems verhielten, so ist noch offen, wie wir von da zur<br />
höherstufigen Eigenschaft gelangen.<br />
Ansgar Beckermann zufolge bedarf es dazu allgemeiner Kompositionsgesetze (o<strong>der</strong><br />
Brückenprinzipien), aus denen hervorgeht, wie sich S als Ganzes verhält (bzw. welche Eigenschaften<br />
S als Ganzes hat), wenn sich seine Teile auf eine bestimmte Weise verhalten (vgl.<br />
2002, 130).<br />
Nach Joseph Levine und Jaegwon Kim ist hingegen entscheidend, daß wir die zu erklärende<br />
Eigenschaft bzw. das zu erklärende Verhalten in <strong>der</strong> richtigen Weise begrifflich präparieren.<br />
So for<strong>der</strong>t Kim als ersten Schritt auf dem Weg zu einer reduktiven Erklärung:<br />
„Funktionalisiere die Eigenschaft, die reduziert werden soll, d.h. charakterisiere die Eigenschaft<br />
anhand ihrer kausalen Rolle. Diese Charakterisierung soll in Begriffen <strong>der</strong> Eigenschaften<br />
<strong>der</strong> Basisebene vorgenommen werden“ (2002, 156).<br />
Gesucht ist offenbar eine minutiöse Beschreibung genau dessen, das wir bereits unter einem<br />
an<strong>der</strong>en Begriff kennen, einem Begriff, <strong>der</strong> sich direkt auf die höherstufige Eigenschaft bezieht,<br />
wobei uns ein gröberes Muster als Hinweis auf eine Instantiierung <strong>der</strong> Eigenschaft<br />
dient. Beide Vorschläge – sowohl die Angabe <strong>der</strong> Kompositionsgesetze als auch die begriffliche<br />
Präparierung – haben das gleiche Ziel, nämlich den Übergang von <strong>der</strong> partikularen Ebene<br />
zu <strong>der</strong> systemischen Ebene herzustellen. Schlagen sie fehl, so scheitert die angestrebte reduktive<br />
Erklärung.<br />
3
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> <strong>der</strong> Kognitionswissenschaft. Vorlesung 4. Reduktive Erklärung<br />
Bevor wir uns nun einigen einfachen Beispielen aus <strong>der</strong> wissenschaftlichen Praxis zuwenden,<br />
will ich noch darauf hinweisen, daß die For<strong>der</strong>ung nach reduktiven Erklärungen in zwei Richtungen<br />
erhoben werden kann; diesen entsprechen die beiden folgenden Aufgaben:<br />
(A1) Gegeben sei, daß System S die höherstufige Eigenschaft E hat. Gib’ eine reduktive<br />
Erklärung für E an! (D.h., zeige unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Mikrostruktur MS(S) =<br />
, <strong>der</strong> einfachen Gesetze für die Ci und den zwischen den Ci geltenden<br />
Interaktionsgesetzen, daß ein System mit <strong>der</strong> angegebenen Mikrostruktur E haben<br />
muß! Verwende dazu entwe<strong>der</strong> adäquate begriffliche Präparierungen o<strong>der</strong> Kompositionsgesetze.)<br />
(A2) Gegeben sei ein System S mit <strong>der</strong> Mikrostruktur MS(S) = . In Frage<br />
steht, ob S die höherstufige Eigenschaft E hat. Falls ja, so ist dies durch eine reduktive<br />
Erklärung zu zeigen.<br />
Es dürfte inzwischen klar geworden sein, daß das Feigl-Programm nicht auf die Angabe reduktiver<br />
Erklärungen abzielte, son<strong>der</strong>n sich mit nicht weiter zu erklärenden Korrelationsbeziehungen<br />
zwischen physiologischen und psychischen Eigenschaften begnügte, was ja durchaus<br />
im Geiste <strong>der</strong> Reduktionstheorie war, die zu jener Zeit Ernest Nagel formulierte.<br />
Beispiele aus <strong>der</strong> reduktiven Praxis<br />
Betrachten wir nun einige Beispiele aus <strong>der</strong> Hirnforschung für Erklärungen des Vorliegens<br />
bzw. Nicht-Vorliegens bestimmter phänomenaler Eigenschaften , die in einem weiteren Sinne<br />
des Wortes auch als reduktiv bezeichnet werden könnten.<br />
(1) Stellen Sie sich die folgende experimentelle Situation vor: Sie sitzen vor einem Schirm,<br />
<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Mitte einen kleinen schwarzen Punkt aufweist, und halten Ihre Augen auf diesen<br />
Punkt fixiert. Werden Ihnen seitlich davon für etwa eine zwanzigstel Sekunde Objekte (eine<br />
Tasse o<strong>der</strong> ein Löffel) gezeigt, so genügt bereits dieser kurze Augenblick, um einen visuellen<br />
Eindruck <strong>der</strong> gezeigten Objekte zu erhalten und diese adäquat zu benennen. Die Fixierung auf<br />
den Punkt und die Kürze <strong>der</strong> Darbietung stellt dabei sicher, daß sie Ihre Augen nicht zu dem<br />
gezeigten Objekt wenden.<br />
Nun gibt es jedoch Personen, die zwar unauffällig reagieren, wenn ein solches Objekt<br />
auf <strong>der</strong> rechten Seite des Schirmes erscheint, aber seltsam reagieren, wenn auf <strong>der</strong> linken<br />
Schirmseite ein Gegenstand gezeigt wird. Auf die Frage, was sie sehen, antworten sie:<br />
„Nichts!“ – Aufgefor<strong>der</strong>t, unter dem Tisch mit <strong>der</strong> linken Hand nach einem Objekt zu greifen,<br />
das demjenigen entspreche, das gerade gezeigt wurde, finden viele dennoch das entsprechende<br />
Objekt, ohne es freilich benennen zu können (vgl. Rita Carter 1999, 43 ff.).<br />
Dieses merkwürdige Verhalten wurde erstmals von Roger Sperry bei seinen sogenannten<br />
Split-brain-Patienten entdeckt, also bei Personen, bei denen das Corpus callosum aus medizinischen<br />
Gründen durchtrennt wurde. Ausgehend von <strong>der</strong> Annahme, daß bei gesunden Personen<br />
die beiden Hemisphären in einem regen Austausch stehen, und visuelle Informationen,<br />
die zunächst in die rechte Hemisphäre gelangen, auch den Sprachzentren zur Verfügung stehen,<br />
die sich bei Rechtshän<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Regel in <strong>der</strong> linken Hemisphäre befinden, zog Sperry<br />
den Schluß, daß durch die Trennung <strong>der</strong> Hemisphären aus dem linken Schirmbereich keine<br />
Information mehr zum Sprachzentrum gelangen konnte. Die Benennung des dargebotenen<br />
Objektes war folglich nicht mehr möglich. Gleichzeitig zeigt das Auffinden des Objektes mit<br />
<strong>der</strong> linken Hand, die durch die rechte Hemisphäre gesteuert wird, daß visuelle Information<br />
weitergeleitet wurde, die sogar ausreichte, das gesehene Objekt zu klassifizieren, wenn auch<br />
nicht sprachlich. (Die Frage, ob das „gesehene“ Objekt zwar bewußt wahrgenommen, aber<br />
4
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> <strong>der</strong> Kognitionswissenschaft. Vorlesung 4. Reduktive Erklärung<br />
nicht bezeichnet werden konnte, o<strong>der</strong> ob es gar nicht erst bewußt wahrgenommen werden<br />
konnte, ist aufgrund <strong>der</strong> vorliegenden Daten nicht eindeutig zu beantworten; es scheint jedoch,<br />
als käme es gar nicht erst zu einer bewußten Wahrnehmung.)<br />
Nun darf die hier vorliegende Erklärung durchaus auch das Etikett „reduktiv“ für sich<br />
beanspruchen, wenn auch in einem erweiterten Sinn. Das höherstufige Verhalten, das in diesem<br />
Fall mißlingende Wahrnehmen (o<strong>der</strong> Benennen) gezeigter Gegenstände, wird zurückgeführt<br />
auf eine Anomalie in <strong>der</strong> Organisation des Gehirns und des damit einhergehenden Funktionsausfalls.<br />
Referiert wird auf das Fehlen einer Struktur, die offenbar nötig ist, um eine bestimmte<br />
Leistung zu garantieren.<br />
Die hier zur Debatte stehende Aufgabe hat demnach die folgende Form:<br />
(A3) Gegeben seien hinreichend ähnliche Systeme S und S* sowie <strong>der</strong>en Mikrostrukturen<br />
MS(S) und MS(S*). Systeme des Typs S haben die höherstufige Eigenschaft E, Systeme<br />
des Typs S* haben sie nicht. Erkläre unter Berücksichtigung von MS(S) und<br />
MS(S*), warum S* E nicht hat!<br />
Erklärungen dieses Typs sind Legion im Bereich <strong>der</strong> medizinisch angeregten Hirnforschung.<br />
Jede Läsion, die mit einer bestimmten Ausfallerscheinung verbunden ist, steuert ein Mosaiksteinchen<br />
bei zu <strong>der</strong> Suche nach den zuständigen Gehirn-Arealen. Und dennoch handelt es<br />
sich bei Erklärungen dieses Typs nicht um reduktive Erklärungen im strikten Sinne: Denn aus<br />
dem bloßen Verweis auf Gehirnareale, <strong>der</strong>en Läsion zum Verlust höherstufiger Eigenschaften<br />
führt, geht nicht hervor, wie diese Areale, wenn sie intakt sind, zur Instantiierung jener Eigenschaften<br />
beitragen. Interaktionsgesetze und Kompositionsgesetze finden hier keine Anwendung.<br />
(2) Häufig wird mit dem Verstehen eines Systems auch assoziiert, daß man gezielt bestimmte<br />
Effekte auslösen kann. Auch hier kann die mo<strong>der</strong>ne Neuroforschung mit Ergebnissen aufwarten:<br />
Stimuliert man einen bestimmten Teil <strong>der</strong> Amygdala, so kommt es zu typischen Angstreaktionen:<br />
ein Gefühl <strong>der</strong> Panik, das mit einem Fluchtreflex kombiniert ist; stimuliert man einen<br />
an<strong>der</strong>en Teil, so berichten Versuchspersonen von einem „warmen, schwebenden Gefühl“<br />
und verhalten sich ausgesprochen freundlich – sie sind beschwichtigt. Aktivitäten in einer<br />
dritten Region <strong>der</strong> Amygdala führen zu Wutausbrüchen (vgl. Carter 1999, 90).<br />
Hier nun ist es offenbar gelungen, Einblick in bestimmte Auslösemechanismen zu erhalten<br />
und diese auch zu bedienen. Die entsprechende Aufgabe würde folglich lauten:<br />
(A4) Gegeben sei System S mit <strong>der</strong> Mikrostruktur MS(S). Verän<strong>der</strong>e MS(S) so, daß S die<br />
höherstufige Eigenschaft E instantiiert.<br />
Doch damit, d. h. mit dem Wissen, wie man bestimmte phänomenale Zustände auslöst, ist<br />
natürlich noch kein Wissen verbunden, was diese phänomenalen Zustände genau zu denen<br />
macht, die sie sind. Die Fähigkeit des Manipulierens impliziert nicht das Zur-Verfügung-<br />
Haben reduktiver Erklärungen. Wir können sehr viele technische Geräte bedienen, ohne zu<br />
wissen, warum und wie sie funktionieren.<br />
(3) Betrachten wir abschließend noch die Möglichkeit, komplexe Emotionen zu analysieren,<br />
z. B. einen Zustand, in dem sich Freude, Schuldgefühle, Zuneigung und Gereiztheit mischen.<br />
Wir haben dafür – so weit ich weiß – kein eigenes Wort, und doch dürften Sie leicht in <strong>der</strong><br />
Lage sein, das Vorkommen dieser Gefühlslage nachzuempfinden. Stellen Sie sich vor, Sie<br />
erhalten einen Geburtstagsgruß von einem Freund, dessen Geburtstag Sie ignoriert hatten. Sie<br />
freuen sich über die Aufmerksamkeit, die Ihnen entgegengebracht wird, Ihr altes Gefühl <strong>der</strong><br />
Zuneigung wird geweckt, erinnern sich dabei aber zugleich daran, daß Sie beschlossen hatten,<br />
5
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> <strong>der</strong> Kognitionswissenschaft. Vorlesung 4. Reduktive Erklärung<br />
wegen Ihrer hohen Arbeitsbelastung, mit <strong>der</strong> Gereiztheit verbunden war und ist, den Geburtstag<br />
des Freundes einfach zu übergehen, und so haben Sie auch noch Schuldgefühle (vgl.<br />
Carter S. 83).<br />
Obwohl diese Analyse ganz überzeugend klingen mag, findet hier keine reduktive Erklärung<br />
statt, son<strong>der</strong>n es wird nur eine funktionale Einbettung angeboten, die einigermaßen<br />
verläßlich zur entsprechenden Emotion führen könnte. Die Erklärung, warum das Mischgefühl<br />
FSZG aufgetreten ist, berücksichtigt lediglich an<strong>der</strong>e höherstufige Eigenschaften – Gefühle,<br />
die selbst erklärungsbedürftig bleiben.<br />
(A5) Gegeben sei System S, dessen höherstufige Eigenschaften E und Gi. Erkläre unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> Gi warum S auch E hat!<br />
Gegenstand, Gegensatzklasse und explanatorische Relevanz<br />
Um einen besseren Zugang zu dem zu haben, was das philosophische Problem <strong>der</strong> phänomenalen<br />
Qualitäten ausmacht, greife ich im folgenden eine Unterscheidung auf, die von Bas van<br />
Fraassen stammt und im Rahmen seines pragmatischen Modells wissenschaftlicher Erklärung<br />
entwickelt wurde.<br />
EXKURS: Vorbehalte gegenüber dem HO-Schema <strong>der</strong> wissenschaftlichen Erklärung<br />
• nicht umfassend genug:<br />
es gibt Betrachtungen, die wir als wissenschaftliche Erklärungen akzeptieren würden,<br />
aber nicht vom HO-Schema erfaßt werden;<br />
Beispiel: Eine Patientin erkrankt an progressiver Paralyse. Auf die Frage, wie dieses<br />
tragische Ereignis zu erklären ist, antwortet ihr Arzt: „Weil sie an unbehandelter Syphilis<br />
litt, und nur wer an unbehandelter latenter Syphilis leidet, erkrankt an progressiver<br />
Paralyse.<br />
Bei dieser Erklärung wird das Explanandum – daß eine bestimmte Frau an progressiver<br />
Paralyse erkrankt – durch Berufung auf die Tatsache erklärt, daß sie an unbehandelter<br />
Syphilis litt. Doch nur sehr wenige Personen, die an unbehandelter latenter Syphilis<br />
leiden, erkranken je an progressiver Paralyse, während je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> an progressiver<br />
Paralyse erkrankt, an unbehandelter Syphilis leidet. Daher kann das angemessene induktive<br />
Argument, das dieser Erklärung zugrunde liegt, kein richtiges Argument sein;<br />
seine Prämissen würden die Konklusion nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit stützen.<br />
• zu umfassend:<br />
das HO-Schema läßt Betrachtungen als Erklärungen gelten, die nicht als solche gelten<br />
sollten;<br />
Beispiel: Ein Außerirdischer, <strong>der</strong> mit unserer Kultur nicht vertraut ist, stellt fest, daß<br />
Hans Haflinger, ein gesun<strong>der</strong> Mann von 32 Jahren, noch nie schwanger geworden ist.<br />
Auf die Frage, warum es sich so verhält, erfährt E.T., daß Hans regelmäßig die Antibabypille<br />
nimmt und daß die Wahrscheinlichkeit, nicht schwanger zu werden sehr<br />
hoch für diejenigen ist, die regelmäßig die Antibabypille nehmen:<br />
(1) Wer regelmäßig die Antibabypille nimmt, wird in <strong>der</strong> Regel nicht schwanger.<br />
(2) Hans Haflinger nimmt regelmäßig die Antibabypille.<br />
(3) Also: Hans Haflinger ist bisher nicht schwanger geworden.<br />
6
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> <strong>der</strong> Kognitionswissenschaft. Vorlesung 4. Reduktive Erklärung<br />
Dies ist zwar ein richtiges induktives Argument, das ein stochastisches Gesetz enthält,<br />
doch eine Erklärung dafür, daß Hans nicht schwanger wird, ist es wohl nicht. Das Problem<br />
ist, daß die genannten Informationen allen Behauptungen <strong>der</strong> klassischen Theorie<br />
zum Trotz keine wissenschaftliche Erklärung abgeben, weil diese Informationen<br />
irrelevant sind für Hans’ Schwangerschaftsunfähigkeit.<br />
In The Scientific Image skizziert van Fraassen eine Theorie <strong>der</strong> Warum-Fragen. Geht<br />
man – wie er – davon aus, daß Erklärungen in <strong>der</strong> Regel Antworten auf Warum-Fragen sind<br />
(vgl. 1980, 134), so ist entscheidend, welche Antworten von spezifischen Warum-Fragen eingefor<strong>der</strong>t<br />
werden. Im Beson<strong>der</strong>en sind dabei die folgenden Faktoren bestimmend:<br />
• <strong>der</strong> Gegenstand <strong>der</strong> Frage (the topic of the question)<br />
• die Gegensatzklasse (the contrast class), d. h., die Menge von alternativen Antworten,<br />
die die Frage haben könnte und die auszuschließen sind; sowie<br />
• die explanatorische Relevanz (explanatory relevance), die die Hinsicht betrifft, in <strong>der</strong><br />
eine Antwort gefor<strong>der</strong>t wird (vgl. 1980, 141-142).<br />
Insbeson<strong>der</strong>e das, was als explanatorisch relevant gilt, kann dabei von Kontext zu Kontext<br />
differieren:<br />
In a given context, several questions agreeing in topic but differing in contrast-class, or<br />
conversely, may conceivably differ further in what counts as explanatorily relevant. Hence<br />
we cannot properly ask what is relevant to this topic, or what is relevant to this contrastclass.<br />
Instead, we must say of a given proposition that it is or is not relevant (in this context)<br />
to the topic with respect to that contrast-class. (ib., 142)<br />
Van Fraassens Einteilung eignet sich in hervorragen<strong>der</strong> Weise auch zum Vergleich <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Lösungsvorschläge, die <strong>der</strong>zeit auf dem Qualia-Markt angeboten werden. Betrachten<br />
wir dazu noch einmal die Frage nach einer reduktiven Erklärung in Bezug auf<br />
phänomenale Eigenschaften:<br />
Der Gegenstand <strong>der</strong> Frage ist die (höherstufige) phänomenale Eigenschaft (o<strong>der</strong> das Makroverhalten)<br />
des Systems: Warum hat Person P angesichts <strong>der</strong> gerade in ihr ablaufenden physiologischen<br />
Vorgänge die phänomenale Eigenschaft E – z. B. das Geschmackserlebnis einer<br />
reifen Ananas?<br />
Die Gegensatzklasse besteht aus den möglichen Alternativen: Warum hat P zu dieser Zeit<br />
nicht die phänomenale Eigenschaft E* – z. B. das Geruchserlebnis einer lange nicht geleerten<br />
Bio-Tonne? O<strong>der</strong>: Warum ist P zu dieser Zeit nicht ohne jegliches phänomenale Erlebnis?<br />
Von explanatorischer Relevanz sind in diesem Fall allein reduktive Erklärungen. Diese sind<br />
gefor<strong>der</strong>t. So sollte die Antwort natürlich nicht lauten: P hat das Geschmackserlebnis einer<br />
reifen Ananas, weil er gerade in eine reife Ananas gebissen hat. Dies wäre keine reduktive<br />
Erklärung! Gefragt ist vielmehr nach einer Antwort auf die Frage, warum das spezifische<br />
Feuern <strong>der</strong> Neurone und Ausschütten von Neurotransmittern usw., das durch einen Biß in eine<br />
reife Ananas in unserem Gehirn vonstatten geht, gerade so und nicht an<strong>der</strong>s erlebt wird. Und<br />
die Antwort sollte sich auf die neurophysiologischen Vorgänge beziehen. Das ist die Aufgabe.<br />
7
<strong>Wissenschaftsphilosophie</strong> <strong>der</strong> Kognitionswissenschaft. Vorlesung 4. Reduktive Erklärung<br />
Interfield Theories<br />
Eine <strong>der</strong> Alternativen zum Reduktionsmodell wissenschaftlicher Theorien a la Nagel ist Darden<br />
und Maulls Konzeption von Interfield Theories. „Interfield theories do not attempt to <strong>der</strong>ive<br />
one theory from another but rather seek to identify relationships between phenomena<br />
studied by two [or more] different fields of inquiry“ (Bechtel 1988, 97).<br />
Darden und Maull bestimmen ein „field“ als<br />
Literatur<br />
an area of science consisting of the following elements: a central problem, a domain<br />
consisting of items taken to be facts related to that problem, general explanatory factors<br />
and goals providing expectations as to how the problem is to be solved, techniques and<br />
methods, and, sometimes, but not always, concepts, laws, and theories which are related<br />
to the problem and which attempt to realize the explanatory goals“ (1977, 44).<br />
Bechtel, William (1988) Philosophy of <strong>Science</strong>. An Overview for <strong>Cognitive</strong> <strong>Science</strong>. Hillsdale,<br />
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.<br />
Beckermann, Ansgar (2002) Die reduktive Erklärbarkeit phänomenalen Bewußtseins – C.D.<br />
Broad zur Erklärungslücke, in: Michael Pauen/Achim Stephan (Hg.), Phänomenales<br />
Bewußtsein – Rückkehr zur Identitätstheorie? Pa<strong>der</strong>born, 122-147.<br />
Carter, Rita (1999) Atlas Gehirn. Entdeckungsreisen durch unser Unterbewußtsein, München.<br />
Darden, L. und N. Maull (1977) Interfield Theories. Philosophy of <strong>Science</strong> 43, 44-64.<br />
Feigl, Herbert (1958) The “Mental” and the “Physical”. The Essay and a Postscript, Minneapolis<br />
1967.<br />
Fraassen, Bas van (1980) The Scientific Image, Oxford 1980.<br />
Kim, Jaegwon (2002) Emergenz, Reduktionsmodelle und das Mentale, in: Michael Pauen/Achim<br />
Stephan (Hg.), Phänomenales Bewußtsein – Rückkehr zur Identitätstheorie?<br />
Pa<strong>der</strong>born, 148-164.<br />
8