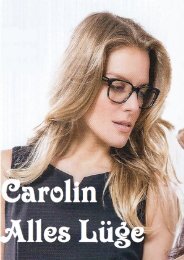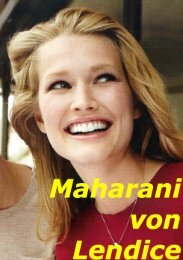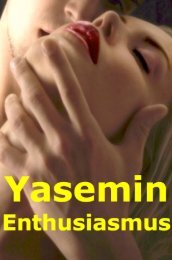Mica - Obsession
Ich habe noch nie erlebt, wie man empfindet, wenn ein für verschollen Gehaltener plötzlich wieder auftaucht, aber viel intensiver kann es auch nicht sein, wie das, was ich empfand, als ich Joscha in der Uni begegnete. Er war auch zu Hause geblieben. Nein, gut gehe es ihm nicht. Er habe sehr unter unserer Trennung zu leiden, erklärte Joscha. Wir sprachen nicht viel, wollten uns nur intensivste Liebkosungen und Zärtlichkeiten zukommen lassen, wie sie möglich sind, wenn man sich im Foyer gegenüber steht. In der anschließenden Vorlesung konnte ich mich nicht konzentrieren. Ein Euphemismus. Ich konnte die Stimme der Professorin nicht ertragen, die meine Ohren quälte. Am liebsten wäre ich nach unten gerannt, hätte ihr das Mikro abgeschaltet und sie verdroschen. Kein Wort verstand ich, hörte nur das schnarrende Geräusch der Dozierenden, das mir enorm auf die Nerven ging. Jedes Wort von jedem hätte ich jetzt als Belästigung empfunden. Es hatte keinen Sinn, ich musste da raus und fuhr nach Hause. Warf mich aufs Bett, trommelte auf die unschuldigen Kissen und schrie einfach. Meine Mutter, die reinkam, herrschte ich an: „Lass mich in Ruh.“ Das hatte sie von mir noch nie gehört. Mein Liebster muss leiden. Eine unerträgliche Vorstellung. Als ob mir jemand ätzende Flüssigkeit in offene Wunden gösse, so schmerzte es. Ich litt, schrie und weinte für Joschas Qualen. Woran ich sonst noch dachte, und was mir durch den Kopf lief, weiß ich nicht mehr genau, ein Tobsuchtsanfall meiner Seele, als ob sich alles in mir verkrampfte. Irgendwann muss ich wohl vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Als ich am Nachmittag wach wurde, kam ich mir geläutert vor, wie erwacht aus einem Koma ähnlichen Niemandsland. Jetzt konnte ich auch wieder mit Mutter sprechen. Wir waren beide ratlos. Als ich Joscha einige Tage später wieder traf, lief es fast identisch ab. Ich versuchte mich immer in der Gewalt zu behalten, redete mir etwas ein, aber es blieb ohne Konsequenzen. „Mica, das geht doch nicht. Wir werden dich irgendwann in der Psychiatrie besuchen müssen.“ bewertete meine Mutter ängstlich mein Verhalten. Nein, zum Psychotherapeuten wollte ich trotzdem nicht. „Ich kann es nur nicht ertragen, Joscha zu treffen. Sonst ist doch alles o. k.. Wir müssen uns nur aus dem Wege gehen, dürfen uns nicht sehen.
Ich habe noch nie erlebt, wie man empfindet, wenn ein für verschollen Gehaltener plötzlich wieder auftaucht, aber viel intensiver kann es auch nicht sein, wie das, was ich empfand, als ich Joscha in der Uni begegnete. Er war auch zu Hause geblieben. Nein, gut gehe es ihm nicht. Er habe sehr unter unserer Trennung zu leiden, erklärte Joscha. Wir sprachen nicht viel, wollten uns nur intensivste Liebkosungen und Zärtlichkeiten zukommen lassen, wie sie möglich sind, wenn man sich im Foyer gegenüber steht. In der anschließenden Vorlesung konnte ich mich nicht konzentrieren. Ein Euphemismus. Ich konnte die Stimme der Professorin nicht ertragen, die meine Ohren quälte. Am liebsten wäre ich nach unten gerannt, hätte ihr das Mikro abgeschaltet und sie verdroschen. Kein Wort verstand ich, hörte nur das schnarrende Geräusch der Dozierenden, das mir enorm auf die Nerven ging. Jedes Wort von jedem hätte ich jetzt als Belästigung empfunden. Es hatte keinen Sinn, ich musste da raus und fuhr nach Hause. Warf mich aufs Bett, trommelte auf die unschuldigen Kissen und schrie einfach. Meine Mutter, die reinkam, herrschte ich an: „Lass mich in Ruh.“ Das hatte sie von mir noch nie gehört. Mein Liebster muss leiden. Eine unerträgliche Vorstellung. Als ob mir jemand ätzende Flüssigkeit in offene Wunden gösse, so schmerzte es. Ich litt, schrie und weinte für Joschas Qualen. Woran ich sonst noch dachte, und was mir durch den Kopf lief, weiß ich nicht mehr genau, ein Tobsuchtsanfall meiner Seele, als ob sich alles in mir verkrampfte. Irgendwann muss ich wohl vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Als ich am Nachmittag wach wurde, kam ich mir geläutert vor, wie erwacht aus einem Koma ähnlichen Niemandsland. Jetzt konnte ich auch wieder mit Mutter sprechen. Wir waren beide ratlos. Als ich Joscha einige Tage später wieder traf, lief es fast identisch ab. Ich versuchte mich immer in der Gewalt zu behalten, redete mir etwas ein, aber es blieb ohne Konsequenzen. „Mica, das geht doch nicht. Wir werden dich irgendwann in der Psychiatrie besuchen müssen.“ bewertete meine Mutter ängstlich mein Verhalten. Nein, zum Psychotherapeuten wollte ich trotzdem nicht. „Ich kann es nur nicht ertragen, Joscha zu treffen. Sonst ist doch alles o. k.. Wir müssen uns nur aus dem Wege gehen, dürfen uns nicht sehen.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und träumte. Wie konnte ich, die ihr Glück gefunden hatte, es aufgeben? Wo<br />
wollte ich es denn sonst finden? In meinem banalen Alltag, den ich<br />
überwunden hatte, doch wohl kaum. Als Lehrerin für Spanisch und Französisch<br />
etwa? Die Welt hatte kein derartiges Glück zu bieten. Sie verteilte nur<br />
Anerkennung, Lob und Reputation für fleißiges Arbeiten. Dass Menschen Liebe<br />
und Zuneigung brauchen, interessiert niemanden. Darum muss sich jeder<br />
privat kümmern. Ganze Tage konnte ich vergrübeln, weinte zwischendurch<br />
mal, versuchte mir vorzustellen, was Joscha jetzt wohl machte, einfach nur die<br />
Gedanken sich immer mit unseren gemeinsamen Tagen beschäftigen lassen.<br />
Das war ich, da lebte ich mich selbst. Es war nicht nur mein Glück, es war zu<br />
meiner Welt geworden, in der ich gelebt hatte und leben wollte. Dahinter<br />
konnte ich nicht mehr zurück. In der Zeit davor war ich nicht mehr zu Hause.<br />
An anderen Tagen ging es mir besser. Dann war meine Mutter eine große Hilfe<br />
für mich. Noch nie hatte ich es so bewusst wahrgenommen, was ihre Liebe mir<br />
bedeutet, sie umarmte mich, schützte mich, trug mich. Dann redeten wir viel<br />
über Joscha und mich, bis Mutter fast jede Sekunde unseres Zusammenseins<br />
kannte. „Im Grunde möchte ich so etwas auch schon mal gern erleben, aber<br />
wenn es konkret würde, hätte ich, glaube ich, doch zuviel Angst davor. Das<br />
müssen ja richtig ekstatische Zustände gewesen sein, und dabei ist man sich<br />
doch nicht sicher, was man da alles anstellen kann.“ erklärte sie. Einiges gefiel<br />
ihr ausgesprochen gut, sie wollte es in ihren Alltag integrieren, zum Beispiel<br />
die freudige Begrüßung bei der Rückkehr von der Mülltonne. „Na klar, was<br />
macht denn ein stärkeres Gefühl, als deinen Liebsten wiederzusehen, und so<br />
etwas registrierst du im Alltag gar nicht. Schlimm, nicht wahr?. Woher der<br />
Liebste dabei kommt, ist doch völlig irrelevant.“ kommentierte ich. Nur<br />
erledigte den Müll bei uns in der Regel mein Vater. Müll und Einkaufen war das<br />
einzige, was für ihn von der geplanten und vereinbarten gemeinsamen<br />
Bewältigung des Haushalts übrig geblieben war. Als er von der Mülltonne<br />
zurückkam, gab ich ihm einen Kuss und sagte dabei: „Danke, dass du den Müll<br />
rausgebracht hast.“ Mein Vater blieb wie angewurzelt stehen, machte große<br />
Augen, als ob er nichts mehr verstehe, lies seine Mimik dann aber zu einem<br />
wonnigen Lächeln hinübergleiten, als ob ein Engel ihm etwas zugeflüstert<br />
habe. Mutter lachte sich schief, und erklärte noch lachend, dass er sich daran<br />
gewöhnen müsse. Unsere Umgangsformen würden sich in zentralen Bereichen<br />
demnächst radikal ändern. Eine typisch Familie waren wir eigentlich gar nicht,<br />
eher eine Ansammlung von Typen mit völlig unterschiedlichen Interessen und<br />
Lebensweisen, die aber wie Yin und Yang exakt miteinander harmonierten. Für<br />
meinen Vater stellten seine Frau und ich das Leben dar. Das andere war die<br />
Fronarbeit, die er leisten musste, um dieses Leben genießen zu dürfen. Ich<br />
liebte ihn schon. Er sagte, in seinem Herzen würde die Sonne angeschaltet,<br />
wenn er mich sehe, und das ließ er mich deutlich spüren. Mit meiner Mutter<br />
stand es aber anders. Wir liebten uns nicht, jede war scharf auf die andere, wir<br />
hatten Lust aufeinander und suchten uns. Schon mal mussten wir erst ein paar<br />
Schritte miteinander tanzen, wenn wir uns in der Küche trafen. Sie beginne,<br />
sich sorgen zu machen, meinte sie, weil sich für sie überhaupt keine positive<br />
Entwicklung abzeichne. Die Tage, an denen ich nichts tun wollte, nichts tun<br />
konnte, nahmen eher zu als dass sich ihr Auftreten verringerte. Als direkt<br />
depressiv sah ich mich keinesfalls. So wie ich mich im Zusammensein mit<br />
<strong>Mica</strong> – <strong>Obsession</strong> – Seite 22 von 37