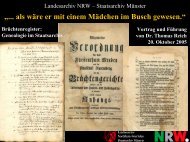ARCHIVAR 209 - Archive in Nordrhein-Westfalen
ARCHIVAR 209 - Archive in Nordrhein-Westfalen
ARCHIVAR 209 - Archive in Nordrhein-Westfalen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
NON-DISKURSIVITÄT ALS<br />
PRIMÄRFUNKTION DES<br />
ARCHIVS?<br />
ANSATZ ZU EINER AUSEINANDER -<br />
SETZUNG MIT WOLFGANG ERNSTS<br />
MEDIEN ÄSTHETISCHEM ARCHIV -<br />
BEGRIFF 1<br />
Die Studie von Wolfgang Ernst, erschienen 2003 als erweiterte<br />
Form e<strong>in</strong>er 1998 an der Philosophischen Fakultät der Humboldt-<br />
Universität zu Berl<strong>in</strong> als Habilitationsschrift angenommenen<br />
Abhandlung, unternimmt es, die Kehrseite der Fabrikation von<br />
Vergangenheit zu untersuchen, e<strong>in</strong>es Prozesses also, welcher der<br />
öffentlichen E<strong>in</strong>sicht zumeist verborgen bleibt. Es geht um die<br />
gedächtnismediale Herstellung von Daten als Wissen über Vergangenheit,<br />
um das materielle und technische Dispositiv von<br />
Geschichte als Wertung und Deutung (und zwar für den Zeitraum<br />
von 1806 bis an die Grenzen zur mechanischen Datenverarbeitung<br />
von Vergangenheit). Ernst behandelt die konkrete Operativität<br />
von <strong>Archive</strong>n, Bibliotheken und Museen sowie nondiskursive<br />
Editions- und Hilfswissenschaften (Diplomatik,<br />
Annalistik, Statistik) als Aufzeichnungssysteme nationaler Zeit -<br />
räume. Hierbei gelangt er zu der These, auf ihrer technischen<br />
Ebene hätten <strong>in</strong>sbesondere <strong>Archive</strong> sich nicht vom NS-Regime<br />
verleiten lassen, ansonsten ließen sich die Namen der Opfer und<br />
ihr Schicksal nicht <strong>in</strong> der Weise aufarbeiten, wie dies nach 1945<br />
möglich geworden sei. Das Wesen des Sammelns und Speicherns,<br />
so wird <strong>in</strong>duziert, sei wertfrei oder doch wertungsneutral. Diese<br />
These, aufregend genug, wird allerd<strong>in</strong>gs erkauft, <strong>in</strong>dem – versteht<br />
man die medientheoretisch durchgeformte, zum Teil sehr jargonhaft<br />
geschriebene Arbeit recht – die erste Silbe im dritten Term<strong>in</strong>us<br />
ihres Untertitels gestrichen wird: ums Erzählen und Vermitteln<br />
geht es hier nicht mehr. Dah<strong>in</strong>ter verbirgt sich die Absicht<br />
e<strong>in</strong>es grundstürzenden Paradigmenwechsels: fort von dem letzt -<br />
lich immer noch gültigen und trotz e<strong>in</strong>iger Verstellung durch die<br />
gesellschaftliche Praxis auch noch geübten Pr<strong>in</strong>zip des sokratischen<br />
Dialege<strong>in</strong>. Da Ernst se<strong>in</strong>e These <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Beziehungsgeflechts<br />
von Kultur- und Literaturtheorie entwickelt, soll<br />
auch <strong>in</strong> diesem Rahmen zu e<strong>in</strong>er Erwiderung angesetzt werden.<br />
Zunächst ist festzustellen, dass das Buch es dem Leser nicht<br />
leicht macht, obschon es gerade dies <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten Weise<br />
zu beabsichtigen vorgibt. Die der Studie vorangestellte Leseanweisung<br />
gibt ausdrücklich das Ziel vor, sich dem historischen<br />
Diskurs zu verweigern und eben damit nicht dem fragwürdigen<br />
phatischen Modell von Historie sich auszuliefern, das immer<br />
e<strong>in</strong>en Beobachterstandpunkt, e<strong>in</strong>e Referenz außerhalb des archivischen<br />
Apparats voraussetze. Für die Darstellungsweise des<br />
153<br />
Buches bedeutet das den Verzicht auf e<strong>in</strong>en roten Faden zugunsten<br />
der Synchronie thematischer Module; der Leser könne somit<br />
an jeder beliebigen Stelle e<strong>in</strong>setzen. Was bisweilen aussähe wie<br />
Unfähigkeit, die komplexe und disparate Materie durch Darstellung<br />
<strong>in</strong> den Griff zu bekommen, sei vielmehr Ausdruck der<br />
Weige rung, aus Bibliotheken und <strong>Archive</strong>n destillierte Datensätze<br />
zu e<strong>in</strong>em homogenen Ganzen zusammen zu zw<strong>in</strong>gen. Diese<br />
Methodik schlägt sich u. a. nieder <strong>in</strong> der Verunklarung e<strong>in</strong>geführter<br />
Begriffe bzw. der Stellung des Verfassers zu ihnen. So werden<br />
beispielsweise die Term<strong>in</strong>i „Fund“ und „Ausgrabung“ oder<br />
„Kulturemphase“ und „Pragmatismus“ als gegenteilige Pr<strong>in</strong>zipien<br />
e<strong>in</strong>ander gegenübergestellt, ohne dass immer ganz klar würde,<br />
welches Pr<strong>in</strong>zip der favorisierten Auffassung des Autors entspricht.<br />
Auch <strong>in</strong> ihrer Bezugnahme auf Archivwissenschaftliches<br />
verwickelt sich die Darstellung <strong>in</strong> Widersprüche.<br />
Dar<strong>in</strong> besteht jedoch die große Schwierigkeit e<strong>in</strong>er Rezeption des<br />
Buches: Der Anspruch auf das bewusst herbeigeführte Scheitern<br />
e<strong>in</strong>er hermeneutisch-kontrollierenden Interpretation der Befunde<br />
und die Inkaufnahme des fortwährenden Zusammenbruchs<br />
narrativer Kohärenz weisen ja e<strong>in</strong>e argumentativ-l<strong>in</strong>ear vorgehende<br />
Befassung mit dem Werk (wenn von e<strong>in</strong>em solchen überhaupt<br />
noch zu sprechen ist) von Beg<strong>in</strong>n an zurück. Am stimmigsten<br />
wäre aus Sicht des Autors (und kann denn auch von ihm noch<br />
gesprochen werden?) wohl, man wiese statt e<strong>in</strong>er kohärenten<br />
Rezension e<strong>in</strong>en Zettelkasten se<strong>in</strong>er Lesee<strong>in</strong>drücke vor, womöglich<br />
ergänzt durch e<strong>in</strong> mit Anstreichungen und Anmerkungen<br />
versehenes Exemplar des Buches als e<strong>in</strong>e Art Hypertext. Dennoch<br />
soll an dieser Stelle e<strong>in</strong>e andere Zugangsweise gefunden werden –<br />
nicht zuletzt um auf die eigentümliche Stärke und Bedeutung des<br />
Buches aufmerksam zu machen.<br />
Bezüglich der Ernstschen Hauptthese ist zunächst festzuhalten,<br />
dass das angeblich ideologieunanfällige Sammeln, Ordnen und<br />
Speichern jeglicher Form von Ideologie stets ihren Nährboden<br />
geboten hat. Ernst sche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> diesem Zusammenhang zu bedenken<br />
zu geben, dass wir <strong>in</strong> kultureller H<strong>in</strong>sicht und im Bezug auf<br />
Vergangenheit und Gegenwart lieber re<strong>in</strong> <strong>in</strong>formationstechnologisch<br />
uns verhalten sollten anstatt im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er emphatisch<br />
verstandenen Historie und e<strong>in</strong>er fortwährenden wertungsbefangenen<br />
Geschichtsaufarbeitung.<br />
1 Wolfgang Ernst: Im Namen von Geschichte. Sammeln - Speichern - Er/zählen.<br />
Infrastrukturelle Konfigurationen des deutschen Gedächtnisses, München:<br />
Wilhelm F<strong>in</strong>k 2003 (1140 Seiten).<br />
<strong>ARCHIVAR</strong> 62. Jahrgang Heft 02 Mai 2009