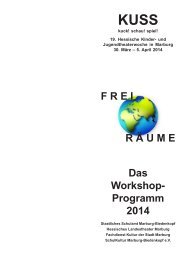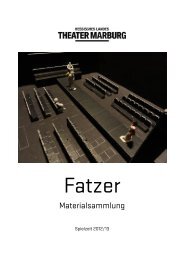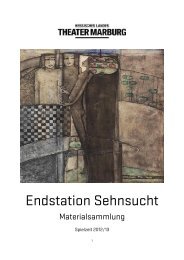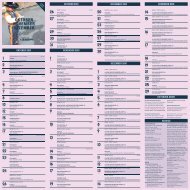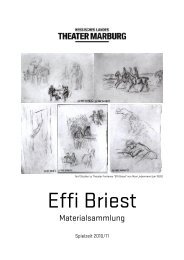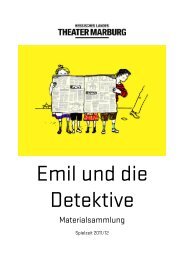Gut. - Hessisches Landestheater Marburg
Gut. - Hessisches Landestheater Marburg
Gut. - Hessisches Landestheater Marburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der gute Mensch von Sezuan<br />
von Bertolt Brecht (1898–1956)<br />
Premiere: 09. September 2011, Bühne<br />
Regie: Stephan Suschke<br />
Der Mensch ist nicht nur Opfer der Verhältnisse,<br />
gilt <strong>Gut</strong>sein als peinlich, so von vorgestern wie die Verteidigung ei-<br />
sondern bestimmt diese auch<br />
ner aufgeklärten Moral und die Hoffnung auf eine bessere Welt. Da<br />
von Stephan Suschke<br />
darf uns die popkulturelle Konjunktur der Globalisierungskritik nicht<br />
täuschen. Dass der »<strong>Gut</strong>mensch«, aus der politischen Rhetorik<br />
Brechts Stücke, die in den Jahren der Prosperität und des scheinbar stammend, sich in der Alltagssprache niedergelassen hat, kann als<br />
sicheren Wohlstandes für den größten Teil der deutschen Bevölke- Triumph antihumanistischen Denkens gelten. Die Häme über den<br />
rung veraltet schienen, bekommen durch die gesellschaftlichen Ent- guten Menschen beginnt bei Nietzsche, der Neologismus stammt<br />
wicklungen der letzten Jahre eine überraschende Aktualität. Dazu aus dem Stürmer, Kampfbegriff ist er für die Neue Rechte, und<br />
gehört auch das 1938 in Dänemark begonnene,<br />
salonfähig wurde er durch die 68er-Kritik im<br />
1940 in Schweden beendete Stück »Der gute<br />
Stil von Klaus Bittermanns »Wörterbuch des<br />
Mensch von Sezuan«.<br />
<strong>Gut</strong>menschen«. Die Verachtung, die das Wort<br />
Brecht selbst versieht das Parabelstück mit<br />
ausdrückt, und die Geläufigkeit, mit der es ver-<br />
der Bemerkung: Die Provinz Sezuan der Fabel, die<br />
wendet wird, legen den Verdacht nahe: Als gut<br />
für alle Orte stand, an denen Menschen von Men-<br />
gilt jetzt ungut.<br />
schen ausgebeutet werden, gehört heute nicht mehr<br />
Tatsächlich ist der <strong>Gut</strong>mensch, von dem wieder<br />
zu diesen Orten. Abgesehen davon, dass sich<br />
mit kuriosem Eifer gesprochen wird, heute ent-<br />
auch das mittlerweile verändert hat, bleibt<br />
weder längst ausgestorben, oder er versteckt<br />
Brechts Grundfrage aktuell: Wie ist es möglich, in einer Gesellschaft, sich verdammt gut. Der mit Furore Verfolgte pflanzte einst Bäume<br />
die an niedrigste Instinkte appelliert, gut zu sein? Die Hure Shen Te gegen das Waldsterben. Der Verkehr in den Großstädten war ihm ein<br />
kommt durch göttliche Fügung und einfache menschliche Güte zu Zeichen von Kinderfeindlichkeit, der Schwule Opfer von Zwangshe-<br />
einem kleinen Vermögen. Ihre schnell stadtbekannt werdende Güte terosexualität, der Ausländer ein Opfer von Fremdenfeindlichkeit.<br />
wird ausgenutzt, der kleine Tabakladen füllt sich mit Glücksrittern, Die Kritik war dem <strong>Gut</strong>menschen ein Fetisch. Er verharrte in einem<br />
Schmarotzern und den netten Ausbeutern von nebenan. Um zu schlecht gelaunten Gestus des Entlarvens: Noch der großzügigste<br />
überleben, erfindet sie die Figur ihres Vetters Shui Ta. Fortan ver- Sozialstaat trug den Makel repressiver Toleranz in sich und vernebelsucht<br />
Shen Te durch diese Spaltung ihre menschlichen Qualitäten te die staatsmonopolistische Herrschaft.<br />
zu retten, indem sie die finsteren Entscheidungen ihrem Vetter Shui Dann kamen die neunziger Jahre. Er mache sich über die Welt Illusi-<br />
Ta überlässt. Die Schwierigkeit des <strong>Gut</strong>-Seins in einer Gesellschaft, onen, wurde dem <strong>Gut</strong>menschen damals unterstellt. Gleichzeitig hieß<br />
die nicht gut ist, wird in kräftigen, gut gebauten Szenen gezeigt, die es, er sei selbstgerecht. Mit seiner unterwürfigen Freundlichkeit dem<br />
manchmal tragikomisch sind.<br />
türkischen Gemüsehändler gegenüber und seiner Solidarität mit den<br />
Dabei wird deutlich, dass selbst die untersten Schichten den aus- Entwicklungsländern würde er nicht die Welt verändern, sondern nur<br />
beuterischen Grundmechanismus der Gesellschaft bedienen. In der noch seine Nachbarn geißeln.<br />
scheiternden Liebesgeschichte zwischen Shen Te und dem Flieger Als <strong>Gut</strong>mensch gilt heute bereits, wer eine differenzierte statt pola-<br />
Sun wird sichtbar, dass die Menschen nicht nur Opfer der Verhältnisrisierende Integrationsdebatte fordert, wer Neugier für die Migranten<br />
se sind, sondern diese auch bestimmen.<br />
und ein Restgefühl an Nächstenliebe aufbringt. Als <strong>Gut</strong>mensch gilt<br />
Der Plot und die Figuren sind großartig. In der <strong>Marburg</strong>er Inszenie- heute, wer kein Islamkritiker ist. Es entbehrt nicht einer gewissen<br />
rung soll die Geschichte in das Zentrum gerückt und die ideologi- Ironie, dass die Islamkritiker damit durchaus erfolgreich die Strateschen<br />
Schlussfolgerungen den Zuschauern überlassen werden. gie des traditionellen <strong>Gut</strong>menschentums kapern: Der realpolitisch<br />
Handelnde oder auch nur Unverbitterte hat ihrer Ansicht nach schon<br />
Der <strong>Gut</strong>mensch<br />
immer unrecht. Aber derlei hält nicht ewig. Im Gegenteil. Auch unter<br />
von Adam Soboczynski<br />
Warum ist der »<strong>Gut</strong>mensch« eigentlich ein Schimpfwort? Zu Zeiten<br />
dem Stichwort Islamkritik dürfte man wohl bald konstatieren: Wurde<br />
in den nuller Jahren überstrapaziert. Hat sich inzwischen erholt.<br />
Goethes, als noch Maximen Mode waren wie Edel sei der Mensch, hilfreich<br />
und gut, hätte man das Wort als Tautologie empfunden. Heute<br />
nach: Cicero Nr. 12, Dezember 2010<br />
12<br />
Don Karlos<br />
von Friedrich Schiller (1759–1805)<br />
Premiere: 10. September 2011, Stadthalle – Erwin-Piscator-Haus<br />
Regie: Roscha A. Säidow<br />
Am Hof des spanischen Königs Philipp II. herrscht Friedhofsruhe. Um<br />
ihn herum webt sich ein Netz von Intrigen und Liebesgeschichten:<br />
Marquis Posa versucht, den Kronprinzen Karlos für die Befreiung der<br />
Niederlande zu gewinnen. Karlos liebt seine Stiefmutter Elisabeth.<br />
Gräfin Eboli liebt ihrerseits Karlos, wird von ihm jedoch zurückgewiesen.<br />
Aus Rache berichtet sie dem Vater von den quasi-inzestuösen<br />
Gefühlen des Sohnes. Voller Wut beschließt der König, Frau und<br />
Sohn umzubringen.<br />
Schiller, Posa, Zhào Jìng<br />
von Alexander Leiffheidt<br />
Militärische Pflanzschule – kein gartenbauliches Institut,<br />
sondern eine Zuchtanstalt für die zukünftigen<br />
Führungseliten des Herzogs Karl Eugen von Württemberg.<br />
Wecken um 5 Uhr, Frühappell, Händefalten zum<br />
Gebet. Auf Kommando.<br />
Dass Foucault über Bentham geschrieben hat und<br />
nicht über dieses Panoptikum, ist erstaunlich: in der »Hohen Karlsschule«,<br />
wie sie bald nach ihrer Gründung genannt wurde, präsentiert<br />
sich die Entfaltung der Disziplinargesellschaft an der Schwelle<br />
zum 19. Jahrhundert in unverstellter Form. Jede Tür hat ein Guckloch:<br />
das Auge des allerhöchsten Vaters, allgegenwärtig.<br />
Mit 14 Jahren wird Friedrich Schiller eingezogen in die Eliteakademie,<br />
mit 21 entlassen. Dem Disziplinierungsregime des Herzogs ist er damit<br />
noch lange nicht entkommen. Erst nach der Flucht ins thüringische<br />
›Ausland‹ beginnt, drei Jahre später, die Arbeit an »Don Karlos,<br />
Infant von Spanien«.<br />
[Ich will] es mir in diesem Drama zur Pflicht machen, in Darstellung der Inquisition,<br />
die prostituirte Menschheit zu rächen, und ihre Schandfleken fürchterlich<br />
an den Pranger zu stellen, schreibt Schiller 1783. Zur Uraufführung 1787<br />
streicht er allerdings von sich aus alle Stellen an, die der Zensur willen<br />
weggelassen werden können. Höflich fragt er seinen Intendanten,<br />
ob er sich im Punkte des Catholicismus, der Geistlichkeit und der Inquisition<br />
einige Freiheiten erlauben dürfe. Die Antwort des Theatermachers:<br />
nein. Die Disziplinierungen machen nicht halt an den Mauern der<br />
Karlsschule: keine Gedankenfreiheit, nirgends.<br />
Gedankenfreiheit – Posas Forderung an Philipp, Schillers Schulterschluss<br />
zu den Aufklärern. Wage, für dich selbst zu denken, fordert<br />
Captain Boldmind 1764 in Voltaires »Dictionnaire«. Was soll uns<br />
heute noch eine solche Forderung? Als Möglichkeit, sich des eigenen<br />
Verstandes ohne Einflussnahme anderer zu bedienen, ist Gedankenfreiheit<br />
ein Rechtsprinzip bürgerlicher Selbstbestimmung. In<br />
unsere säkularen Hirne äugt aber längst kein Großinquisitor mehr,<br />
und für alles andere garantiert, so sollte man meinen, Artikel 18 der<br />
Menschenrechte. Schillers berühmte Zeile: Problem gelöst, Text gestrichen?<br />
Cäsar sagte: Ich kam, sah und siegte. Ich sage: Ich widersetze mich, ich breche<br />
durch, ich gewinne. So spricht ein anderer Experte in Sachen Machtmaschinen:<br />
Zhào Jìng, Blogger und kritischer Journalist aus China.<br />
Die Tage Chinas als Propagandastaat seien gezählt, vertraut Zhào<br />
den westlichen Medien an. Früher oder später wird er<br />
Recht behalten. Doch was genau bedeutet das?<br />
Glaubt man Zhào, so zeigt sich bereits seit Jahren<br />
in der Volksrepublik ein interessantes Phänomen: In<br />
demselben Maße, in dem die persönlichen Freiheiten<br />
wachsen, schrumpft das Interesse der Bevölkerung<br />
an politischer Freiheit. Nur sehr sonderbare Menschen<br />
kämpfen noch für politische Rechte. 95% ist die Zensur egal,<br />
berichtet Zhào. Wenn niemand mehr die Frage nach<br />
Gedankenfreiheit stellt, verschwinden auch die Zensoren.<br />
Nicht aber die Zensur: Aus ihr entwickelt sich<br />
eine dispersive Form gesellschaftlicher Kontrolle, die nirgends verortet<br />
und doch immer präsent ist.<br />
Seit den Tagen der »Hohen Karlsschule« haben sich in unseren Gesellschaften<br />
die Regimes der Disziplinierung bis zur Unsichtbarkeit<br />
und Allgegenwärtigkeit verfeinert. Der Entkörperlichung der Strafe<br />
entspricht die der Methoden der Disziplinierung und Überwachung.<br />
Es sind ja Ketzer, die man brennen sieht: Der am Tode des Delinquenten<br />
ausgerichteten Souveränitätsmacht und Staatsgewalt eines Philipp<br />
steht heute ein polyzentrisches Geflecht von Machtbeziehungen<br />
gegenüber, dessen Strukturen weniger auf Repression als auf Normisierung<br />
des Individuums, auf die Produktion eines kontrollierten,<br />
an- und eingepassten Normalbürgers abzielen.<br />
In diesem Sinne ist Posas Forderung nach Gedankenfreiheit alles andere<br />
als unproblematisch. Nicht, weil sie uns ohnehin schon sicher<br />
wäre, sondern weil auch wir sie allzu leicht mit unseren persönlichen<br />
Freiheiten verwechseln – weil zudem dieselben Strukturen, die sie<br />
uns rechtsstaatlich garantieren, zugleich zu Produktionsmechanismen<br />
einer ubiquitären Normalisierung und Kontrolle geworden<br />
sind. Every day is a school day: Die Regimes der Disziplinierung sind der<br />
Pflanzschule entkommen und uns zur Welt geworden.<br />
Schillers Familientragödie entfaltet sich in einem von Macht und<br />
Politik durchdrungenen Raum, in dem die Domänen von Individuum<br />
und Staat, öffentlicher und privater Disziplinierung sich überschneiden,<br />
ja gar deckungsgleich werden. Wir erkennen in der Karlsschulen-Welt<br />
die Spuren unserer eigenen. Und eine Frage, die auch Zhào<br />
stellen könnte: Wie geben wir uns Gedankenfreiheit?<br />
13