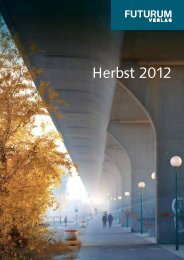Leseprobe - Rudolf Steiner Verlag
Leseprobe - Rudolf Steiner Verlag
Leseprobe - Rudolf Steiner Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
234
Repressalien und Verfolgung –<br />
Leidenszeit des Prager Judentums<br />
Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts begann sich die<br />
Lage der Judengemeinde allmählich wieder zu verschlech -<br />
tern. Zwar verlieh ihnen der verhältnismäßig tolerante<br />
und aufgeschlossene Kaiser Ferdinand III. 8 noch die in<br />
der Altneusynagoge aufbewahrte große Fahne mit Wappen<br />
für ihre Verdienste bei der Verteidigung der Altstadt<br />
gegen die Schweden sowie das Recht auf einen eigenen<br />
Markt (sogenannter Tandelmarkt), doch nahm unter seinem<br />
Nachfolger Leopold I. der Druck auf die Juden durch<br />
neue Ausweisungsverfügungen oder auch -drohungen<br />
zum Zwecke der Verhinderung neuer beziehungsweise<br />
Eindämmung bestehender jüdischer Siedlungen in Böhmen<br />
wieder zu. Außerdem versetzten die Pestepidemie<br />
1680 und der Großbrand von 1689, der fast das ganze<br />
Getto vernichtete, der jüdischen Gemeinde schwere<br />
Schläge. Diese hatte ohnehin schon unter den Drangsalierungen<br />
der missionseifrigen Jesuiten, denen jedes Mittel<br />
recht war, zu leiden. Die Beschuldigung eines Juden<br />
durch die Jesuiten, das Kruzifix auf der Karlsbrücke beleidigt<br />
zu haben (die offensichtlich derart fadenscheinig<br />
war, dass er «nur» mit einer hohen Geldstrafe davonkam;<br />
S. 140), und die Affäre um den Juden knaben Simon Abeles<br />
(S. 166) stellen in diesem Zusammenhang lediglich<br />
spektakuläre Höhepunkte dar.<br />
Damit nicht genug, wurde die Prager Judengemeinde<br />
auch von internen Auseinandersetzungen um die «falschen<br />
Messiasse» Sabbatai Zewi und Nehemia Chajon erschüttert.<br />
9 Zewi (1626–1676) trat zuerst in seiner Heimatstadt<br />
Smyrna (Izmir) vor den Glaubensgenossen als<br />
der erwartete Messias auf und konnte vor allem im Osten,<br />
aber auch in ganz Europa zahlreiche Anhänger gewinnen.<br />
Prag war sogar in gewissem Ausmaß eine Hochburg<br />
des «Sabbatianismus». Sabbatai Zewis Erfolg wurde<br />
Betraum der Altneu-Synagoge (linke Seite). Die rote<br />
Standarte über dem Bima, die neben dem Davidstern<br />
einen Schwedenhut aufweist, wurde der jüdischen Bevölkerung<br />
1648 von Ferdinand III. für ihre Verdienste bei der<br />
Verteidigung der Altstadt gegen die Schweden verliehen.<br />
R e p r e s s a l i e n u n d V e r f o l g u n g<br />
begünstigt durch die schrecklichen Pogrome in der Ukraine<br />
und in Polen während des Kosakenaufstands, denen<br />
Hunderttausende Juden zum Opfer fielen. Denn gemäß<br />
der Überlieferung soll der Messias nach Leiden und Verfolgungen<br />
auftreten. Die Lage beruhigte sich erst wieder,<br />
als der Übertritt Zewis zum Islam bekannt wurde. Nehemia<br />
Chajon war dagegen in den Worten Kischs ein «Aben-<br />
teurer, Narr oder Schwindler auf eigene Faust», der im<br />
Gegensatz zu Zewi jedoch in Prag selbst auftrat und hier<br />
als ein «jüdischer Cagliostro» für Aufsehen und Verwirrung<br />
sorgte.<br />
Doch blieb dies letztlich eine vorübergehende Erscheinung,<br />
und die glanzvolle Reihe bedeutender Gelehrter<br />
konnte sich weiter fortsetzen, vor allem mit dem aus<br />
Worms gebürtigen David Oppenheim (1664–1736), der<br />
1702 Oberrabbiner in Prag wurde. Das von seinem Onkel<br />
Samuel Oppenheimer ererbte bedeutende Vermögen<br />
(dieser hatte Kaiser Leopold gegen hohe Zinsen große<br />
Summen für den Krieg gegen die Türken geliehen – und<br />
zurückerhalten) verwendete er für den Aufbau seiner<br />
umfangreichen hebräischen Bibliothek, die zuletzt etwa<br />
6000 bis 7000 gedruckte Bücher und rund 1000 Handschriften<br />
umfasste. Aufgrund der Schikanen durch die<br />
Jesuiten (verweigerte Druckerlaubnis hebräischer Bücher,<br />
auch bei Neuauflagen bereits erlaubter, vor allem<br />
aber Konfiskationen; Oppenheim war selbst in einen<br />
235<br />
Salomo Jehuda Rapoport,<br />
der letzte namhafte Oberrabbiner<br />
Prags, verkörpert<br />
in einem Porträt von Antonín<br />
Machek den Typus des<br />
gelehrten Juden (links).
236<br />
J u d e n s t a d t<br />
langwierigen Prozess mit den Jesuiten verwickelt) ließ<br />
er seine Bibliothek nach Hannover bringen, von wo sie<br />
später über Hamburg schließlich 1829 nach Oxford in<br />
die Bodleian-Bibliothek gelangte.<br />
Sein Grabstein auf dem Friedhof im Getto rühmt<br />
seine Gelehrsamkeit: «Viele Schüler erzog er, unendlich<br />
ist die Menge der von ihm geschaffenen Werke, Erklärungen<br />
zum Talmud und seinen Kommentaren, und Ausdeutungen<br />
der ganzen Thora [...] wer vermag so wie er Weisung<br />
zu erteilen / einzig in seiner Zeit / der die Fülle des<br />
Schrifttums in sich barg [...] zum Himmel stieg er empor<br />
auf den Stufen des Hauses des Herrn / vergönnt sei ihm<br />
zu schauen des Ewigen Schöne und zu verweilen im Palaste<br />
des Herrn.»<br />
Die Regierungszeiten Karls VI. (1711–1740) und vor<br />
allem seiner Tochter Maria Theresia (reg. 1740–1780)<br />
waren eine harte Zeit für die Prager Juden. Durch die<br />
Zunahme der jüdischen Bevölkerung in Unruhe versetzt<br />
– Anfang des 18. Jahrhunderts war die Einwohnerzahl<br />
des Gettos praktisch genauso hoch wie die der wesentlich<br />
größeren Altstadt, nämlich rund elfeinhalbtausend –,<br />
versuchte man zunächst die Anzahl der jüdischen Familien<br />
mit Aufenthaltsrecht (ein «Bürgerrecht» gab es ja damals<br />
noch nicht für sie) durch das sogenannte «Familialpatent»<br />
zu begrenzen. Dies bedeutete in der Praxis, dass<br />
nur der älteste Sohn einer Familie eine Heiratserlaubnis<br />
bekam. Den übrigen Söhnen blieb, wenn sie nicht ledig<br />
bleiben wollten (nach jüdischer Sitte jedoch im Grunde<br />
eine Unmöglichkeit), nur die Auswanderung.<br />
Diese Regelung blieb bis 1848 in Kraft. Die fortdauernde<br />
antijüdische Propaganda seitens der Jesuiten und<br />
die gezielten Gerüchte, die Juden hätten bei der vorübergehenden<br />
Besetzung Prags durch die Preußen diese unterstützt,<br />
veranlassten die Kaiserin darüber hinaus zu<br />
ihrer berüchtigten, gegen den Widerstand von Adel und<br />
Magistrat durchgesetzten Ausweisungsverfügung vom<br />
Dezember 1744. So musste bereits Ende Januar 1745,<br />
mitten im Winter, die gesamte jüdische Bevölkerung<br />
Prags die Stadt verlassen. Doch der dadurch entstandene<br />
verheerende finanzielle Schaden, den die Böhmische<br />
Kammer der Kaiserin vorrechnete, veranlasste diese,<br />
ihren Erlass vier Jahre später zurückzunehmen – vor-<br />
läufig für zehn Jahre und gegen eine zusätzliche Steuer<br />
von jährlich 300 000 Gulden.<br />
Im Herbst 1748 kehrten die jüdischen Familien in ein<br />
vollkommen verwüstetes Getto zurück, das 1754 kurz<br />
nach Beginn der Aufbauarbeiten erneut niederbrannte.<br />
Diesem verheerenden Brand fielen außer zahlreichen<br />
Wohnhäusern vier Synagogen zum Opfer, darunter die<br />
altehrwürdige Alte und die Maisel-Synagoge, ferner Rathaus,<br />
Spital und Waisenhaus. Der Wiederaufbau dauerte<br />
über ein Jahrzehnt.<br />
Aufgeklärtes Judentum zwischen Assimilation<br />
und Zionismus<br />
Der letzte bedeutende Oberrabbiner Prags im<br />
18. Jahrhundert und als Talmudlehrer eine europaweite<br />
Kapazität war Ezechiel Landau (1713–1793). Zugleich<br />
war er der letzte Vertreter der orthodoxen Tradition,<br />
denn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machte<br />
sich auch in der Prager Judengemeinde, die mehr und<br />
mehr einem kabbalistisch-mystischen Pietismus verfallen<br />
war (Kisch spricht gar von einem «Hexenkessel des<br />
religiösen Okkultismus»), der große Umbruch bemerkbar,<br />
der fast das gesamte europäisch-jüdische Geistesleben<br />
in jener Zeit erfasste. Ausgehend von den Berliner<br />
Reformkreisen um Moses Mendelssohn verbreiteten<br />
sich die Ideen der Aufklärung – und diese verlangten<br />
die Reform des religiösen Lebens und des Schulwesens<br />
(zum Beispiel deren Öffnung auch für Frauen), Assimilation<br />
an die nichtjüdische Gesellschaft und Öffnung für<br />
das allgemeine Geistesleben, insbesondere für deutsche<br />
Literatur und Philosophie, auch die Gründung von Zeitschriften.<br />
Entscheidend gefördert und zum Teil erst ermöglicht<br />
wurde diese Öffnung nach außen in der Habsburgermonarchie<br />
durch die Toleranzpatente Kaiser Josephs II. von<br />
1781, welche den Juden zwar noch keine volle Emanzipation,<br />
doch bedeutende Erleichterungen brachten – wie<br />
der Wegfall der diskriminierenden Kleidungsvorschriften,<br />
die Eindämmung der Bevormundung durch die Kirche<br />
(der Jesuitenorden war bereits seit 1773 aufgehoben)<br />
oder die Öffnung der Gymnasien und Universitäten für<br />
jüdische Mitbürger. «Das große Bildungsstreben unter
den Juden ließ ihre Zahl an Gymnasien und Universitäten<br />
rasch ansteigen, sodass ein ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung<br />
weit übersteigender Prozentsatz junger<br />
Juden eine qualifizierte Ausbildung erwarb» 10 und damit<br />
auch ein sozialer Aufstieg erfolgte.<br />
Dies hatte bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
den – in den folgenden Jahrzehnten noch deutlich<br />
zunehmenden – merklichen Einfluss einer liberalen,<br />
wohlhabenden und gebildeten Judenschaft in den<br />
Bereichen Wirtschaft und Kultur zur Folge. 1848 fielen<br />
die Mauern des Gettos, und die Juden erlangten die volle<br />
Gleichberechtigung als Untertanen der Habsburgermonarchie<br />
mit allen bürgerlichen Rechten wie die übri-<br />
Der Umstand, dass eine zunehmende Bevölkerung<br />
auf einem unerbittlich eng begrenzten Raum leben musste,<br />
hatte eine im Laufe der Jahrhunderte immer dichtere<br />
und verschachteltere Bebauung zur Folge, die zudem<br />
durch Erbteilung in immer kleinere Besitztümer und Anrechte<br />
zersplittert wurde. «Es war nicht möglich, außerhalb<br />
des Gettos Grundbesitz zu erwerben; daher war das<br />
Interesse an Grund- oder Hausbesitz außerordentlich<br />
groß. Die Folge davon war die Realerbteilung von Häusern<br />
und deren Fortschritt zu geradezu lächerlich kleinen<br />
Teilen. Zu Beginn der Assanierung gab es 128 Häuser,<br />
die in – sozusagen – Besitzparzellen aufgeteilt waren. Die<br />
Aufteilung ging von wenigen Anteilen bis zu solchen, die<br />
Prager Judenstadt vor der Assanierung Ende des 19. Jahrhunderts: Maiselgasse mit Jüdischem Rathaus (links),<br />
Dreibrunnenplatz (Mitte) und Neue Poststraße (rechts).<br />
ge Bevölkerung. Im Jahr 1861 wurde schließlich mit dem<br />
Juristen Wolfgang Wessely der erste Jude ordentlicher<br />
Professor an der Karlsuniversität, und zu Beginn des<br />
20. Jahrhunderts betrug der Gesamtanteil jüdischer Studenten<br />
an den beiden Universitäten rund 25 Prozent.<br />
Letzter namhafter Oberrabbiner Prags war Salomo<br />
Jehuda Rapoport (1790–1867), der als Begründer der<br />
modernen Judaistik gelten kann und mit dem «die Metamorphose<br />
des alten jüdischen Prag in das moderne<br />
vollzogen» wurde. 11 Er hinterließ der jüdischen Gemeinde<br />
circa 3000 Bücher und Handschriften, die den Grundstock<br />
der bis heute bestehenden öffentlichen jüdischen<br />
Bibliothek Prags bildeten.<br />
R e p r e s s a l i e n u n d V e r f o l g u n g · A u f g e k l ä r t e s J u d e n t u m<br />
wiederum unter vielen Besitzern geteilt waren. Sie umfassten<br />
Einzelanteile an einem Haus, etwa eine Kammer,<br />
einen Anteil am Flur oder Treppe und so weiter, und diese<br />
Anteile gehörten 20 bis 30 Besitzern.» 12<br />
Das Ergebnis war das schließlich sagenumwobene<br />
labyrinthische Prager Getto, dessen Ende mit dem Toleranzpatent<br />
Josephs II. eingeläutet wurde. Juden konnten<br />
ihren Wohnsitz nun frei innerhalb der Stadt wählen, und<br />
wer es vermochte, verließ das seit Mitte des 19. Jahrhundert<br />
offiziell «Josefstadt» benannte Viertel. Zurück blieb<br />
außer den Hütern der altehrwürdigen jüdischen Stätten<br />
die ärmere, in jeder Hinsicht unbewegliche Schicht. Ihr<br />
zuseiten nistete sich vor allem in den letzten Jahrzehnten<br />
237
238<br />
J u d e n s t a d t<br />
des 19. Jahrhunderts mehr und mehr die Prager Halbwelt<br />
ein, sodass das labyrinthische, kaum zu durchdringende<br />
Areal zunehmend zu einem einzigartigen, pittoresken,<br />
schwer verrufenen Spelunken- und Rotlichtbezirk<br />
verkam. Die sozialen und vor allem hygienischen Verhältnisse<br />
waren schließlich derart untragbar geworden, dass<br />
das ganze Viertel – es gab noch keine unesco-Liste des<br />
Weltkulturerbes – am Ende des 19. Jahrhunderts kurzerhand<br />
abgerissen wurde. Übrig blieben nur einige Synagogen,<br />
das jüdische Rathaus und der größere Teil des<br />
berühmten uralten Friedhofs. Auf dem freien Grund wurden<br />
nun neue, von großzügigen Neubauten mit zum Teil<br />
prachtvollen Fassaden gesäumte Straßen angelegt, vor<br />
allem der damals sehr moderne, «weltstädtische» Boulevard<br />
der Pariser Straße, welcher vom Altstädter Ring geradewegs<br />
zur Moldau und zur Svatopluk-Brücke (Niklasbrücke)<br />
führt.<br />
Derjenige Teil der jüdischen Bevölkerung, der sich<br />
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts – aus Wahlverwandtschaft<br />
oder Karrieregründen – der deutschen Sprache<br />
und Kultur zugewandt hatte, geriet bald in den Sog des<br />
in eben jener Zeit beginnenden tschechisch-deutschen<br />
Nationalitätenkonflikts. Um 1900 lebten rund 25 000<br />
Juden in Prag, davon sprachen 14 000 tschechisch und<br />
11 000 deutsch. Diesen standen circa 10 000 nichtjüdische<br />
Deutsche zur Seite und 415 000 Tschechen. «Die Söhne<br />
der letzten Generation fanden in Prag eine immer dramatischer<br />
abbröckelnde deutsche Insel vor, die von der rasch<br />
wachsenden nüchternen Hauptstadt eines tschechischen<br />
Böhmens vollkommen verdrängt zu werden drohte: Gaben<br />
im Jahre 1860 noch 50 Prozent der Prager Bevölkerung<br />
die deutsche Nationalität an, waren es 1880 nur<br />
noch 15 Prozent, 1890 zwölf Prozent, 1900 ganze sieben<br />
Prozent. Sie wurden in eine anachronistische, im Zeitalter<br />
der immer aggressiver um sich schlagenden Radikalismen<br />
an bürgerlichen Idealen alter Prägung festhaltende liberale<br />
Enklave hineingeboren. Die Väter dieser Juden glaubten<br />
noch fest an die selbst erarbeitete soziale Stellung und<br />
die eigene Assimilation und wurden doch von außen immer<br />
wieder an ihre jüdische Wurzeln erinnert.» 13<br />
Trotz ihrer zahlenmäßig deutlichen Unterlegenheit<br />
hatten die Deutschen – Juden oder nicht – einen unver-<br />
hältnismäßig großen Anteil an Schlüsselpositionen in<br />
Wirtschaft und Verwaltung inne. So richtete sich der<br />
zunehmend sich verschärfende Kampf gegen diese Zustände<br />
vonseiten radikaler tschechischer Kreise auch gegen<br />
die Juden, die zudem wegen ihrer besonderen Treue<br />
zu Kaiser und Habsburger Monarchie verdächtig waren.<br />
«Der Jude als deutscher Jude war ein Schreckgespenst,<br />
das den tschechischen Antisemitismus kräftig förderte.»<br />
14 Daneben existierte ein Antisemitismus gewisser<br />
deutscher Kreise, vor allem unter den großenteils aus<br />
dem Sudetenland stammenden Studenten.<br />
Bald nach der Jahrhundertwende hielt auch der Zionismus,<br />
jene von Theodor Herzl begründete anti-assimilatorische<br />
jüdische Sammlungsbewegung mit dem Ziel<br />
einer jüdischen Wiederbesiedelung Palästinas, in Prag<br />
Einzug. Treibende Kraft war der zionistische Studentenverein<br />
Bar Kochba mit der Zeitschrift Selbstwehr. Prominente<br />
Vertreter des Prager Zionismus waren unter anderem<br />
Hugo Bergmann und Max Brod. In den Jahren 1909<br />
bis 1911 hielt Martin Buber in Prag seine einflussreichen<br />
Drei Reden über das Judentum.<br />
Doch gab es innerhalb der jüdischen Bevölkerung<br />
höchst unterschiedliche Haltungen. «Bereits um 1910<br />
bildeten sich in Prag alle denkbaren Positionen der Beziehung<br />
zu eigenen jüdischen Wurzeln heraus, von einer<br />
assimilatorischen Haltung, die sich nur durch das ‹jüdische<br />
Temperament› verriet, über konsequente Ablehnung<br />
des eigenen Judentums, den jüdischen Selbsthass<br />
weiningerscher Prägung, zum aktiven Zionismus und<br />
zum Interesse an der Welt der Orthodoxie und des Ostjudentums.<br />
Alle diese Positionen bildeten in der ersten<br />
Tschechoslowakischen Republik das typische Mosaik des<br />
jüdischen Prags außerhalb des Gettos, dem die Prager<br />
Literatur ein Denkmal baute.» 15<br />
Hans Kohn blickte als Redakteur der zionistischen<br />
Zeitschrift Selbstwehr auf die Einstellung seiner Generation<br />
um die Jahrhundertwende zurück: «Das Judentum<br />
war uns fremd, kaum eine ferne Legende. Juden,<br />
die nicht böhmische oder, im besten Falle, Wiener Juden<br />
waren, uns unbekannt. Wir waren vollkommen assimiliert<br />
an die deutsche Kultur jener Tage oder an den Ausschnitt,<br />
der unserem jüdischen Temperament nahe lag:
an den Logos- und den Diederichs-<strong>Verlag</strong>, an die Wiener<br />
süddeutsch-jüdische Mischkultur, an Dehmel und Rilke<br />
und Hofmannsthal, an die jüngste Lyrik, die damals in<br />
einer Reihe von Zeitschriften ihr schnell verblühendes<br />
Dasein führte: Und diese Zeitschriften lagen alle im Café<br />
Arco aus. Die Assimilation war für uns wie für alle eine<br />
Wirklichkeit, der Zionismus nur eine Geste oder ein Programm,<br />
das Judentum eine traditionell oder freudig bejahte<br />
Tatsache, noch nicht einmal ein Problem.» 16<br />
Judenhass und Genozid im 20. Jahrhundert<br />
Nach dem Ersten Weltkrieg, dem Sturz der Habsburgermonarchie<br />
und der Errichtung der Tschechoslowakischen<br />
Republik entlud sich, nachdem es bereits 1897 zu<br />
antideutschen und antijüdischen Ausschreitungen gekommen<br />
war, 17 erneut der tschechische Volkszorn insbesondere<br />
gegen die jüdische Bevölkerung, die man zunehmend<br />
mit der deutschen gleichsetzte.<br />
«Das internationale Judentum wurde in erster Linie<br />
für den Krieg und vor allem für die erniedrigenden und<br />
finanziell lähmenden Bedingungen, zu denen der Frieden<br />
ausgehandelt wurde, verantwortlich gemacht. Einige<br />
tschechische Zeitungen gingen so weit, darauf zu dringen,<br />
das gesamte deutsche Eigentum zu konfiszieren und<br />
‹alle jüdischen und halbjüdischen Führer [...] im wahrsten<br />
Sinne des Wortes zu zerstampfen›. Am 16. November<br />
1920 fiel der Mob in das jüdische Viertel von Prag ein<br />
und stürmte das alte Rathaus.» 18<br />
Franz Kafka schrieb in jenen Tagen an Milena Jesenská:<br />
«Die ganzen Nachmittage bin ich jetzt auf den Gassen<br />
und bade im Judenhass. ‹Prašivé plemeno› [räudige Rasse]<br />
habe ich jetzt einmal die Juden nennen hören. Ist es<br />
nicht das Selbstverständliche, dass man von dort weggeht,<br />
wo man gehasst wird (Zionismus oder Volksgefühl<br />
ist dafür gar nicht nötig)? Das Heldentum, das darin besteht<br />
doch zu bleiben, ist jenes der Schaben, die auch<br />
nicht aus dem Badezimmer auszurotten sind.»<br />
Zwar konnten diese von radikalen Extremisten angefachten<br />
Exzesse, die für das tschechische Volk im Ganzen<br />
keineswegs typisch waren, bald eingedämmt werden.<br />
Doch wuchs im benachbarten Deutschland eine viel größere,<br />
die eigentliche, tödliche Gefahr heran: Im selben<br />
A u f g e k l ä r t e s J u d e n t u m · J u d e n h a s s u n d G e n o z i d i m 2 0 . J a h r h u n d e r t<br />
Jahr 1920 wurde dort die nsdap gegründet und damit<br />
der unaufhaltsame Aufstieg Adolf Hitlers eingeleitet,<br />
zu dessen Wahnideen von Beginn an die Ausrottung der<br />
«jüdischen Rasse» gehörte. Nachdem beim Münchner<br />
Abkommen vom September 1938 England und Frankreich<br />
die letzte Chance vertan hatten, Hitlers Imperialismus<br />
entgegenzutreten, und dann die deutsche Wehrmacht<br />
im März 1939 die Tschechoslowakische Republik<br />
überfallen hatte, brach für all jene Juden, die nicht<br />
rechtzeitig geflohen waren, und das war der ganz überwiegende<br />
Teil, eine kaum vorstellbare Schreckenszeit<br />
herein. Wie im Deutschen Reich und im «angeschlossenen»<br />
Österreich wurden die meisten Juden in die Konzentrationslager<br />
von Auschwitz, Ravensbrück oder (die<br />
Künstler) zunächst nach Theresienstadt deportiert, wo<br />
fast alle gezielt getötet wurden oder aufgrund der Haftbedingungen<br />
umkamen.<br />
Das unfassbare Geschehen kommentierte der Schriftsteller<br />
Oskar Wiener mit den Worten: «Es ist unglaublich.<br />
Ich habe immer Deutschland aufrichtig geliebt und jetzt<br />
muss ich so elend enden.» Max Brod geht auf das Thema<br />
aus der abgeklärteren Position seiner im Alter erschienenen<br />
Lebenserinnerungen ein: «Die große Begeisterung der<br />
Juden für deutsches Wesen, deutsche Kultur, Philosophie,<br />
Dichtung, ihr Patriotismus (zum Beispiel während des<br />
Ersten Weltkrieges) ist noch in allgemeiner Erinnerung,<br />
und die dann später eingetretene Kultur-Nacht periode<br />
bekam ihre schmerzlichsten Akzente dadurch, dass sich<br />
die Juden keiner Schuld bewusst waren, dass sie sich gegen<br />
das plötzliche grausame Ausgeschlossensein aus der<br />
deutschen Welt innerlich sträubten, und zwar aus Liebe<br />
sträubten. Dass zu all dem Monströsen, das sie zu erleiden<br />
hatten, auch noch das Unglück enttäuschter Wahlverbundenheit<br />
trat, bezeichnet die Höhe des Leids.»<br />
77 297 vernichtete Menschenleben sind namentlich<br />
an den Wänden der Pinkas-Synagoge dokumentiert. Die<br />
wenigen Überlebenden begannen nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
erneut ein bescheidenes Gemeindeleben, das bis<br />
heute fortbesteht. Doch waren durchaus nicht alle Rückkehrwilligen<br />
willkommen. «Die tschechischen Juden<br />
deutscher Sprache waren, sofern sie den Gaskammern<br />
der Nazis entkamen, in alle Winde verstreut. Wer zurück-<br />
239
240
kehren wollte, wurde – in Übereinstimmung mit Beneš –<br />
behandelt wie die Deutschen im Lande. Beneš erklärte<br />
1945, dass die Juden willige Werkzeuge der Deutschen<br />
gewesen seien und dass sie, um gleichberechtigt zu sein,<br />
für die Befreiung gekämpft haben müssten. Die deutschsprachigen<br />
Juden mussten um die tschechoslowakische<br />
Staatsbürgerschaft neu ansuchen. Sie bekamen ‹deutsche›<br />
Lebensmittelrationen und mussten Abzeichen tragen,<br />
die sie als Deutsche identifizierten. Die in der Tschechoslowakei<br />
geborene Germanistik-Professorin Wilma<br />
Abeles Iggers aus dem amerikanischen Buffalo schreibt in<br />
ihrem Buch Die Juden in Böhmen und Mähren: ‹Juden, die<br />
vor dem Krieg in deutschen oder ungarischen Turnvereinen<br />
organisatorisch tätig waren, waren von den Staatsbürgerschaftsrechten<br />
ausgeschlossen. Ausgeschlossen<br />
waren ferner auch Juden, die sich vor dem Zweiten Weltkrieg<br />
zur jüdischen Nationalität bekannt hatten.›» 19<br />
Dass immerhin die Gebäude und Einrichtungen trotz<br />
des Naziterrors gegen die jüdische Bevölkerung erhalten<br />
geblieben sind, verdankt sich dem offenbar auf Hitler<br />
selbst zurückgehenden perversen Plan, in Prag ein «Museum<br />
einer ausgestorbenen Rasse» einzurichten. Zu diesem<br />
Zweck wurden hier auch sämtliche Kultgegenstände<br />
aus den zerstörten Synagogen des übrigen Landes zusammengeführt.<br />
Der größte Teil der jüdischen Einrichtungen Prags<br />
ist heute Bestandteil des Jüdischen Museums, und die<br />
Reste der «Judenstadt» gehören zu den größten Touristenattraktionen<br />
Prags. Doch die große, jahrhundertealte<br />
Geschichte einer der bedeutendsten jüdischen Gemeinden<br />
Europas ist offenbar unwiederbringlich zu Ende. Damit<br />
ist auch ein Teil der Identität Europas verloren gegangen,<br />
woran das klarsichtige Wort des tschechischen<br />
Schriftstellers Milan Kundera erinnert: «Die Juden waren<br />
im 20. Jahrhundert das wichtigste weltbürgerliche Element,<br />
sie waren die Initiatoren Mitteleuropas.»<br />
Unter dem Dach der Altneu-Synagoge (rechts) soll Rabbi<br />
Löw den «entseelten» Körper des Golem eingeschlossen<br />
haben. – Die Thorarollen werden im steinernen Schrein an<br />
der Ostwand des Betraums aufbewahrt (linke Seite).<br />
J u d e n h a s s u n d G e n o z i d i m 2 0 . J a h r h u n d e r t · A l t n e u - S y n a g o g e<br />
Die Altneu-Synagoge, auch Altneuschul genannt, 20 hat<br />
als eines der ehrwürdigsten Gebäude der Stadt auch ihre<br />
eigenen Legenden. So sollen nach der Zerstörung des<br />
Tempels zu Jerusalem durch die Römer im Jahr 70 n. Chr.<br />
einige Steine von Engeln nach Prag gebracht worden sein,<br />
die dann in die Grundmauern dieses Bethauses eingefügt<br />
wurden. Deshalb konnte dem Bau, der stets von Engeln<br />
beschützt blieb, auch keiner der oft verheerenden Brände<br />
des Gettos etwas anhaben.<br />
Aber ganz so alt sind Prag und die Synagoge nun<br />
doch nicht, denn die Historiker sagen, dass das Gottes-<br />
241
242<br />
J u d e n s t a d t<br />
haus um 1270 von den französischen, an der Zisterzienser<br />
gotik geschulten Baumeistern des unweit gelegenen<br />
Agnes-Klosters zeitgleich mit diesem errichtet<br />
wurde. Da bereits eine «Altschul» existierte, nannte man<br />
diese die «Neuschul». Als dann im 16. Jahrhundert zwei<br />
weitere Bethäuser gebaut wurden, bürgerte sich für die<br />
bisherige «Neuschul» die Bezeichnung «Altneuschul»<br />
beziehungsweise Altneu-Synagoge ein.<br />
Der eigentliche Betraum ist später an drei Seiten von<br />
Anbauten umgeben worden: einem Eingangsraum und<br />
– aus dem 17. Jahrhundert – zwei Frauenemporen. Über<br />
dem Eingang zum Innenraum zeigt das Relief des Türbogenfeldes<br />
ein schönes symbolisches Lebensbaummotiv<br />
in Form einer sich verzweigenden Weinranke mit zahlreichen<br />
Blättern und zwölf Wurzeln, den Symbolen der<br />
zwölf Stämme des Volkes Israel.<br />
Die zwei massiven Säulen des zweischiffigen Innenraums<br />
tragen die sechs Felder des hohen gotischen<br />
Kreuzrippen-Gewölbes. Ob die nur hier vorkommende,<br />
jeweils zur Wandmitte verlaufende höchst ungewöhnliche<br />
fünfte Kreuzrippe tatsächlich dadurch begründet ist,<br />
dass man hier die Kreuzform vermeiden wollte, ist nicht
eindeutig geklärt. Der zwischen den zwei Säulen durch<br />
Holzschranken und einem schmiedeeisernen Gitter (aus<br />
dem 15. Jahrhundert) ausgesparte Raum, das sogenannte<br />
Bimah oder Almemor, dient zum Vorlesen aus der<br />
Thora-Rolle, worauf das Pult hinweist. Um dieses Bimah<br />
sowie entlang der Wände bieten alte hölzerne Sitze den<br />
älteren Gemeindemitgliedern eine Sitzgelegenheit während<br />
der Gottesdienste. Die freskierten Inschriften an<br />
den Wänden sind den Psalmen, Prophetenbüchern und<br />
dem Talmud entnommen.<br />
Eine große rote Standarte in der Mitte des Raumes,<br />
die neben dem Davidsstern den Schwedenhut zeigt,<br />
wurde den Prager Juden von Kaiser Ferdinand III. für<br />
ihre Verdienste bei der Verteidigung der Prager Altstadt<br />
gegen die Schweden 1648 verliehen. In Prag kam das<br />
bereits in der griechischen und jüdischen Antike bekannte<br />
und im Mittelalter als Talisman gebräuchliche Sechseck-Symbol<br />
des sogenannten «Davidssterns» ab dem<br />
16. Jahrhundert als Erkennungszeichen der jüdischen<br />
Gemeinde beziehungsweise des Judentums in Gebrauch;<br />
von hier aus breitete es sich in ganz Europa und weltweit<br />
aus, bis es schließlich in die Nationalflagge des Staates<br />
Israel Eingang fand.<br />
An der Ostwand wird in einem von einem Vorhang<br />
verdeckten und mit zwei Metalltüren verschlossenen steinernen<br />
Thoraschrein (Aron ha-Kodesch) die Thorarolle<br />
aufbewahrt, welche in hebräischer Handschrift die fünf<br />
Bücher Moses enthält. Davor befindet sich eine kleine<br />
vertiefte Stelle, von der aus der Vorbeter beziehungsweise<br />
Vorsänger (Kantor) den jeweiligen Bibeltext vorträgt, gemäß<br />
dem Psalm 130: Aus der Tiefe rufe ich Herr zu Dir. Ein<br />
kleiner Fensterschlitz über dem Thoraschrein diente einst<br />
dazu, in der Abenddämmerung den ersten Stern auszumachen.<br />
Denn erst wenn dieser sichtbar ist (zumindest<br />
bei klarem Wetter), kann der Gottesdienst beginnen –<br />
Altneu-Synagoge: Vorraum (links unten), Tympanon mit<br />
Lebensbaummotiv in Form einer sich verzweigenden Weinranke<br />
(links oben) und Lesepult vor dem ThoraSchrein<br />
(rechts).<br />
A l t n e u - S y n a g o g e · J ü d i s c h e r F r i e d h o f<br />
falls mindestens zehn über dreizehnjährige männliche<br />
Besucher beisammen sind. Ein siebenarmiger Leuchter<br />
(Menorah) und ein «ewiges Licht» vervollständigen die<br />
notwendige Ausstattung des nach wie vor genutzten<br />
Bethauses.<br />
Nach der Zerstörung der romanischen Synagoge in<br />
Worms durch die Nationalsozialisten ist die Prager Altneu-Synagoge<br />
die älteste erhaltene in Europa.<br />
Auch hinter der auffallend hohen, aus Ziegelsteinen<br />
gemauerten Giebelwand aus dem 15. Jahrhundert ist<br />
eine bekannte Prager Sage angesiedelt, soll doch dort,<br />
auf dem nur von außen zugänglichen Dachboden, seit<br />
den Tagen des Hohen Rabbi Löw der «entseelte» Lehmkörper<br />
des Golem liegen. Der Rabbi habe für alle Zeiten<br />
das ausdrückliche Verbot erlassen, dass jemals wieder ein<br />
Mensch den Dachboden betrete. Egon Erwin Kisch hat<br />
sich nach vielen Mühen dennoch die Erlaubnis verschafft<br />
und ist die (einst auf behördliche Anweisung an der Außenmauer<br />
angebrachten) Eisensprossen hinaufgeklettert<br />
... Über diese spektakuläre Aktion berichtet er in seiner<br />
Reportage Dem Golem auf der Spur. Červená 2<br />
Jüdischer Friedhof · Der romantisch anmutende Friedhof<br />
des ehemaligen Gettos, heute eine der wichtigsten<br />
Touristenattraktionen Prags, ist das Ergebnis peinlichsten<br />
Platzmangels. Ohne die Möglichkeit der Ausbreitung<br />
bei steigender Zahl der Gettobewohner, konnte die Erweiterung<br />
nur in senkrechter Richtung erfolgen. Immer<br />
wieder musste neue Erde aufgeschüttet werden, um die<br />
Toten wirklich «beerdigen» zu können. So wuchs die Begräbnisstätte,<br />
von den Juden Beth Chaim, Haus des Lebens,<br />
genannt, im Laufe der Jahrhunderte stetig in die<br />
Höhe (auch weil nach jüdischem Glauben die Auflassung<br />
von Gräbern nicht gestattet ist) mitsamt den Grabsteinen,<br />
die immer wieder mit nach oben versetzt wurden,<br />
und es bildete sich die charakteristische, von hohen Bäumen<br />
und Holunderbüschen beschattete Hügellandschaft<br />
aus mit den rund zwölftausend Grabsteinen unterschied-<br />
licher Größe und Form – der älteste erhaltene von 1439,<br />
der jüngste von 1787. Die Zahl der hier ruhenden Toten<br />
ist allerdings viel höher, schätzungsweise sind es zwanzigtausend.<br />
243
244<br />
J u d e n s t a d t<br />
Die hebräischen Inschriften der Grabsteine nennen<br />
den Namen des hier Bestatteten, den seines Vaters, bei<br />
Frauen auch den des Ehemanns, ferner das Datum von<br />
Tod und Bestattung. Oft ist ein bildliches Namenssymbol<br />
beigefügt, etwa Hirsch, Wolf, Karpfen, Fuchs, Bär,<br />
Hahn oder auch Berufssymbole wie Mörser für den Apotheker,<br />
Pinzette für den Arzt, Schere für den Schneider;<br />
einem Gelehrten wird dagegen nicht selten eine Krone<br />
verliehen. Die Weintraube weist auf einen Angehörigen<br />
des israelitischen Stammes Juda, während der Krug den<br />
Nachkommen der Leviten zugehörig ist, die die Aufgabe<br />
hatten, vor dem Gottesdienst den Priestern die Hände<br />
zu waschen. Die im Segensgestus erhobenen Hände sind<br />
dem Priestergeschlecht der Kohanim vorbehalten, von<br />
dem sich die Namen Cohen und Kohn herleiten.<br />
Darüber hinaus findet sich auf den Grabsteinen in<br />
der Regel eine allgemeine, aber oft poetische Formel wie<br />
«Seine Seele ging von dannen in Heiligkeit und Reinheit»,<br />
«Ihre Seelen stiegen empor in die Wohnsitze der Höhen»<br />
oder «Seine Seele kehrte zurück zum Herrn». Zuletzt<br />
findet sich in der Regel noch eine – oft schmeichelhafte<br />
– Bemerkung über die guten Eigenschaften des Dahingegangenen:<br />
«Im Himmel beliebt und den Menschen<br />
ein Schmuck», «Seine Hände streckte er den Armen ent-<br />
gegen» oder einfach «Wer zählt seine Vorzüge auf?». Bei<br />
Frauen heißt es dagegen beispielsweise «Eine Frau weisen<br />
Herzens», «Almosen gab sie im Verborgenen» oder einfach<br />
nur «Die Liebliche».<br />
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts kam die repräsentative<br />
Grabtumba auf, die sich nur wenige leisten konnten.<br />
Die älteste ist jene des Mordechai Maisel (gestorben<br />
1601), doch das bekannteste aller Grabmäler des Friedhofs<br />
ist natürlich jenes des Hohen Rabbi Löw, in dem auch<br />
seine Frau ruht. In der ausführlichen Grabschrift, die jeweils<br />
die Hälfte der Vorder- und Rückseite der Tumba bedeckt,<br />
werden seine Verdienste gebührend gewürdigt:<br />
«Rabbi Jehuda, Sohn des Bezalel / Der Löwe, gewaltig<br />
bei den Oberen und Unteren / er drang ein mit Erlaubnis<br />
und ohne solche / jeden Paradiesesgarten betrat<br />
und durchschritt er unversehrt / weiser war er als jeder,<br />
der die Lehre empfängt und deutet / nichts ließ er unbeachtet<br />
/ Kleines und Großes sammelte und vereinte er<br />
/ Werke verfasste er ohne Ende / und den Ertrag seines<br />
Feldes / wahren mehr als fünfzehn Werke / eine anmutige<br />
Perlenschnur seiner Wangen / schriftliche Lehre und<br />
Überlieferung vereinte er im Bausch seines Gewandes /<br />
in jeglicher Wissenschaft und Erkenntnis war seine Hand<br />
erhoben / den Kindern seiner Zeit bot er das Brot der Er-
habenen / in der Beantwortung der Fragen siegreich und<br />
treffend / in der Eröffnung neuer Erkenntnisse in allen<br />
sechs Ordnungen / des Talmud, der Erklärung Raschis<br />
und der Tossafisten zeigen sie seine Gewalt / in Erörterungen<br />
seltenen Scharfsinns / für die, die Erkenntnis<br />
Gottes und der Menschen fördern / die Augen der Hebräer<br />
erleuchtete er / und darüber hinaus, dass seine Weisheit<br />
mächtig war unter den Mächtigen / lehrte er nach<br />
Einsicht die Eifrigen und Bedächtigen / mit Überlegung<br />
und Untersuchung traf er vielfache Verordnungen, zum<br />
Schutze biblischer und rabbinischer Bestimmungen / die<br />
Worte der Weisheit wie Zeltpflöcke / und so ordnete er<br />
das Lager von der Stadt für spätere Geschlechter / Wehe,<br />
der Fromme! Wehe, der Demütige / so rufen sie sich gegenseitig<br />
an.»<br />
Die jeweils andere Hälfte ist dem Lobpreis seiner Frau<br />
vorbehalten: «Ein wackeres Weib, die Krone ihres Gatten,<br />
sein Herz vertraute auf sie bei Zerstreuung und Verbindung<br />
/ lieblich waren ihre Werke wie Räucherwerk / unter<br />
den Frauen der Gezelte ist sie gesegnet in Herrlichkeit<br />
/ wie bei Sara und Riwka umzog sich für sie der Him-<br />
mel mit Wolken / auf der Zubereitung ihres Teiges ruhte<br />
der Segen / von Sabbat zu Sabbat brannte ihr Licht / wie<br />
Lea und Rachel war sie des Hauses Wurzel / zum Dienste<br />
J ü d i s c h e r F r i e d h o f<br />
und zur Bemühung für den, der den Himmel mit dem<br />
Spann errechnete.»<br />
Alle diese Grabinschriften sind in ihrer Gesamtheit<br />
eine bedeutende Geschichtsquelle. «Sie enthalten eine<br />
ganze Reihe von Wörtern und Wendungen, die sonst nirgends<br />
belegt sind und die Grundlage für das Studium der<br />
hebräischen Sprache in einer Zeitspanne von vier Jahrhunderten<br />
bildeten.» 21 Es existieren von allen diesen Tausenden<br />
von Inschriften handschriftliche Kopien, die im<br />
jüdischen Archiv aufbewahrt werden.<br />
Blumen als Grabschmuck sind auf jüdischen Friedhöfen<br />
unbekannt, aber es fallen einem hier auf etlichen<br />
Grabsteinen oder -tumben, besonders jener des Rabbi<br />
Löw, einzelne oder gar Häufchen kleiner Steine auf. Was<br />
es damit für eine Bewandtnis hat, erzählt der vielbewanderte<br />
Egon Erwin Kisch:<br />
«Vor Jahrtausenden hatte man über die Gräber derer,<br />
die auf der Wanderung Israels durch die Sahara tot<br />
245<br />
Rund zwölftausend Grabsteine aus vier Jahrhunderten von unterschiedlichster<br />
Größe und Form bedecken die von Bäumen und Büschen beschattete<br />
Hügellandschaft des Jüdischen Friedhofs. Aus ihrer namenlosen Vielzahl<br />
ragt die Grabtumba des Rabbi Löw hervor (linke Seite, rechts).
246<br />
J u d e n s t a d t<br />
niedergebrochen waren, Steine gewälzt, damit es Geiern<br />
und Hyänen nicht gar zu leicht werde, den Leichnam aus<br />
dem Wüstensand zu scharren; jedes Nachzüglers fromme<br />
Pflicht war es, auf gleiche Weise den Toten vor dem<br />
Raubtier zu schützen. Durch die Unendlichkeit der Zeitalter<br />
hatte sich diese Maßnahme als Brauch erhalten, hier<br />
ist diese Jahrtausende alte Sitte seit fünf Jahrhunderten<br />
noch in Geltung, aus dem Mittelalter kann ein Steinchen<br />
stammen, das neben einem von heute Morgen liegt.» 22<br />
Die besondere «magische» Atmosphäre des Friedhofs,<br />
für den Prager Willy Haas «der schönste und geheim-<br />
nisvollste der Welt», inspirierte, was kaum verwundert,<br />
nicht wenige Dichter und Schriftsteller. Schönstes Beispiel<br />
ist wohl die 1863 erschienene Erzählung Holunderblüte<br />
von Wilhelm Raabe, Frucht seines Pragbesuchs vier<br />
Jahre zuvor. Diese anmutige, in ihrem Ausgang aber doch<br />
molldunkle Geschichte von der Begegnung eines Studenten<br />
mit einem jungen Mädchen aus dem Getto, einer Art<br />
jüdischer Mignon, auf dem alten Friedhof und ihrer folgenden<br />
zart-schwebenden Freundschaft beschwört die<br />
geheimnisvoll-poetische Atmosphäre ihres Schauplatzes<br />
um die Mitte des 19. Jahrhunderts herauf. Nachdem der<br />
Erzähler durch «das namenlose Gewirr von Gassen und<br />
Gässchen» und «die abscheulichsten Winkel, Gassen und<br />
Durchgänge» des alten Gettos, gar «durch das schmutzigste<br />
Labyrinth, welches die menschliche Phantasie sich<br />
vorstellen kann» endlich «zu der Pforte, welche in das<br />
schauerliche, oft beschriebene Reich des tausendjährigen<br />
Staubes führt», gefunden hat, ist er – zunächst – allein<br />
auf dem Friedhof:<br />
«Ich sah die unzähligen aneinandergeschichteten<br />
Steintafeln und die uralten Holunder, welche ihre knorrigen<br />
Äste drumschlingen und drüberbreiten. Ich wandelte<br />
in den engen Gängen und sah die Krüge von Levi,<br />
die Hände Aarons und die Trauben Israels. Zum Zeichen<br />
meiner Achtung legte ich, wie die andern, ein Steinchen<br />
auf das Grab des Hohen Rabbi Jehuda Löw ben Bezalel.<br />
Dann saß ich nieder auf einem schwarzen Steine aus dem<br />
vierzehnten Jahrhundert, und der Schauer des Ortes<br />
kam in vollstem Maße über mich.<br />
Seit tausend Jahren hatten sie hier die Toten des<br />
Volkes Gottes zusammengedrängt, wie sie die Lebenden<br />
eingeschlossen hatten in die engen Mauern des Getto. Die<br />
Sonne schien wohl, und es war Frühling, und von Zeit zu<br />
Zeit bewegte ein frischer Windhauch die Holunderzweige<br />
und -blüten, dass sie leise über den Gräbern rauschten<br />
und die Luft mit süßem Duft füllten; aber das Atmen wur-<br />
Grabtumba des Rabbi Löw auf dem Jüdischen Friedhof.<br />
Uhren des Jüdischen Rathauses mit hebräischen und<br />
lateinischen Ziffern (rechte Seite).
de mir doch immer schwerer, und sie nennen diesen Ort<br />
Beth-Chaim, das Haus des Lebens?!<br />
Aus dem schwarzen, feuchten, modrigen Boden, der<br />
so viele arg geplagte, misshandelte, verachtete, angstgeschlagene<br />
Generationen lebendiger Wesen verschlungen<br />
hatte, in welchem Leben auf Leben versunken war wie in<br />
einem grundlosen, gefräßigen Sumpf, – aus diesem Boden<br />
stieg ein Hauch der Verwesung auf, erstickender als<br />
von einer unbeerdigten Walstatt, gespenstisch genug, um<br />
allen Sonnenglanz und allen Frühlingshauch und allen<br />
Blütenduft zunichte zu machen.<br />
Ich habe schon erzählt, dass ich in dieser Zeit meines<br />
Lebens ein toller, wilder Geselle war; aber das Gefühl,<br />
welches mich an dieser Stelle erfasste, enthielt die Bürgschaft<br />
dafür, dass ich noch ernst genug werden könne.<br />
Immer tiefer sank mir die Stirn herab, als ich plötzlich<br />
dicht neben mir – über mir ein kindlich helles Lachen<br />
hörte, welches ich schon einmal vernommen hatte. Dieses<br />
Mal erschreckte es mich fast, und als ich schnell aufsah,<br />
erblickte ich ein liebliches Bild. In dem Gezweig<br />
eines der niedern Holunderbüsche, die, wie schon gesagt,<br />
das ganze Totenfeld überziehen, – mitten in den<br />
Blüten, auf einem der wunderlichen, knorrigen Äste,<br />
welche die Pracht und Kraft des Frühlings so reich mit<br />
Grün und Blumen umwunden hatte, saß das neckische<br />
Kind, welches mir vorhin so schlecht den Weg hierher<br />
gewiesen hatte, und schelmisch lächelte es herab auf den<br />
deutschen Studenten. Als ich aber die Hand nach dem<br />
Spuk ausstreckte, da war er blitzschnell verschwunden,<br />
und einen Augenblick später sah das lachende bräunliche<br />
Gesicht, umgeben von schwarzem Gelock, um das<br />
Grab des Hohen Rabbi, als wolle es mich von neuem verlocken,<br />
und zwar zu einer Jagd über den alten Totenort.<br />
Aber dieses Mal ließ ich mich nicht verleiten; denn ich<br />
wusste klar, dass es mir doch nichts nutzen würde, wenn<br />
ich dem Ding nachspränge. In die Erde, in den schwarzen<br />
Boden hätte es sich verloren, oder, noch wahrscheinlicher,<br />
in die Holunderblüten über den Gräbern wäre es<br />
verschwunden. Wie angewurzelt stand ich auf meinen<br />
Füßen und traute dem hellen Tag, der glänzenden Mittagsstunde<br />
nicht im mindesten.»<br />
Else Lasker-Schüler ließ sich während ihres Prag-<br />
Aufenthalts 1915 zu einem Gedicht inspirieren:<br />
Der alte Tempel in Prag<br />
Tausend Jahre zählt der Tempel schon in Prag;<br />
Staubfällig und ergraut ist längst sein Ruhetag<br />
Und die alten Väter schlossen seine Gitter.<br />
Ihre Söhne ziehen nun in die Schlacht.<br />
Der zerborstene Synagogenstern erwacht,<br />
Und er segnet seine jungen Judenritter.<br />
Wie ein Glücksstern über Böhmens Judenstadt,<br />
Ganz aus Gold, wie nur der Himmel Sterne hat.<br />
Hinter seinem Glanze beten wieder Mütter.<br />
J ü d i s c h e r F r i e d h o f<br />
247