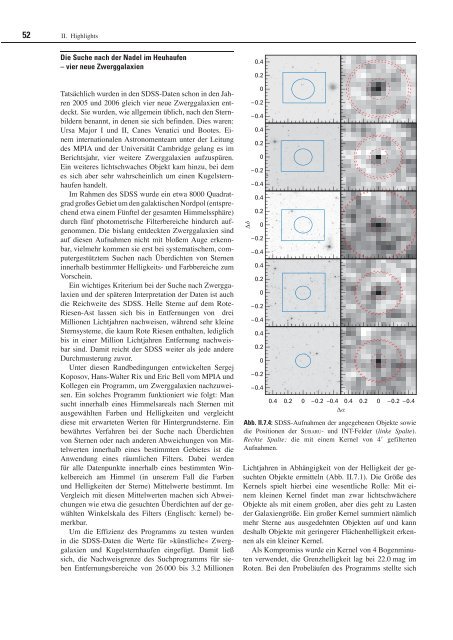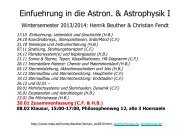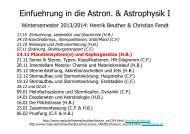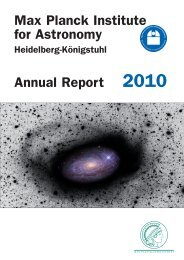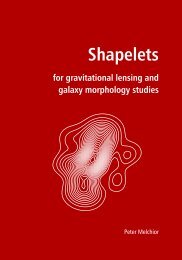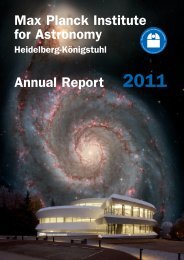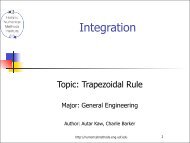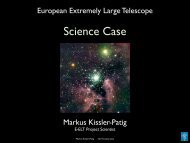Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
52 II. Highlights<br />
Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen<br />
– vier neue Zwerggalaxien<br />
Tatsächlich wurden in den SDSS-Daten schon in den Jahren<br />
2005 und 2006 gleich vier neue Zwerggalaxien entdeckt.<br />
Sie wurden, wie allgemein üblich, nach den Sternbil<br />
dern benannt, in denen sie sich befinden. Dies wa ren:<br />
Ursa Major I und II, Canes Venatici und Bootes. Einem<br />
internationalen Astronomenteam unter der Leitung<br />
des MPIA und der Universität Cambridge gelang es im<br />
Berichtsjahr, vier weitere Zwerggalaxien auf zu spü ren.<br />
Ein weiteres lichtschwaches Objekt kam hinzu, bei dem<br />
es sich aber sehr wahrscheinlich um einen Ku gel sternhau<br />
fen handelt.<br />
Im Rahmen des SDSS wurde ein etwa 8000 Quadratgrad<br />
großes Gebiet um den galaktischen Nordpol (entsprechend<br />
etwa einem Fünftel der gesamten Himmelssphäre)<br />
durch fünf photometrische Filterbereiche hindurch aufgenommen.<br />
Die bislang entdeckten Zwerggalaxien sind<br />
auf diesen Aufnahmen nicht mit bloßem Auge erkennbar,<br />
vielmehr kommen sie erst bei systematischem, computergestütztem<br />
Suchen nach Überdichten von Sternen<br />
innerhalb bestimmter Helligkeits- und Farbbereiche zum<br />
Vorschein.<br />
Ein wichtiges Kriterium bei der Suche nach Zwerg gala<br />
xien und der späteren Interpretation der Daten ist auch<br />
die Reichweite des SDSS. Helle Sterne auf dem Rote-<br />
Riesen-Ast lassen sich bis in Entfernungen von drei<br />
Millionen Lichtjahren nachweisen, während sehr kleine<br />
Sternsysteme, die kaum Rote Riesen enthalten, lediglich<br />
bis in einer Million Lichtjahren Entfernung nachweisbar<br />
sind. Damit reicht der SDSS weiter als jede andere<br />
Durchmusterung zuvor.<br />
Unter diesen Randbedingungen entwickelten Sergej<br />
Koposov, Hans-Walter Rix und Eric Bell vom MPIA und<br />
Kollegen ein Programm, um Zwerggalaxien nachzuweisen.<br />
Ein solches Programm funktioniert wie folgt: Man<br />
sucht innerhalb eines Himmelsareals nach Sternen mit<br />
ausgewählten Farben und Helligkeiten und vergleicht<br />
diese mit erwarteten Werten <strong>für</strong> Hintergrundsterne. Ein<br />
bewährtes Verfahren bei der Suche nach Überdichten<br />
von Sternen oder nach anderen Abweichungen von Mittel<br />
wer ten innerhalb eines bestimmten Gebietes ist die<br />
Anwendung eines räumlichen Filters. Dabei werden<br />
<strong>für</strong> alle Datenpunkte innerhalb eines bestimmten Winkel<br />
be reich am Himmel (in unserem Fall die Farben<br />
und Helligkeiten der Sterne) Mittelwerte bestimmt. Im<br />
Vergleich mit diesen Mittelwerten machen sich Ab weichungen<br />
wie etwa die gesuchten Überdichten auf der gewählten<br />
Winkelskala des Filters (Englisch: kernel) bemerkbar.<br />
Um die Effizienz des Programms zu testen wurden<br />
in die SDSS-Daten die Werte <strong>für</strong> »künstliche« Zwergga<br />
laxien und Kugelsternhaufen eingefügt. Damit ließ<br />
sich, die Nachweisgrenze des Suchprogramms <strong>für</strong> sieben<br />
Entfernungsbereiche von 26 000 bis 3.2 Millionen<br />
<br />
0.4<br />
0.2<br />
0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
0.4<br />
0.2<br />
0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
0.4<br />
0.2<br />
0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
0.4<br />
0.2<br />
0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
0.4<br />
0.2<br />
0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
0.4<br />
0.2 0 –0.2 –0.4 0.4<br />
<br />
0.2 0 –0.2 –0.4<br />
Abb. II.7.4: SDSS-Aufnahmen der angegebenen Objekte sowie<br />
die Positionen der SU B A R U- und INT-Felder (linke Spalte).<br />
Rechte Spalte: die mit einem Kernel von 4 gefilterten<br />
Aufnahmen.<br />
Licht jahren in Abhängigkeit von der Helligkeit der gesuchten<br />
Objekte ermitteln (Abb. II.7.1). Die Größe des<br />
Kernels spielt hierbei eine wesentliche Rolle: Mit einem<br />
kleinen Kernel findet man zwar lichtschwächere<br />
Ob jekte als mit einem großen, aber dies geht zu Lasten<br />
der Galaxiengröße. Ein großer Kernel summiert nämlich<br />
mehr Sterne aus ausgedehnten Objekten auf und kann<br />
des halb Objekte mit geringerer Flächenhelligkeit erkennen<br />
als ein kleiner Kernel.<br />
Als Kompromiss wurde ein Kernel von 4 Bogenminuten<br />
verwendet, die Grenzhelligkeit lag bei 22.0 mag im<br />
Roten. Bei den Probeläufen des Programms stellte sich