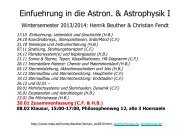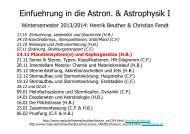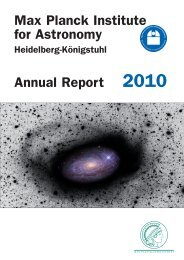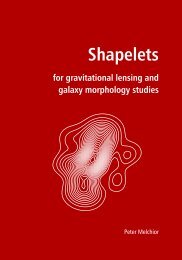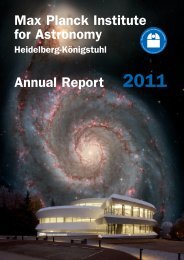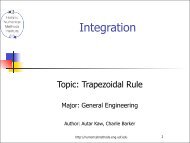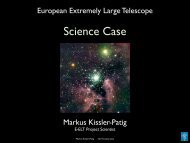Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
30 II. Highlights<br />
II.3 Die schnelle Entstehung von Planetesimalen in turbulenten Scheiben<br />
In den ersten Phasen der Entstehung von Planeten<br />
sto ßen Staubteilchen zusammen, bleiben aneinan der<br />
haf ten und wachsen. Hat ein Körper einen Durch messer<br />
von etwa einen Kilometer erreicht, so ist seine<br />
Gra vitationskraft groß genug, um weitere Körper aus<br />
der Umgebung anzuziehen und an sich zu binden. Auf<br />
die se Weise wächst er schließlich zu einem Pla neten<br />
heran. Doch dieses einfache Szenario scheint bei<br />
Grö ßen um zehn Zentimeter eine Grenze zu besit zen.<br />
Ge steins bro cken dieser Größe stürzen sehr schnell in<br />
den Zentralstern ab, und sie können jüngsten Er gebnissen<br />
der Laborastrophysik zufolge nicht weiter mit<br />
dem klassischen StoßenHaftenMechanismus wachsen,<br />
weil sie sich bei gegenseitigen Stößen eher<br />
ge gen seitig zerstören. Theoretiker des MPIA haben<br />
nun einen Weg gefunden, wie die Na tur diese Zehn<br />
Zen timeterBarriere überwinden könn te: In den proto<br />
planetaren Scheiben entstehen durch Tur bu lenzen<br />
»Hoch druckwirbel«. Darin sammeln sich Ge steins brocken<br />
und können sich nun aufgrund der gemein sa men<br />
Schwerkraft zusammenlagern. Auf diese Wei se kön nen<br />
in kurzer Zeit Körper von der Größe unse res Klein plane<br />
ten Ceres entstehen.<br />
Kleinste Staubpartikel bleiben bei gegenseitigen Stößen<br />
aneinander haften, weil zwischen ihnen die anziehende<br />
Van-der-Waals-Kraft wirkt. Die hier<strong>für</strong> nötigen Rela<br />
tiv geschwindigkeiten erhalten sie durch die Brownsche<br />
Bewegung. Sie nimmt mit wachsender Teil chenmasse<br />
ab und kann deshalb nur in der sehr jungen protoplanetaren<br />
Wolke einen Einfluss haben. Im weiteren<br />
Verlauf sinken die immer größer werdenden Teilchen<br />
aufgrund der Schwerkraft zur Mittelebene der sich ausbil<br />
dendenden protoplanetaren Scheibe ab. Da die Sinkgeschwindigkeit<br />
mit wachsender Teilchenmasse zunimmt,<br />
treten auch hierbei zwischen den Staubpartikeln<br />
Relativgeschwindigkeiten auf, die zu weiteren Zusammenstößen<br />
und einem Anwachsen führen. So werden<br />
die Teilchen beim Erreichen der Scheibenebene vermutlich<br />
bis zu einige Zentimeter groß.<br />
In der Mittelebene der Scheibe ist die Staubdichte<br />
ver hältnismäßig hoch, so dass Teilchen jetzt öfter zusam<br />
menstoßen und prinzipiell zu Planetesimalen mit<br />
ei nigen Kilometern Durchmesser anwachsen könnten.<br />
Die ses verhindern jedoch im Wesentlichen zwei Prozes<br />
se. Erstens prallen die Staubkrümel ab einer ge wissen<br />
Geschwindigkeit voneinander ab oder zerstören sich<br />
sogar gegenseitig. Jüngste Ergebnisse der La bor as trophysik<br />
belegen, dass die Gesteinsbrocken durch den<br />
Stoßen-Haften-Mechanismus kaum über mehr als etwa<br />
zehn Zentimeter hinaus wachsen können.<br />
Und zweitens verlieren Körper dieser Größenordnung<br />
aufgrund ihrer Reibung mit dem Gas in der Scheibe<br />
an Drehimpuls und nähern sich auf einer spiralförmigen<br />
Bahn in relativ kurzer Zeit dem Zentralstern.<br />
Abschätzungen zeigen, dass ein Brocken dieser Größe<br />
innerhalb von einigen hundert Jahren dem Stern so nahe<br />
kommt, dass er verdampft. In diesem kurzen Zeitraum<br />
kann ein Stein von der Größe eines Tennisballs nicht um<br />
etwa zwei Größenordnungen im Durchmesser, das heißt<br />
um sechs Größenordnungen in der Masse wachsen.<br />
Turbulenz konzentriert Gesteinsbrocken<br />
Die hohen Driftraten der Felsbrocken treten in Scheiben<br />
auf, in denen Gas und Staub laminar strömen. Es<br />
gibt aber bereits seit einiger Zeit die Vermutung, dass<br />
Turbulenzen auftreten, die die Bewegung der Par tikel<br />
erheblich beeinflussen. In erster Linie ist das die<br />
Kel vin-Helmholtz-Turbulenz (kurz KH-Turbulenz), die<br />
auf folgende Weise entsteht: Zunächst sedimentiert der<br />
Staub zur Mittelebene der Scheibe. Dort sinken Tempe<br />
ratur und Dichte mit wachsendem Abstand vom<br />
Zen tralstern. Aus diesem Grunde herrscht ein radialer<br />
Druckgradient, was dazu führt, dass das Gas lang samer<br />
rotiert, als es dies auf einer reinen Keplerbahn tun<br />
würde. Die Staubteilchen hingegen reagieren nicht auf<br />
den Druckgradienten, sondern »fühlen« nur die Schwerkraft.<br />
Sie umlaufen den Zentralstern deshalb auf Keplerbahnen.<br />
Ist in der Mittelebene der Scheibe das Staubzu-Gas-Verhältnis<br />
hoch genug, so reißt der Staub die<br />
Gasteilchen mit und zwingt sie ebenfalls auf die Geschwin<br />
digkeit einer Keplerbahn. Als Folge hiervon bewegt<br />
sich das Gas in der Mittelebene schneller als das<br />
Gas ober- und unterhalb davon. Es tritt also eine ver tikale<br />
Geschwindigkeitsscherung auf, welche die KH-Insta<br />
bilitäten auslöst.<br />
Die hierbei einsetzende turbulente Gasbewegung wirbelt<br />
den Staub in der Mittelebene auf und verhindert dadurch<br />
eine Verklumpung des Staubes zu Planetesimalen.<br />
Dieses Problem erkannten P. Goldreich und W. R.<br />
Ward schon 1973 und sahen darin ein Hindernis <strong>für</strong> das<br />
Anwachsen der Staubteilchen zu Planetesimalen.<br />
Erst vor wenigen Jahren tauchte dann die Vermutung<br />
auf, dass die Turbulenzen lokal Bereiche mit erhöhter<br />
Gasdichte entstehen lassen, in denen sich feste Partikel<br />
ansammeln können. Anders Johansen, Hubert Klahr und<br />
Thomas Henning gingen diesem Phänomen im Jahre<br />
2006 mit umfangreichen Computersimulationen nach<br />
und konnten es bestätigen (s. <strong>Jahresbericht</strong> 2006, Kap.<br />
III.2). Können diese Hochdruckwirbel die Geburtsstätten<br />
der Planetesimale sein?