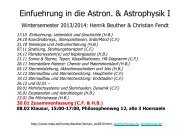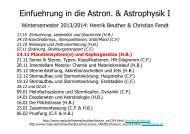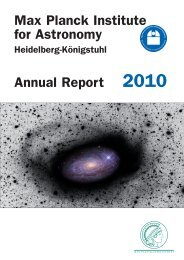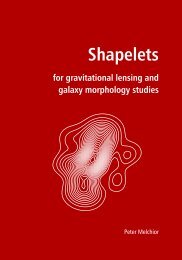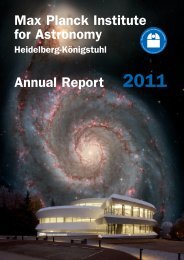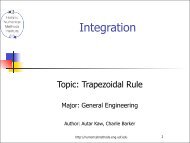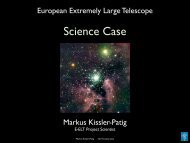Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8 I. Allgemeines<br />
te rungs teleskope – das sind Teleskope möglichst gro ßer<br />
Öff nung, um möglichst viele Photonen der schwächsten<br />
Licht quellen zu sammeln, und interferometrische Tech niken,<br />
um die höchstmögliche räumliche Auflösung zu erreichen.<br />
Für umfassende Studien der Galaxienentwick lung<br />
sind Beobachtungen in allen Spektralbereichen, vom Radio-<br />
bis hin zum Röntgenbereich, erforderlich.<br />
Das MPIA war ein bedeutender Partner bei mehreren<br />
Durchmusterungen, die einen Durchbruch versprechen<br />
oder dies bereits geleistet haben: der Sloan Di gital<br />
Sky Survey (SDSS) zur Untersuchung des Milchstra<br />
ßensystems und der Lokalen Gruppe, sowie dessen<br />
Nach fol geprojekt PansTa r r s 1 ab dem Jahre 2008,<br />
ergänzt durch die im Berichtsjahr in Betrieb genommenen<br />
LBC-Ka meras am LBT; das 2.2-m-Teleskop<br />
auf La Silla machte die Durchmusterug co m b o -17 zur<br />
Entwicklung von Galaxien möglich; die Instrumente ir a c<br />
und miPs am Weltraumteleskop sP i T z e r; und (ab dem<br />
Start im Jahr 2009) das Instrument Pa c s der he r s c h e L-<br />
Mission <strong>für</strong> Untersuchungen zur Sternentstehung und<br />
des Interstellaren Mediums, ergänzt durch das VLA, das<br />
Interferometer auf dem Plateau de Bure, aP e x und bald<br />
auch aL m a im Radio- und Submillimeterwellen-Bereich.<br />
Die Abteilung »Galaxien und Kosmologie« betreibt<br />
wahr lich Astrophysik bei multiplen Wellenlängen.<br />
Entstehung von Sternen und Planeten<br />
Die Entstehung von Sternen ist ein fundamentaler Prozess<br />
im Universum. Sie bestimmt die Struktur und die<br />
chemische Zusammensetzung ganzer Galaxien. Die<br />
Entstehung einzelner Sterne lässt sich am besten in den<br />
nahen Molekülwolken unserer Galaxis studieren. Die<br />
Untersuchung der Sternentstehung in anderen Ga la xien<br />
zeigt uns den Ablauf dieses Prozesses unter Be din gungen,<br />
die von denen in unserer Galaxis sehr ver schie den<br />
sein können. Unsere Untersuchungen in den Ma gel lanschen<br />
Wolken zeigen, wie die Häufigkeiten der schweren<br />
Elemente (der sogenannten »Metalle«) den Stern entste<br />
hungs prozess beeinflussen – dieser Faktor spielte bei<br />
der Sternentstehung im frühen Universum gewiss eine<br />
be deutende Rolle.<br />
Sterne entstehen in den dichten und kalten Kernen<br />
von Molekülwolken, die gravitationsinstabil werden<br />
und im Allgemeinen in Fragmente zerfallen, aus denen<br />
Dop pel- und Mehrfachsysteme entstehen. In welcher<br />
Wei se Magnetfelder und Turbulenzen das Einsetzen der<br />
Stern entstehung beeinflussen, ist eine der zentralen of fenen<br />
Fragen, die es zu beantworten gilt. Sie hängt direkt<br />
mit der unterschiedlichen Form der anfänglichen (sub)<br />
stellaren Massenfunktion in unterschiedlichen Um gebungen<br />
zusammen. Dynamische Wechselwirkungen in<br />
Mehrfachsystemen spielen möglicherweise eine entscheiden<br />
de Rolle bei der Entstehung Brauner Zwerge. Die<br />
Ent stehung massereicher Sterne geschieht in Sternhaufen<br />
und führt zu komplexen Sternentstehungsgebieten. Die<br />
schnel le Entwicklung massereicher Protosterne und die<br />
damit verbundenen energiereichen Phänomene erschweren<br />
die Identifikation der Entstehungswege massereicher<br />
Sterne erheblich.<br />
Die frühesten Phasen der Sternentstehung sind hinter<br />
enormen Mengen von Staub und Gas verborgen und können<br />
nur mittels empfindlicher Beobachtungen im fernen<br />
Infrarot und im (Sub-)Millimeterwellenbereich untersucht<br />
werden. In späteren Entwicklungsstadien leuchten<br />
die Objekte im mittleren und nahen Infrarot, und schließlich<br />
werden sie im optischen Spektralbereich sichtbar.<br />
Deshalb überdecken unsere Beobachtungsprogramme<br />
einen weiten Wellenlängenbereich, mit besonderem<br />
Schwerpunkt im Infraroten und bei (Sub-)Millimeterwellen.<br />
Die Entstehung von Planeten und Planetensystemen<br />
ist ein natürliches Nebenprodukt der Entstehung massearmer<br />
Sterne. Aufgrund der Drehimpulserhaltung<br />
geschieht die Akkretion von Materie auf den zentralen<br />
Protostern hauptsächlich aus einer zirkumstellaren<br />
Scheibe. Scheiben um T-Tauri-Sterne sind die natürlichen<br />
Geburtsstätten von Planetensystemen, ähnlich<br />
dem Sonnensystem vor 4.5 Milliarden Jahren. Während<br />
der aktiven Akkretionsphase werden bipolare molekulare<br />
Ausflüsse und ionisierte Jets erzeugt, die ihrerseits<br />
<strong>für</strong> die Entwicklung der Stern-Scheiben-Systeme eine<br />
wichtige Rolle spielen. Wir beginnen gegenwärtig damit,<br />
protoplanetare Scheiben als Labors zu nutzen, in<br />
denen wir die Bildung unseres Sonnensystems und der<br />
vielfältigen anderen bisher entdeckten Planetensysteme<br />
untersuchen können.<br />
Die Forschung der Abteilung Planeten- und Sternentstehung<br />
konzentriert sich auf die Entschlüsselung<br />
der frühesten Phasen der Sterne, sowohl am oberen<br />
als auch am unteren Ende des Massenspektrums. Beob<br />
ach tun gen mit Hilfe von Weltraumobservatorien<br />
wie iso und sPi T z e r, wie auch an erdgebundenen Infrarot-<br />
und (Sub-)Millimeter-Teleskopen erlauben den<br />
Nachweis und die Charakterisierung massereicher Protosterne<br />
und ihrer Entwicklung. Mit der energischen<br />
Nutzung der Submillimeter-Observatorien bereitet sich<br />
die Abteilung auf die Nutzung des Atacama Large<br />
Millimeter Array (aLm a ) vor, das demnächst in Betrieb<br />
gehen wird.<br />
Die Untersuchung Brauner Zwerge, die erstmals<br />
1995 entdeckt wurden, ist ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet.<br />
Wie entstehen Braune Zwerge? Sind auch<br />
substellare junge Objekte von Staub- und Gasscheiben<br />
umgeben? Wie oft kommen sie in Doppelsystemen vor,<br />
und wie lässt sich ihre Masse genau bestimmen? Wie<br />
setzt sich ihre Atmosphäre zusammen? Dies sind einige<br />
der brennenden Fragen, mit denen sich die Forscher am<br />
MPIA befassen.<br />
Mit der Entdeckung der ersten extrasolaren Planeten<br />
im Jahre 1995 trat die Erforschung der Planetenentstehung<br />
in protoplanetaren Scheiben in eine neue Phase<br />
stürmischer Entwicklung ein. Die Abteilung ist gut ge-