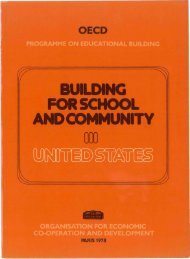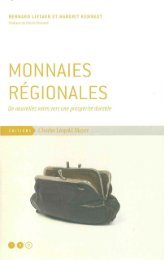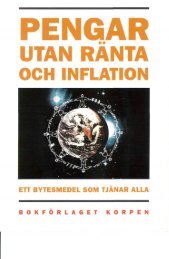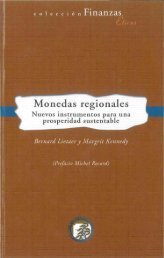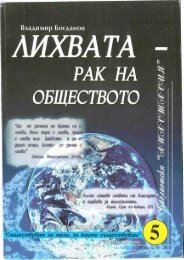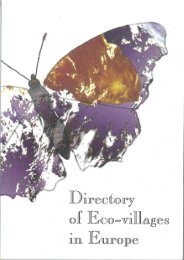Öko-Stadt Bandl - Kennedy Bibliothek
Öko-Stadt Bandl - Kennedy Bibliothek
Öko-Stadt Bandl - Kennedy Bibliothek
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Öko</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
Prinzipien<br />
einer <strong>Stadt</strong>ökologie.<br />
Materialien<br />
zur Internationalen<br />
Bauausstellung<br />
Berlin (IBA).<br />
Herausgegeben<br />
von Margrit <strong>Kennedy</strong><br />
<strong>Bandl</strong>
BRENNPUNKTE<br />
<strong>Öko</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
Prinzipien einer <strong>Stadt</strong>ökologie<br />
Materialien zur Internationalen<br />
Bauausstellung Berlin (IBA)<br />
Band 1<br />
Herausgegeben<br />
von Margrit <strong>Kennedy</strong><br />
Fischer<br />
Taschenbuch<br />
Verlag
fischer alternativ<br />
Eine Reihe des Fischer Taschenbuch Verlages<br />
Herausgegeben von Rudolf Brun<br />
7.-8. Tausend: Januar 1986<br />
Originalausgabe<br />
Veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag GmbH,<br />
Frankfurt am Main, Oktober 1984<br />
Umschlagentwurf: Peter Hajnoczky, Zürich<br />
© Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1984<br />
Satz: Fotosatz Otto Gutfreund, Darmstadt<br />
Druck und Bindung: Glausen & Bosse, Leck<br />
Printed in Germany<br />
880-ISBN-3-596-24096-4
Inhalt<br />
Frederic Vester<br />
Bernd Lötsch<br />
Friedensreich<br />
Hundertwasser<br />
Helmut Creutz<br />
Gustav Hämer<br />
Per Krusche<br />
Florentin Krause<br />
Willi Mauer<br />
Werner Schenkel<br />
Gabriele Güterbock<br />
Bensu Hubert<br />
Franz Rottkord<br />
Günter Axt<br />
Peter Thomas<br />
Margrit <strong>Kennedy</strong><br />
Erster Band: <strong>Öko</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
Prinzipien einer <strong>Stadt</strong>ökologie<br />
Vorwort<br />
Grundlagen<br />
Vernetzte Systeme<br />
Was ist <strong>Stadt</strong>ökologie?<br />
Humanisierung der städtischen Umwelt -<br />
die Kehrtwendung<br />
<strong>Öko</strong>logie und <strong>Öko</strong>nomie<br />
Zum Beispiel Berlin-Kreuzberg<br />
Energie-, Material- und Wasserhaushalt<br />
Maßnahmen zur ökologischen <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
Die bundesdeutsche Bausubstanz - ein Energiefaß<br />
ohne Boden<br />
Energiekonzept im Rahmen der behutsamen<br />
<strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
Materialhaushalt und Abfallrecycling<br />
Recycling von Haushaltsabfällen in Berlin-<br />
Kreuzberg - ein Versuch<br />
Wassersparende Maßnahmen im Haushaltsbereich<br />
Neue Sanitär- und Wasserrecyclingtechniken<br />
in IBA-Projekten<br />
Zwischenbilanz<br />
<strong>Öko</strong>logisch Planen und Bauen im Rahmen<br />
der Internationalen Bauausstellung<br />
Die Autoren<br />
5<br />
9<br />
23<br />
56<br />
61<br />
75<br />
83<br />
98<br />
103<br />
131<br />
138<br />
142<br />
147<br />
161<br />
169
Margrit <strong>Kennedy</strong><br />
Ger Londo<br />
Inge Maass<br />
Hermann Barges<br />
Martin Küenzlen<br />
Margrit <strong>Kennedy</strong><br />
Bengt Warne<br />
Jo Glässel/Bengt Warne<br />
Frei Otto<br />
Frei Otto<br />
EkhartHahn<br />
Zweiter Band: <strong>Öko</strong>-<strong>Stadt</strong><br />
Mit der Natur die <strong>Stadt</strong> planen<br />
(Siehe Band 2, Nr. 4097)<br />
<strong>Öko</strong>logisches Bauen - Planungskriterien<br />
Planungskriterien für ökologisches Bauen und<br />
Strategie zur Umsetzung ökologischer Projekte<br />
Grün- und Freiraumplanung<br />
Naturgärten in der(<strong>Stadt</strong><br />
<strong>Öko</strong>logie und Geschichte in der Südlichen<br />
Friedrichstadt<br />
Erfahrungen und Ideen zur Begrünung in<br />
Kreuzberg<br />
Vernetzte Projekte<br />
Was hat Oekotop nr Kreuzberg vor?<br />
<strong>Öko</strong>logische Maßnahmen im Frauenstadtteilzentrum<br />
in Berlin-Kreuzberg<br />
Das Naturhuset<br />
Ein Naturhaus für Berlin<br />
Das Baumhaus am Tiergarten<br />
Ergebnisse und Konflikte<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
<strong>Öko</strong>logischer <strong>Stadt</strong>umbau: Idealistischer<br />
Zukunftstraum oder Notwendigkeit?<br />
Die Autoren<br />
7<br />
19<br />
26<br />
39<br />
61<br />
79<br />
91<br />
103<br />
111<br />
119<br />
129<br />
144
Vorwort<br />
Diese beiden Bände entstanden im Rahmen der Vorbereitungen zur<br />
Internationalen Bauausstellung (IBA) Berlin 1987 im Forschungsbereich<br />
<strong>Öko</strong>logie/Energie. Sie dokumentieren eine Entwicklung vom umfassenden<br />
theoretischen Ansatz, wie er beim ersten <strong>Öko</strong>logiesymposium<br />
der IBA in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt 1980 z.B. von<br />
Frederic Vester, Bernd Lötsch, Friedensreich Hundertwasser, Per Krusche<br />
u.a. dargestellt wurde, zur teilweisen Realisierung in der Praxis,<br />
wie sie sich in Projekten und übergreifenden Ansätzen z.B. zur Heizenergieversorgung<br />
und zum Abfallrecycling 1984 darstellt.<br />
Als die Bauausstellung GmbH 1979 ihre Arbeit aufnahm, war der<br />
Begriff »<strong>Öko</strong>logie« im Bewußtsein von Planern und Architekten noch<br />
weitgehend identisch mit dem, was wir heute als Grün- und Freiraumplanung<br />
bezeichnen. Inzwischen zeichnet sich durch Krisen in allen<br />
Bereichen, die unsere biologischen Grundbedürfnisse betreffen, ein<br />
Wandel ab, und dieser spiegelt sich auch in der Arbeit der IBA wider.<br />
Zur <strong>Öko</strong>logie als »Haushaltslehre« gehört heute ebenso der behutsame<br />
Umgang mit gewachsenen Sozialstrukturen und mit bestehendem<br />
Wohnraum, wie mit Trinkwasser und Energie, mit Grund, Boden und<br />
Luft - Ressourcen, die nicht beliebig vermehrbar sind und von allen<br />
benötigt werden.<br />
In einer Art Zwischenbilanz wird versucht aufzuzeigen, wo die<br />
Schwierigkeiten bei der Umsetzung ökologischer Ansätze in hochverdichteten<br />
Innenstadtgebieten liegen, aber auch, welche Möglichkeiten<br />
heute schon bestehen, einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen<br />
in die Wege zu leiten.<br />
(Siehe auch Zwischenbilanz S. 159ff.)<br />
Das Hauptanliegen der <strong>Stadt</strong>ökologie ist die Frage, wie eine dichte<br />
<strong>Stadt</strong>struktur mit wahrhaft menschlichen Lebensbedingungen zu vereinbaren<br />
ist. Zur Klärung dieser Frage will die IBA 1987 in Theorie und<br />
Praxis einen Beitrag leisten.<br />
Außer den hier vertretenen Autoren haben natürlich viele andere<br />
Fachleute, Betroffene und Kollegen Beiträge geleistet zu dem, was<br />
heute an ökologischen Grundlagen und Ideen in der IBA existiert.
Ihnen allen möchte ich hiermit meinen herzlichen Dank für ihr Engagement<br />
und ihre Hilfestellung aussprechen. Ein besonderer Dank aber<br />
gebührt den Organisatorinnen der zwei Fachtagungen der IBA, deren<br />
Dokumentationen die Grundlage für dieses Buch bilden: Yvonne Hörn<br />
für ihren Einsatz beim ersten <strong>Öko</strong>logiesymposium der IBÄ im Herbst<br />
1980 und Gabi Morr und Monika Zimmermann vom Institut für <strong>Stadt</strong>forschung<br />
beim zweiten <strong>Öko</strong>logieworkshop der IBA 1983. Ohne ihre<br />
Hilfe hätte dieses Buch nicht entstehen können. ,<br />
Berlin, im April 1984 Margrit <strong>Kennedy</strong>
Grundlagen
Frederic Vester<br />
Vernetzte Systeme<br />
Wenn man sich mit Systemen beschäftigt, dann muß man zwangsweise<br />
die Orientierung in seinem eigenen Fachgebiet radikal ändern. Man darf<br />
nicht mehr in dieses Fach hineinschauen - mit dem Rücken zur Welt,<br />
sondern man muß aus ihm hinausschauen. Das erklärt auch, wieso ich<br />
mich als Biochemiker auf der einen Seite mit Systemforschung, Umweltfragen<br />
und Landesplanung beschäftige, und dann wieder mit Zellvorgängen,<br />
Lernbiologie und psychosomatischen Vorgängen, wie etwa dem<br />
Streßmechanismus; ganz im Sinne meiner nun seit 5 Jahren laufenden<br />
Wanderausstellung: »Unsere Welt - ein vernetztes System«. Es ist dann<br />
weniger ein Gebiet, auf das man sich spezialisiert, als vielmehr ein<br />
bestimmter Ansatz, mit dem im Grunde jedes Gebiet bearbeitet werden<br />
kann.<br />
Im Falle meiner Studien ist es der Ansatz der Systembetrachtung<br />
selbst, der vor allem auf das Wechselspiel zwischen den Dingen achtet<br />
und der mit Hilfe der Biokybernetik Systemvorgänge zu analysieren<br />
versucht und dabei zwangsweise Fachbereiche überschreitet. Dabei<br />
haben wir sehr bald eine eigenartige Feststellung gemacht, nämlich, daß<br />
es offenbar nicht nur Naturgesetze gibt, die die Dinge selbst betreffen,<br />
wie die Physik und Chemie von Werkstoffen oder wie die Statik eines<br />
Gebäudes oder die Funktionsweise eines Kraftwerkes, sondern, daß es<br />
auch Gesetzmäßigkeiten geben muß - sozusagen Systemgesetze -, die<br />
sich immer wieder der wissenschaftlichen Betrachtung entzogen haben,<br />
weil sie ausschließlich das Geschehen zwischen den Dingen betreffen.<br />
Damit liegen sie automatisch auch zwischen den Fakultäten, sprengen,<br />
die Fachbereiche und werden kaum erforscht. Man kann sie nicht<br />
zuordnen! Das Geschehen ist ja relativ unabhängig von der Art der<br />
Dinge selbst, dafür um so abhängiger von ihren Wechselwirkungen.<br />
Sobald verschiedene, bisher getrennte Elemente zusammenkommen<br />
und eine organisierte Struktur, also ein System bilden, kommen zu den<br />
wohlbekannten Gesetzen der Einzelelemente auf einmal jene Systemgesetze<br />
hinzu und fangen an zu arbeiten. Sie sind es, die dann auf einmal<br />
weit mehr als die bekannten Kausalgesetze die zukünftige Entwicklung<br />
des Systems bestimmen: zum Beispiel seine Wachstumstendenz, seine
Innen- und Außenabhängigkeit oder seine Störanfälligkeit, kurz sein<br />
Verhalten,<br />
Von diesem biokybernetischen Ansatz ausgehend untersucht meine<br />
Studiengruppe daher sowohl das Verhalten von Systemen auf bestimmte<br />
Eingriffe hin, als auch das Verhalten einzelner Technologien und Organisationsformen<br />
in Systemen. Wir orientieren uns dabei an den zunächst<br />
phänomenologisch erfaßten Gesetzmäßigkeiten des einzigen lebensfähigen<br />
Systems, das es auf diesem Planeten gibt, also des biologischen, von<br />
dem wir auch ein Teil sind. Und weil dieses System mit uns eine<br />
lebensfähige Einheit bildet und deshalb entsprechend auf uns zurückwirkt,<br />
ist es für die Gestaltung unserer Umwelt unumgänglich, dieses<br />
System tiefer zu verstehen. Gerade im Hinblick auf eine solche Rückwirkung<br />
hat sich ja in letzter Zeit einiges getan.<br />
Zunächst will ich unser bisheriges Tun einmal im Lichte dieser biokybernetischen<br />
Gesetzmäßigkeiten charakterisieren, wie sie in jedem<br />
Stück Natur beobachtet werden können. So haben wir im Laufe der<br />
Menschheitsgeschichte in einem vordergründigen Glauben an die Unbegrenztheit<br />
des technisch Machbaren ziemlich unbekümmert in das große,<br />
bis dahin gut funktionierende Globalsystem unserer Biosphäre<br />
dadurch eingegriffen, daß wir nach und nach eine immer größere Zahl<br />
künstlicher Einzelsysteme in diese Biosphäre hineingesetzt haben: Fabriken,<br />
Kraftwerke und landwirtschaftliche Großbetriebe, Siedlungen,<br />
Stauseen, Verkehrsnetze, Brücken, Häfen. Aus ehemaligen Urlandschaften<br />
wurden oft in wenigen Jahrzehnten riesige Ballungsgebiete.<br />
Alle diese Teilsysteme haben wir in die Biosphäre hineingepflanzt in<br />
der Annahme, daß sich ihr Zusammenspiel von allein regeln würde, und<br />
wenn nicht, daß entstehende Mängel sich durch weiteren technischen<br />
Einsatz und einen entsprechenden Energieinput reparieren ließen; etwa<br />
Mängel in der Luftreinhaltung, in der Bodenfruchtbarkeit, in der Energieversorgung,<br />
im Wasserhaushalt oder auch im gesundheitlichen Bereich.<br />
Im Vertrauen auf diese Reparaturmöglichkeiten haben wir uns<br />
weder darum gekümmert, ob diese künstlichen Systeme selber überlebensfähig<br />
sind, noch, ob sie mit den übrigen zu einer funktionierenden<br />
Einheit verbunden werden können.<br />
Tag für Tag starten wir weitere Entwicklungsprojekte und setzen sie in<br />
bestehende Systeme hinein, ohne überhaupt zu wissen, daß wir es mit<br />
einem System zu tun haben, geschweige denn, daß es so etwas wie<br />
Gesetzmäßigkeiten für das Verhalten und damit für das Überleben von<br />
Systemen gibt. So kommt es, daß viele, auf Kurzzeitprofit angelegte<br />
Eingriffe zunächst für die Umwelt, dann für unsere eigene Lebensqualität<br />
und im Endeffekt auch wirtschaftlich höchst problematisch wurden.<br />
Als eine der wesentlichen Ursachen für dieses Dilemma können wir<br />
die mangelnde Kenntnis der Zusammenhänge verantwortlich machen,<br />
10
wie sie in der Art unserer Ausbildung begründet ist. Die Realität, in der<br />
sich alles Leben und Wirtschaften abspielt, ist gewiß nicht das, was die<br />
Schulen und Universitäten uns gelehrt haben: ein Sammelsurium von<br />
getrennten Einzeldingen wie Agrarwirtschaft, Verkehrswesen, Chemie,<br />
Geographie und Kernphysik, Hüttenwesen, Betriebswirtschaft, Energieerzeugung<br />
und Abfallbeseitigung, geordnet nach Ressorts und Fachbereichen<br />
- und somit zu Bruchstücken auseinandergerissen -, sondern<br />
diese Realität ist in der Tat ein großes vernetztes System, das sich nach<br />
kybernetischen Gesetzmäßigkeiten verhält. Doch gerade dieses Netz ist<br />
bei unserer bisherigen Betrachtungsweise zerstört, der Systemcharakter<br />
entschlüpft unserer Betrachtung (Abb. 1). .<br />
Das Ergebnis ist entsprechend: Es treten Probleme auf, die wir nie<br />
erwartet haben (zum Beispiel steigende Krankenzahlen, trotz immer<br />
besserer medizinischer Versorgung); wir suchen nach Lösungen, die<br />
keine sein können (etwa Monostrukturen und Stützungsaktionen des<br />
Staates, die nur überholte Wirtschaftsformen zementieren, und die<br />
dann - wie etwa die Montanunion im Saarland - ganze Regionen praktisch<br />
kollabieren lassen); wir setzen Technologien ein, die sich selbst ad<br />
Abb. 1: Durch die Trennung in Fachgebiete, Ressorts und Branchen erfahren<br />
wir die Wirklichkeit als zerrissenes Netz<br />
11
absurdum führen (ich denke an die »Concorde«, an die Kernenergie<br />
oder an die Supertanker), und entwickeln Organisationsformen (wie<br />
eine wuchernde Bürokratie oder eine zunehmende Zentralisierung in<br />
der Versorgung), die an der Realität scheitern müssen.<br />
Warum? Weil diese Realität nicht ein unzusammenhängender Themenkatalog<br />
ist, sondern immer ein Netz von Rückkoppelungen und<br />
verschachtelten Regelkreisen. Ein Wirkungsgefüge, in dem Ursachen<br />
und Wirkungen verschmelzen, in dem es weit mehr auf Konstellationen<br />
und Gesamtdynamik ankommt als auf sichtbare Einzelwirkungen. Dennoch<br />
glauben wir aus simplen Hochrechnungen heraus, Prognosen stellen<br />
zu können, und wundern uns, daß sie trotz allen verwendeten<br />
Datenmaterials nicht zutreffen.<br />
Eingriffe in ein offenes dynamisches System, mit dem wir es überall zu<br />
tun haben, zeigen eben immer eine komplexe Wirkung, die sich in den<br />
wenigsten Fällen in einer direkten Ursache-Wirkung-Beziehung benachbarter<br />
Elemente äußert. Gerade Beziehungen, die auf den ersten Blick<br />
einen linearen Verlauf zeigen, ein proportionales Anwachsen, haben<br />
durch ihre Verflechtungen im Gesamtsystem oft unbemerkte Schwellwerte<br />
und Grenzwerte, durch die sich eine zunächst gleichförmige<br />
Entwicklung schlagartig, ändern kann. Viele Entwicklungen erinnern<br />
daher.an das Schießen mit Pfeil und Bogen. Wir sehen hier drei Phasen.<br />
(Abb. 2)<br />
Abb. 2: Die meisten Beziehungen zwischen den Komponenten eines Systems<br />
sind nicht-linear, haben Schwellen- und Grenzwerte - wie in diesem Beispiel von<br />
Pfeil und Bogen.<br />
12
Wenn man einen Bogen nicht spannt, kann man daher auch keinen<br />
Pfeil abschießen. Man kann den Pfeil hin und her schieben, vor einem<br />
bestimmten Schwellwert passiert nichts. Das ist die erste Phase. Sobald<br />
die Spannung diesen Schwellwert überschritten hat, fliegt der Pfeil los.<br />
Je stärker die Spannung, desto weiter fliegt er. In dieser Phase haben wir<br />
eine beinahe proportionale Beziehung. Überschreitet die Spannung<br />
einen kritischen Wert, den Grenzwert, so tritt unser System in die dritte<br />
Phase ein: Der Bogen bricht, und der Pfeil fliegt nun überhaupt nicht<br />
mehr. Fazit: wenn wir in einer ursprünglich sinnvollen Richtung ohne<br />
Beachtung des Systemzusammenhanges weitermarschieren, werden<br />
häufig die Grenzwerte überschritten, und die Entwicklung kann ins<br />
Gegenteil dessen umschlagen, was wir wollen.<br />
In der Natur reguliert sich ein stabiles System normalerweise selbst,<br />
bevor es solche Grenzwerte erreicht. Diese Selbstregulation kann man<br />
jedoch durch künstliche Energiezufuhr oder künstliche Nahrungszufuhr<br />
leicht aufheben - zum Beispiel bei einseitig geschützten Tierherden. In<br />
einem Naturschutzgebiet kann sich daher eine Elefantenherde lange<br />
Zeit ungehemmt vermehren. Das Angebot an Pflanzen reicht zunächst<br />
für alle Tiere aus. Je größer die Herde wird - in manchen Naturschutzparks<br />
gab es schon regelrechte Bevölkerungsexplosionen -, desto stärker<br />
werden die Pflanzen abgeweidet; die Vegetation nimmt exponentiell<br />
ab. Wenn einmal eine kritische Elefantenzahl überschritten ist, so ist<br />
sehr schnell der Punkt erreicht, an dem auch das letzte Akazienbäumchen<br />
abgefressen ist. Abrupt ändern sich die Verhältnisse. Die Vermehrung<br />
stoppt nicht nur, sondern die ganze Herde stirbt auf einen Schlag<br />
aus. Hätte man die Herde retten wollen, so hätte man sie vor jenem<br />
Grenzwert auf eine vernünftige Anzahl dezimieren müssen. Oder nehmen<br />
wir den menschlichen Körper: Erhöht sich seine Temperatur von 37<br />
Grad Celsius auf 40 Grad, also um 3 Grad Celsius, so ist das ein<br />
Zeichen, daß der Mensch Fieber hat und krank ist. Erhöhen wir die<br />
Temperatur um weitere drei Grad, dann ist der Mensch jedoch nicht,<br />
wie nun mancher Wirtschaftswissenschaftler haarscharf extrapolieren<br />
würde, doppelt krank, sondern er ist längst tot.<br />
In einem System kommen wir ab einem bestimmten Zeithorizont mit<br />
den gängigen Hochrechnungen niemals aus. Wir finden immer wieder<br />
Fernwirkungen, Langzeitwirkungen, Irreversibilitäten, Grenz- und<br />
Schwellübergänge, Resonanzphänomene, Paradoxien und andere nichtlineare<br />
Wirkungen höherer Ordnung. Weil es auf das Muster dieses<br />
Zusammenspiels aller Lebensbereiche ankommt und nicht nur auf das<br />
betrachtete Problem, werden die üblichen Prognosemodelle nie funktionieren.<br />
Da diese immer wieder unvollständig bleiben müssen - denn<br />
sonst müßten wir in der Detaillierung bis hinunter zum einzelnen Atom<br />
gehen -, sind Modelle der herkömmlichen Art grundsätzlich überfragt.<br />
13
So wie bei der extrapolierten Wettervorhersage, die trotz der in den<br />
letzten Jahren vorgenommenen Anreicherung des Datenmaterials durch<br />
eine Vertausendfachung der automatischen Meßstationen bei einer über<br />
24 Stunden hinausgehenden Prognose nach wie vor über statistische<br />
Zufallstreffer nicht hinauskommt.<br />
Die Art, wie wir die Wirklichkeit betrachten, benötigt also eine neue<br />
Dimension. Neben dem simplen Ursache-Wirkungs-Denken der Vergangenheit,<br />
das sich an Einzelproblemen orientiert, brauchen wir eine<br />
Hinwendung zu einem Denken in größeren Zusammenhängen - zu<br />
einem Verständnis jener komplexen Systeme, aus denen unsere Welt<br />
besteht.<br />
Wenn es um ein Erkennen des Systems geht, dann helfen uns die<br />
vordergründigen Details - so nützlich diese etwa für die Wahl der<br />
späteren Operatoren einer Strategie sind - überhaupt nicht. Im Gegenteil,<br />
je unschärfer sie werden, um so deutlicher sagt uns das Bild, was es<br />
als Ganzheit darstellt. Denn das ist durch die Vernetzung zwischen den<br />
Dingen repräsentiert. Für das Erkennen eines Systems ist also das<br />
Studium der Einzelheiten die falsche wissenschaftliche Methode. Und<br />
die wird auch dadurch nicht richtiger, daß man sie nun mit ganz<br />
besonderer Akribie betreibt. Auch die Dinge, mit denen wir uns in<br />
unserer Umwelt beschäftigen, mit denen wir unseren Lebensraum planen<br />
und unsere Technik entwickeln, müssen wir erst miteinander verbinden!<br />
Sonst wird unsere Strategie falsch, wir erfahren dazu zwar sehr viel<br />
über diese Details, aber nichts über das System und sein Verhalten.<br />
Um einige Aspekte der Bauökologie anzusprechen, soll zuerst die<br />
biologische Ebene des Baustoffes, dann die energetische Ebene und<br />
schließlich die Ebene des Materials selbst und seiner Herstellung betrachtet<br />
werden. Zunächst zur Biologie. Ob wir Häuser bauen, Papier<br />
oder Stoffe herstellen, Boden urbar machen, Verkehrswege einrichten<br />
oder Handel treiben; die verwendeten Techniken dienen immer dazu,<br />
uns von dem Zwang einer bestimmten Umwelt zu befreien. In meinem<br />
Buch »Phänomen Streß« habe ich schon einmal deutlich gemacht, daß<br />
dieses Benutzen von Technologie ja keineswegs gegen diese Umwelt<br />
oder gar gegen die Natur geschehen muß, im Gegenteil.Technik kann<br />
durchaus mit der Natur vereinbar sein. Die Natur ist eigentlich derjenige<br />
Bereich auf der Welt, in dem Technik ursprünglich zu Hause ist.<br />
Druckverteilung und Bogenärchitektur bei den Knochen, Hohlraumstatik<br />
und Dachkonstruktionen bei Diatomen oder Radiolarien, chemische<br />
Fabriken in Bakteriengröße wie die Mitochondrien im Innern<br />
unserer Zellen oder winzige Sonnenkraftwerke wie bei den Choroplasten,<br />
kodifizierte Regel techniken in den Nervenzellen des menschlichen<br />
Kleinhirns, das die motorischen Bewegungen kontrolliert, oder akustische<br />
Peilantennen bei der Stechmücke, all das funktionierte natürlich<br />
14
Abb. 3: Statik biologischer<br />
Formen als ergiebiges Vorbild<br />
alter und neuer Bauweisen.<br />
schon lange vor unserem Auftauchen in der Welt des Lebendigen und ist<br />
echte Technik.<br />
Biologische und technische Strukturen sind direkt vergleichbar<br />
(Abb. 3). Daraus ist übrigens der Forschungszweig der Bionik entstanden,<br />
die mit großem Erfolg begonnen hat, die Natur systematisch nach übertragbaren<br />
Techniken zu durchforsten - auch im Bauwesen. So erkennen<br />
z.B. unsere Gehirnzellen in allen biologischen Formen die vertrauten<br />
Prinzipien wieder, die ihnen selbst innewohnen. Denn diese Prinzipien<br />
sprechen sozusagen den gleichen universellen Code. Es entsteht Resonanz<br />
mit den eigenen Mustern, mit den Archetypen der uns innewohnenden<br />
biologischen Struktur. Und diese Resonanz erzeugt Vertrautheit,<br />
Sicherheit, Geborgensein. Ein typisches Gestalt-Phänomen der<br />
Biologie ist hier zum Beispiel eine leichte Unregelmäßigkeit in der<br />
Regelmäßigkeit, wie wir sie schon bei jedem gezahnten Blättchen finden<br />
(Abb. 4).<br />
Aufgrund dieser Resonanz, die sich mit unserer eigenen Struktur<br />
15
Abb. 4: Unregelmäßigkeit in der Regelmäßigkeit: biologisches Grundprinzip in<br />
. jedem Blatt.<br />
abspielt, empfinden wir einen Stoff wohliger als eine glatte Fläche, und<br />
einen handgeknüpften Teppich mit seinen Unregelmäßigkeiten wiederum<br />
heimeliger als einen maschinengewebten. Auch manche organischen<br />
Dinge, wie Ziegel, zeigen das gleiche Prinzip. Obgleich der Ziegel gar<br />
nicht biologischen Ursprungs ist, zeigt er diese Unregelmäßigkeit in<br />
Poren, Farbe und in Form des einzelnen Bausteins. Wenn dieses Prinzip<br />
bereits im Baustoff sitzt, überträgt sich das oft auch automatisch auf<br />
größere Dimensionen. Sei es das Dächerspiel von Rothenburg, oder sei<br />
es die Struktur einer ganzen Siedlung, zum Beispiel gewisser Eingeborenendörfer<br />
in Mali. Es ist die gleiche Unregelmäßigkeit in der Regelmäßigkeit,<br />
wie sie auch menschliche Zellgewebe zeigen. Ein anderes<br />
Beispiel ist die leicht unterschiedliche Neigung der Häuser in den<br />
Amsterdamer Grachten oder die Fassadenkulissen von St. Tropez.<br />
Überall registriert unser Gehirn eine gewisse biologische Geborgenheit.<br />
Das nur zur Illustration eines einzigen von einer ganzen Reihe von<br />
Bioprinzipien, wo wir eine kreatürliche Verwandtschaft spüren, wie sie<br />
in Betonsilos keineswegs gefunden wird.<br />
In diesem Zusammenhang ist es gar nicht merkwürdig, daß die<br />
Steinwüste von Manhattan oft weniger schlimm wirkt als etwa das<br />
Kaufhofgebäude am Münchner Marienplatz: Nun, die Straßen von<br />
Manhattan haben ein interessantes Merkmal. Beton ist hier fast fremd.<br />
16
Abb. 5: Beton ist hier<br />
fremd. Durch Ornamentik<br />
sind die Gebäude in Manhattan<br />
oft weniger bedrükkend<br />
als manchmal nur<br />
vierstöckige Kaufhausneubauten<br />
in unseren<br />
Kleinstädten.<br />
Abb. 6: Verfrachtet man<br />
die Bewohner von Slums,<br />
wo das Glück im Kleinen,<br />
im biologisch Vertrauten<br />
liegt, in die Monostruktur<br />
von Wohnsilos, so zerbricht<br />
oft irreversibel die eingespielte<br />
Sozialstruktur und<br />
muß durch Reglementierung<br />
ersetzt werden.<br />
17
Das ermöglicht zumindest bei den Fassaden ein wenig von jenem<br />
ornamentalen, unregelmäßigen biologischen Rhythmus in der Struktur,<br />
und zwar selbst an den Wänden von Industriegebäuden oder auch schon<br />
bei einfachen gemauerten Dachgeschossen (Abb. 5 und 6).<br />
Hiermit wird die Umweltpsychologie angesprochen, ein Gebiet, das<br />
mithelfen kann, manchen Tiefpunkt unseres Siedlungsbaues zu überwinden.<br />
Das Institut für Grundlagen der modernen Architektur in Stuttgart,<br />
das Institut für Baubiologie in Rosenheim, das Institut für Umwelthygiene<br />
der Universität Wien und andere befassen sich seit einiger Zeit<br />
mit der Tatsache, daß die gebaute Umwelt Psyche und Verhalten des<br />
Menschen konkret beeinflußt und daß es sich daher lohnt, nicht einfach<br />
die vordergründig kostengünstigere Lösung, sondern eben die sinnvollere<br />
zu wählen. Auf diesem Gebiet wird aber immer noch von den meisten<br />
Planern weder die Streßwirkung der Isolation noch die Streßwirkung<br />
bei zu großer Dichte berücksichtigt. Wir alle wissen jedoch, daß der<br />
Stand unseres Wissens längst ausreichen würde, die Bauqualität grundlegend<br />
zu verbessern, wenn solche Planungen eben nicht nur von<br />
Architekten, nicht nur von Städtebauern oder Verkehrsplanern, sondern<br />
immer auch gemeinsam mit Biologen und <strong>Öko</strong>logen durchgeführt<br />
würden, durch ein interdisziplinäres Vorgehen, das sich am Standort<br />
selbst orientiert.<br />
Was die Einwirkung der Bauweise auf den menschlichen Organismus<br />
betrifft, so war es wohl vor allem die Unkenntnis der biologischen<br />
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Baustoff, die es zu mancher<br />
Pervertierung unserer heutigen Bauweise kommen ließ, sowohl in der<br />
Architektur als auch in der Wahl des Materials. Weder die Wirkung des<br />
irdischen Gleichfeldes auf die körpereigene Abwehrkraft, auf Schlaf<br />
und Ermüdung, noch die statischen Effekte auf die Leitfähigkeit der<br />
Haut, auf Pulsfrequenz und Atmung, noch die Erkrankungen durch<br />
Kunststoff-Lösungsmittel und Weichmacher, noch die Wirkung auf den<br />
körperlichen Wärmehaushalt werden beachtet. Priorität hat das Design.<br />
Die Architekturausbildung fabrizierte vielfach Modezeichner mit etwas<br />
aufgesetzter Sozialtheorie und Fertigungskalkulation, statt wirkliche<br />
Baumeister. Jahrelang war z.B. der Ziegel in den Architekturwettbewerben<br />
unter den Designern und in der Baufachpresse verschwunden.<br />
Wer sich nicht dem Vorwurf mangelnden Fortschrittglaubens aussetzen<br />
wollte, so hieß es in der Presse, der experimentierte mit neuen Baustoffen:<br />
Beton, Kunststoffen, Aluminium, Glas, Fertigbausystemen. Wer<br />
wußte auch schon, daß atmende Ziegelmauern und rohe Holzdecken<br />
ganz erheblich die unerfreuliche elektrostatische Aufladung herabsetzen<br />
können, die heute in den Stahlbetonbauten mit Kunststoffbelägen an<br />
der Tagesordnung ist bzw. nur durch eine aufwendige Klimaanlage<br />
verhindert werden kann.<br />
18
Das Stichwort Klimaanlage führt uns auf ein besonders klägliches<br />
Gebiet der Bauwirtschaft, das der Energie. Nach den Berechnungen von<br />
Klima-Architekten werden in unseren Behausungen jährlich 20 bis 30<br />
Milliarden Mark sinnlos verheizt. Sie alle kennen diese Infrarotaufnahmen,<br />
wo die hellen Farben die Wärmelecks zeigen. Alle Versuche, durch<br />
hermetische Innenisolierung das Problem in den Griff zu bekommen,<br />
gehen, trotz der dadurch bereits gesparten Heizkosten, an der eigentlichen<br />
Lösung immer noch vorbei. Nämlich an einer von vorneherein<br />
kybernetischen, also sich selbst steuernden Klimatisierung durch die<br />
entsprechende Bauweise.<br />
Eine kybernetische Klimatisierung steuert nämlich die Sonneneinstrahlung,<br />
den Wärmeaustausch, die Lüftung und das Tageslicht lediglich<br />
durch eine abgestimmte Kombination der verschiedenen Wirkungen.<br />
Und zwar wird die Ausstrahlung und der nächtliche Temperaturabfall<br />
zur Abkühlung, die Sonneneinstrahlung zur Erwärmung benutzt,<br />
der Temperaturunterschied der einzelnen Gebäudeteile und die damit<br />
zusammenhängenden Luftdruckunterschiede, und damit Luftbewegungen,<br />
werden zur Lüftung benutzt. Ohne Motor, ohne Apparat. Sonnenstand,<br />
Jahreszeit, Wind und Himmelsrichtung, Veränderung der Luftfeuchtigkeit,<br />
Außenanstrich, Flächenneigung, all das zusammen wird<br />
also in ein gemeinsames Regelsystem integriert. Dabei stellt sich dann<br />
heraus, daß die Speicherkapazität von Wänden mindestens ebenso<br />
wichtig ist wie ihre heute schon fast ausschließlich herangezogenen<br />
K-Werte für die Wärmedämmung. Auf diese Weise lassen sich, selbst<br />
unter tropischer Sonne, Häuser aus Blechen bauen. Häuser, die, statt zu<br />
einem Brutofen zu werden, ohne jegliche Klimaanlage angenehmer<br />
klimatisieren als klassische Hauskonstruktionen mit noch so gut isolierten<br />
Baustoffen. Hier läuft kein Apparat und trotzdem weht immer ein<br />
Wind, selbst bei völliger Windstille - lediglich durch die intelligente<br />
Anordnung der Bauelemente (Abb, 7).<br />
All dies sind kybernetische Konstruktionswege, die Sonnenenergie<br />
und ihre Folgeenergien beträchtlich nutzen, anstatt unter zusätzlichem<br />
Energieaufwand ständig gegen sie zu kämpfen. Sie zeigen einen Umschwung<br />
in unserem Denken: von der Boxermentalität, die vorhandene<br />
Kräfte auf Null bringt und dann erst mit weiterer eigener Kraft das<br />
erreicht, was sie will, auf das Prinzip des Jiu-Jitsu, das letzten Endes von<br />
den Buddhisten erfunden wurde. Das geschah zu einer Zeit, wo sie der<br />
Gewalt entsagt hatten, aber ständig von Räuberhorden überfallen wurden.<br />
Die Frage war, wie sie sich wehren könnten, ohne Gewalt anzuwenden.<br />
Da kamen sie auf die grandiose Idee, auf die die Natur schon<br />
immer gekommen war, die ohnehin vorhandene Kraft des Gegners zu<br />
nutzen. Die haben sie leicht umgelenkt, durch minimale Steuerenergie -<br />
und er fiel mit seinem eigenen Schwung auf die Nase. Dieses Prinzip<br />
19
Abb. 7: Dieser Bungalow aus Stahlblech im tropischen Konakry wurde nach<br />
kybernetischen Berechnungen des Ingenieurs R. Ayoub gebaut. Statt zum Brutofen<br />
zu werden, ist er - ohne jede Klimaanlage - angenehmer klimatisiert als<br />
klassische Hauskonstruktionen mit noch so guter Isolierung.<br />
können wir auch in der Architektur verwirklichen, indem wir vorhandene<br />
Energien nutzen, statt gegen sie zu kämpfen. Ein kybernetisches<br />
Prinzip der Natur. Die Abbildung zeigt ein Spielmodell aus meiner<br />
Ausstellung, noch ein bißchen futuristisch, in dem solche Möglichkeiten<br />
angedeutet sind. Ein kybernetisches Haus, dessen Einzelelemente jedoch<br />
alle irgendwo existieren und funktionieren, nur vielleicht noch<br />
nicht in diesem Zusammenhang (Abb. 8).<br />
Aber auch der Baustoff selbst kann bekanntlich schon energiesparend<br />
sein, und damit komme ich zum dritten Aspekt. Vor einiger Zeit hat die<br />
amerikanische Zeitschrift Science über einen interessanten Versuch<br />
berichtet: von zwei sonst identischen Häusern, von denen das eine 10%<br />
mehr Energie im aufwendigen Baumaterial stecken hatte. Bei diesem<br />
Haus mit seinem einmaligen Energiebedarf von 17 Millionen Einheiten<br />
stand eine Einsparung an Heizkosten von Jahr zu Jahr 25 Millionen<br />
Einheiten gegenüber. Ein ganz wesentliches, kritisches Experiment, was<br />
lange gefehlt hat, weil die Tatsache einer so günstigen Energiebilanz<br />
immer angezweifelt wurde - allerdings nur, wenn das richtige Baumaterial<br />
verwendet würde.<br />
Die Unterschiede in den Energiekosten der Herstellung sind in der<br />
Tat gewaltig (Tab. 1). Das untere Ende dieser Skala kann jedoch<br />
20
Abb. 8: Spielmodell eines<br />
kybernetischen Hauses mit<br />
einer schon heute möglichenEnergieverbundlösung<br />
(aus der Wanderausstellung<br />
»Unsere Welt - ein<br />
vernetztes System«, Katalog<br />
erschienen bei Klett-<br />
Cotta).<br />
Tab. 1. Energieverbrauch zur Herstellung einiger Baustoffe<br />
Durchschnittswerte in KWh/kg<br />
Aluminium<br />
Plastik<br />
Stahlblech<br />
Glas<br />
Beton<br />
Ziegel<br />
Holz<br />
50<br />
30<br />
15<br />
5<br />
3<br />
1<br />
0,1<br />
beliebig erweitert werden. Durch Recyclingglas und Bergbauraum,<br />
durch Flugasche, Müllschlacke, Hochofenschlacke, Rotschlammschwefel<br />
usw., ja selbst durch Altpapier, kompostierte Exkremente, Rückstände<br />
aus Biogasanlagen, um nur einige Typen von Material zu nennen,<br />
21
das reichhaltig vorhanden ist und sonst nicht verwertet wird, z.B. Inert-<br />
Material, für welches bereits kommerziell erprobte Verfahren zur<br />
Bausteinherstellung existieren. Wir haben diese reichhaltige Skala energiearmer<br />
Baustoffe noch nicht annähernd ausgeschöpft, obwohl damit<br />
sogar gleichzeitig Abfallprobleme gelöst würden. In den hier kurz<br />
angedeuteten und gar nicht einmal besonders futurologischen Wegen<br />
liegen außerdem eine Reihe ungeahnter Möglichkeiten, um auch zu<br />
gesunden, menschengerechten, ökologischen und energiesparenden<br />
Baustoffen zu kommen. Baustoffe, die der Eintönigkeit entgegenwirken<br />
und der Architektur keine Zwänge auferlegen. Und wenn solche Funktionen<br />
erfüllt sind, sollte es gleich sein, mit welchen Ausgangsmaterialien<br />
das bewerkstelligt wird.<br />
Aus Platzgründen kann ich nur ein sehr gerafftes Streiflicht geben und<br />
ein wenig andeuten, wie gerade in der Baubranche die Zukunft erst<br />
begonnen hat. An den wenigen Beispielen erkennt man aber vielleicht<br />
schon, wie wichtig es nicht nur in der <strong>Stadt</strong>entwicklung, sondern auch<br />
beim Bauen selbst ist, in die Kybernetik eines solchen Zusammenspieles<br />
einzudringen. Wie wichtig es ist, den daraus entspringenden Möglichkeiten<br />
aufgeschlossen gegenüberzustehen und sie auch rechtzeitig mit der<br />
richtigen Argumentation bei den Baubehörden durchzusetzen. Daß das<br />
heute nur noch auf der Basis eines vernetzten Denkens geht, also mit<br />
einem Denken, das Mensch, Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen<br />
heranzieht, und nicht mehr mit branchengebundenen absatzwirtschaftlichen<br />
Scheuklappen, das dürfte selbstverständlich sein. Frei Otto sagte<br />
daher einmal mit Recht:<br />
»Das vordringliche Problem unserer Zeit betrifft den Menschen und<br />
seine bestmögliche Umwelt. Die Grundaufgabe jedes Bauens ist daher<br />
humanbiologisch. Erst sekundär wird die Aufgabe technisch« - und ich<br />
darf hinzufügen: Wenn sie humanbiologisch, technisch und energetisch<br />
im Einklang mit den Gesetzmäßigkeiten überlebensfähiger Systeme und<br />
damit ökologisch angegangen ist - dazu sind nur eine Handvoll Regeln<br />
nötig, dann ist das zudem noch automatisch die beste Garantie, daß sie<br />
auch wirtschaftliche Früchte trägt.<br />
22
Bernd Lötsch<br />
Was ist <strong>Stadt</strong>ökologie?<br />
Die Großstadtkrise wird immer offensichtlicher: Umwelthygienisch ist<br />
sie objektiv feststellbar, etwa an der Zunahme chronischer Atemwegerkrankungen<br />
bei Großstadtkindern (selbst in der warmen Jahreszeit).<br />
Seit der Jahrhundertwende verdoppelte sich die Lungenkrebsrate alle<br />
20 Jahre und hat nun einen Höchststand erreicht. Schlafstörungen durch<br />
Verkehrslärm sind eine Volksseuche geworden - selbst hinter den geschlossenen<br />
Fenstern der nur mehr schlecht gelüfteten Wohnungen.<br />
51,6% aller Wiener sind tagsüber und 40% nachts in ihrer Wohnung<br />
durch Lärm beeinträchtigt. Bei zwei Drittel der Bevölkerung sind die<br />
wichtigsten Räume straßenseitig orientiert - im Kernbereich von Wien<br />
leben über 50% der Menschen an verkehrsreichen Fahrbahnen. Von<br />
diesen Wohnungsmietern bezeichnen sich 90,4% bei Tag von Lärm<br />
belästigt, 84,4% können nachts nicht mehr ungestört schlafen (Umwelterhebung<br />
1973).<br />
Die Krise zeigt sich auch ästhetisch an der Verhäßlichung der <strong>Stadt</strong>szenerie<br />
und - nicht minder besorgniserregend - soziologisch, charakterisierbar<br />
etwa durch das Phänomen des »Masseneremiten«, des alten<br />
Menschen, der sich kaum mehr auf die Straße wagt.<br />
Hier mündet die Umweltkrise in soziales Unrecht, wenn man Kinder,<br />
Frauen und alte Leute zum Strandgut einer Autogesellschaft macht,<br />
ihnen Spielwelt, Lebens- und Erlebnisraum zerstört, das kostenlose<br />
Vergnügen eines Spazierganges in guter Luft und beglückender <strong>Stadt</strong>landschaft<br />
unmöglich macht und dann auf die fünfzig Mark pocht, die<br />
man dem Rentner monatlich mehr zahlen kann. Sozialen Ausgleich<br />
ausschließlich materiell verwirklichen zu wollen, nach der einfältigen<br />
Formel: »Kaufkraft ist gleich Lebensglück«, gehört zu den gefährlichsten<br />
Verirrungen moderner Sozialpolitik: »Konsum als Opium des Volkes.«<br />
Das Erwachen im zerstörten Lebensraum wird fürchterlich werden,<br />
sobald die Betäubung durch wachsenden Konsum nicht mehr möglich<br />
sein wird - vor allem aber dann, wenn selbst das privilegierte Drittel<br />
nicht mehr bei jeder Gelegenheit unter enormem Energie- und Umweltverbrauch<br />
per Auto aus der <strong>Stadt</strong> flüchten kann.<br />
23
Ein Teufelskreis<br />
Je unwirtlicher die Innenstädte, um so stärker wird der Baudruck auf<br />
den Grüngürtel, wo dann die Zweitwohnungs- und Cottageviertel finanzkräftiger<br />
Schichten entstehen. Die ungesunden Kernbereiche werden zu<br />
Wohnghettos sozial Unterprivilegierter (Rentner, Gastarbeiter - in den<br />
USA Farbige) - Zeigerorganismen (»Bioindikatoren«) für verfallende<br />
<strong>Stadt</strong>strukturen. Da ihnen die Begüteten das Umland zersiedeln, werden<br />
sie überdies auch noch vom Naherholungsgebiet abgeschnitten.<br />
»Die Reichen wohnen, wo sie wollen,<br />
die Armen wohnen, wo sie müssen.«<br />
(A. Hoyt)<br />
Diese Sehnsucht nach dem Grünen, diese <strong>Stadt</strong>kernflucht ist eine Realität.<br />
Während die Einwohnerzahlen der Wiener Innenstadt sinken,<br />
verzeichneten Außenbezirke und niederösterreichische Randgemeinden<br />
zwischen 1961 und 1971 Bevölkerungszunahmen um 54 bis 122%. Das<br />
bedingt den täglichen Radialverkehr zwischen randlichen Wohnbezirken<br />
und dem Zentrum - die langen täglichen Berufsanfahrten in ungesunden<br />
Kolonnen, die der! Menschen die Freizeit stehlen und mühsam<br />
erkämpfte soziale Fortschritte zunichte machen. Im <strong>Stadt</strong>kern stehen<br />
Tausende Wohnungen leer. Wer es sich nicht leisten kann, zwischen<br />
Grün und Grau zu pendeln, leidet still am Rande dieser Heerstraßen aus<br />
Blech, Benzin und Beton.<br />
Die <strong>Stadt</strong> frißt ihr Umland wie ein deletäres Karzinom<br />
Das Beunruhigendste an modernen <strong>Stadt</strong>entwicklungen ist das amorphe<br />
Zerfließen der Städte - ein enormer Flächenfraß -, oft sogar bei<br />
sinkender Einwohnerdichte. Die verbaute und zersiedelte Fläche der<br />
<strong>Stadt</strong> Wien beispielsweise hat sich von 1900 bis 1965 verelffacht -<br />
obwohl die <strong>Stadt</strong>bevölkerung im gleichen Zeitraum um drei Prozent<br />
abnahm (siehe Graphik la und lb).<br />
Mehr Wohnraum für den einzelnen - schuld am Flächenfraß?<br />
Natürlich gibt es in diesem Zeitraum eine Zunahme des Pro-Kopf-<br />
Wohnflächenanteils und des Wohnkomforts. Die Familiengrößen sanken,<br />
und durch Überalterung stieg die Zahl der Einpersonenhaushalte.<br />
Aber Wohnfläche ist keineswegs gleich <strong>Stadt</strong>fläche!<br />
Nur 10-20 % der <strong>Stadt</strong>fläche entfallen auf die eigentlichen Netto-<br />
Wohnflächen. Daher könnte selbst eine Verdreifachung der Pro-Kopf-<br />
24
Abb. 1: Links - Wien um 1900 mit 1,675 Millionen Menschen - rechts - Wien um 1965 mit 1,630 Millionen Einwohnern. Der Metastasierungsprozeß<br />
des Tumors ins grüne Umland ist dramatisch fortgeschritten. Die verbaute, zersiedelte Fläche hat sich von 1900 bis 1965 verelffacht (n. Planimetrie<br />
durch Prof. Woess, Inst. f. Grünraumgestaltung d. Univ. f. Bodenkultur) (Graphik Magistrat der <strong>Stadt</strong> Wien).
Wohnflächen (die zudem ja meist auf einige Geschosse gestapelt sind)<br />
niemals jenen dramatischen Flächenfraß mit Verelffachung des Baulandes<br />
rechtfertigen - schon gar nicht bei sinkender Einwohnerzahl.<br />
Es ist sehr viel wesentlicher, welche Flächenopfer wir für andere<br />
urbane Funktionen als die des Wohnens bringen, vom Straßenbau bis zu<br />
Industrieansiedlungen, von Autostellplätzen, Abstandsgrün und Restflächen<br />
bis zu Gartenparzellen.<br />
Die bahnbrechende Studie der Deutschen Bauakademie über »Die'<br />
gegliederte und aufgelockerte <strong>Stadt</strong>« (1957) kommt zum Schluß:<br />
»Die nicht dem Wohnen dienenden Flächen sind in einer modernen<br />
<strong>Stadt</strong> viel größer (zus. rund 78 bis 350 qm je Einwohner) als die<br />
Wohnfläche (rund 15 qm je Einwohner) und als die Ersparnisse, die man<br />
durch Geschoßhäufung im Wohnungsbau erzielen kann. Daher ist es<br />
sinnlos, durch hohe Wohnhäuser die Flächenausdehnung der Städte<br />
beeinflussen zu wollen...<br />
Selbst wenn man durch unendlich hohe Häuser die ganze Wohnfläche<br />
einsparen könnte, würde man dadurch die ganze <strong>Stadt</strong>fläche nur um etwa<br />
10% verkleinern!« '<br />
Diese Aussage ist - tendenziell - zeitlos gültig, selbst wenn heute<br />
durchschnittlich bereits 30 qm Netto-Wohnfläche auf jeden Städter<br />
kommen. Dabei ist wesentlich: der Zuwachs der Automobilbevölkerung.<br />
1970 hatte Wien um fast 400000 Menschen wehiger als 1910, dafür<br />
aber um 400000 Personenkraftwagen mehr.<br />
Im krebsartigen Wuchern der <strong>Stadt</strong>fläche wird vor allem die flächenerschließende<br />
Wirkung des Automobils sichtbar - während <strong>Stadt</strong>erweiterungen<br />
sich früher entlang leistungsfähiger öffentlicher Verkehrsmittelachsen<br />
kristallisieren mußten. Ein einziger Autostellplatz ist übrigens<br />
so groß wie ein durchschnittlicher Arbeitsplatz und nicht viel kleiner als<br />
die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner.<br />
Ganz wesentlich sind auch die überall durchgeführten oder projektierten<br />
Straßen Verbreiterungen, so daß laut Bebauungsplänen vieler Gemeinden<br />
der Neubau nach Abriß eines Althauses bereits einige Meter<br />
nach hinten rückt. Dies bedeutete aber eine weitere Opferung menschlicher<br />
Wohn- und Gartennutzung zugunsten des Straßenraumes, natürlich<br />
auch eine Zerstörung gewachsener Ortsbilder.<br />
Wir fliehen Dichte. Wir suchen Dichte. - Man legt uns <strong>Stadt</strong>ökologen<br />
häufig in den Mund, wir hielten Menschenballung an sich - also hohe<br />
Dichten - für eine Hauptursache der Unwirtlichkeit unserer Städte.<br />
Natürlich beschäftigen wir uns auch mit Dichtestreß - aber zu seiner<br />
Bewältigung könnte die Planung von der vergleichenden Verhaltensforschung<br />
sehr viel lernen: Denn die vergleichende Verhaltensforschung<br />
weiß aus der Beobachtung verschiedenster Tierarten, wie dichtes Zu;<br />
sammenleben durch Raumstrukturen erträglich wird - durch Verstecke,<br />
26
Nischen und Sichtbarrieren zwischen den Individuen, die ihnen erleichtern,<br />
ihre »Territorien« abzugrenzen. Gerade gesellige Tiere - und der<br />
Mensch gehört dazu - leiden unter Dichte erst in der anonymen Masse<br />
von Fremden, während persönliche Bekanntschaft auch bei hoher<br />
Dichte die Aggressionen hemmt. 1 Der Mensch braucht deshalb überschaubare<br />
Kleingruppen, in denen er die anderen kennt und selbst einen<br />
angestammten Platz hat (Identität). Und schließlich ist bei Tier und<br />
Mensch auch Streß durch Vereinsamung nachgewiesen. Er braucht ein<br />
bestimmtes Maß an Kontakten (Stimulation).<br />
Man braucht nur geglückte Wohnbeispiele gewachsener <strong>Stadt</strong>kulturen<br />
zu studieren und zu fragen, warum sie so gut funktionieren. Alte Städte<br />
mußten - im eisernen Ring ihrer Befestigungsmauern - auf engstem<br />
Raum hohe Dichten erzielen - und dies mit starker Gründurchsetzung,<br />
die eine wichtige Rolle für einen bescheidenen Selbstversorgungsgrad<br />
der Bürger spielte. Dabei sind <strong>Stadt</strong>gebilde entstanden, die wir noch<br />
heute zur Erholung aufsuchen und in denen man - nach Abdrängung des<br />
Autoverkehrs - auch wieder sehr gern lebt. Als Dozent an der Universität<br />
Salzburg weiß ich um die hohen Qualitäten einer historisch gewachsenen<br />
Altstadt.<br />
Dichte und Urbanität: Auch der neue Städtebau muß - etwa bei<br />
Planung eines <strong>Stadt</strong>erweiterungsgebietes - relativ hohe Dichten anstreben<br />
- schon um die Aufschließungskosten zu verringern und eine<br />
wirtschaftlich tragbare Bedienung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu<br />
ermöglichen.<br />
Eine hohe Einwohnerdichte ist auch Voraussetzung für eine gute<br />
Nahversorgung mit wohlsortierten Geschäften in reicher Auswahl und<br />
gesunder Konkurrenz (für den reizvollen Auslagenbummel der großen<br />
<strong>Stadt</strong>) - wie ja überhaupt kommunale Einrichtungen von Postämtern<br />
über verschiedene Schultypen, von Krankenhäusern über Schwimmbäder<br />
bis hin zu Restaurants, Kinos, Vergnügungs-, Sport- und Kulturstätten<br />
- erst ab einer bestimmten Dichte in hinreichender Qualität<br />
angeboten werden können.<br />
Wollte man den »Reiz der Urbanität« auf einen einfachen Nenner<br />
bringen, so würde er in erster Linie »Wahlmöglichkeit« bedeuten - im<br />
Geschäfts-, Bildungs-, Berufs-, Kultur- und Vergnügungsangebot, der<br />
Chance »etwas zu erleben« - das gilt besonders für das Angebot an<br />
möglichen Partnern. Die Partnerwahl ist ein ungeheures Anziehungsmoment<br />
der großen <strong>Stadt</strong> für junge Menschen aus dem ländlichen Raum.<br />
Eben darum war die glitzernde Faszination, die seit jeher vom Zauber<br />
der Urbanität ausging, eine direkte Funktion der Dichte, vor allem aber<br />
der Vielfalt innerhalb der Dichte.<br />
Nun läßt es sich zeigen, daß unser Zeitalter trotz vertikaler Verdichtung<br />
in Wohnsilos und eines Vernichtungskampfes gegen innerstädti-<br />
27
sches Grün insgesamt keine höheren Bewohnerdichten pro qkm <strong>Stadt</strong>boden<br />
erzielt hat, sondern im Gegenteil viel zu verschwenderisch mit<br />
den kostbaren Flächen umgegangen ist. Man denke nur an die breiten<br />
Straßen neuer Städte, mit Breiten wie zwei bis drei Tennisplätze (besonders<br />
auch im neuen Berlin).<br />
Nicht die Dichte selbst ist das Problem des Nachkriegsstädtebaus in<br />
Mitteleuropa, sondern die Unfähigkeit zur menschengerechten Bewältigung<br />
der Dichte.<br />
Landschaftsschonung durch Verdichtung - aber wie?<br />
Der Menschensilo hat versagt. Das wissen wir spätestens seit den<br />
sechziger Jahren. Doch nun stehen sie herum, die Techno-Saurier aus<br />
Stahlbeton und Glas. Wer glaubte, sie würden uns auch nur einen<br />
Quadratmeter Landschaft retten, hat sich geirrt:<br />
• »Menschensilo oder Schrebergärten« sind keine Alternativen - vielmehr<br />
bedingen sie einander<br />
Die Landschaft wird eben deshalb mit Hütten und Kleingärten<br />
zersiedelt, weil wir uns in der städtischen Lebensraumgestaltung über<br />
die primitivsten Grundbedürfnisse des Menschen hinweggesetzt haben.<br />
Menschensilo und Zinskaserne werden immer neue Schrebergärten<br />
gebären.<br />
Die »Batterieställe für den Nutzmenschen« (K. Lorenz) führten zur<br />
permanenten Halbflucht.<br />
• Je höher der Baukörper, desto größer die Abstände<br />
Zur Sicherung des Lichteinfalls verlangen (ausnahmsweise wohlbegründete)<br />
Bauvorschriften Mindestabstände von ein bis zweieinhalb<br />
Gebäudehöhen zwischen den emporragenden Wohnscheiben. Die<br />
dazwischen ausgebreiteten Flächen sind ebensowenig »Naturlandschaft«<br />
geblieben wie in irgendeiner anderen Siedlungsform.<br />
Der <strong>Stadt</strong>raum wird zum Zwischenraum, zur »Abstandsfläche«<br />
zwischen Hochhausklötzen - bestenfalls sterilgrüne Gemeinderasen,<br />
vergeudetes Niemandsland, kaum angenommen. Die mögliche Restfunktion<br />
als Hundeklosett rechtfertigt nicht den Flächenaufwand.<br />
• Urbanität?<br />
Das gab's einmal. Während jährlich Hunderttausende in die alten<br />
Städte wie Bamberg, Rothenburg oder Salzburg pilgern, um in den<br />
schmalen Gassen mit ihren Erkern und Höfen, Arkaden, intimen<br />
Plätzen und plätschernden Brunnen noch den Zauber pulsierenden<br />
Lebens in reizvollen Außenräumen zu erleben, klotzt das offizielle<br />
Bauen ein »Märkisches Viertel« und eine »Großfeldsiedlung« nach<br />
der anderen auf die grüne Wiese deutscher <strong>Stadt</strong>erweiterungsge-<br />
28
Abb. 2: »Wohnscheibe« am <strong>Stadt</strong>rand von Linz. Enormer optischer Landschaftsverbrauch,<br />
Abstandsgrün und Baukörper ungeschützt gegenüber dem Verkehrslärm,<br />
Verlust von Urbanität; weder familiengerecht noch flächenökonomisch<br />
(kein nutzbares Grün, trotz großen Flächenaufwandes) (Quelle: Naturschutzbund<br />
Oberösterreich).<br />
Abb. 3: Nicht das Hochhaus inmitten der Grünfläche<br />
... sondern das Grün im Schutze des Hauses bietet lebensgerechte <strong>Stadt</strong>strukturen.<br />
In den Höfen herrscht weniger als ein Fünftel des straßenseitigen Lärmpegels<br />
(Stiftshof in Salzburg).<br />
F<br />
29
30<br />
biete, brutal und geistlos - wie der Schienenkran die Fertigteile fallen<br />
läßt.<br />
Privatheit, Selbstverwirklichung?<br />
Die gibt's vielleicht noch im Innersten der Wohnzelle. Sobald man<br />
den Fuß ins Freie setzt, ist man anonym und heimatlos - kein Garten<br />
für sinnvolle Bewegung, keine Hausbank für den Plausch mit den<br />
Nachbarn.<br />
Im Blickfeld hundertfenstriger Betontürme fühlt man sich nicht<br />
geborgen, eher wie ständigen Blicken ausgesetzt, obwohl sich längst<br />
keiner mehr um den Nächsten schert. Die Grünanlagen werden<br />
vielerorts bei Dunkelheit so unsicher, daß sie am Abend jeder<br />
meidet.<br />
Optischer Landschaftsverbrauch<br />
Die weithin sichtbare Fernwirkung von Hochhäusern bedeutet einen<br />
brutalen optischen Landschaftsverbrauch - Klötze, welche in ihrer<br />
Aufdringlichkeit die <strong>Stadt</strong>bilder in aller Welt ununterscheidbar werden<br />
lassen, lebensfeindliche »Kosmopoliten der Häßlichkeit«.<br />
Flächenökonomie von Wohnhochhäusern - der tragische Irrtum<br />
Ein <strong>Stadt</strong>viertel aus dreigeschossigen Wohnhöfen mit Innengärten<br />
erzielt auf humane Weise dieselbe Einwohnerdichte pro Hektar wie<br />
zehnstöckige Wohnscheiben (siehe Abb. 5).<br />
Beispiele introvertierter Hofarchitektur reichen von Theodor Fischers<br />
Hofhäusern in München, Neu-Westend, bis zu den grünen<br />
Wöhnhöfen der Gemeinde Wien in den 20er und 30er Jahren (zum<br />
Teil sogar in wirtschaftlichen Krisenjahren verwirklicht!) als wahrhaft<br />
soziale menschengerechte Bebauungsformen, ebenso wie die Linzer<br />
Wohnhöfe der vierziger Jahre. Betritt man sie heute, verebbt der<br />
Verkehrslärm, im grünen Hof garten sind die Bewohner nur mehr<br />
einem Fünftel (und weniger) des straßenseitigen Lärmpegels ausgesetzt.<br />
Es gibt - rückblickend - keinen vernünftigen Grund, der erklären<br />
könnte, warum derart humane Bautraditionen nach dem 2. Weltkrieg<br />
zugunsten kontaktfeindlicher »Türme« und »Scheiben« aufgegeben<br />
wurden, wie fast überall auf der Welt.<br />
Hochhäuser - auch baubiologisch fragwürdig?<br />
»Aus den heute vorliegenden praktischen Erfahrungen und Experimenten<br />
wissen wir, daß das Hochhaus eine Reihe von gesundheitlichen<br />
Nachteilen aufweist. Die Frage, ob das Hochhaus menschengerecht<br />
sei, müssen wir deshalb aus guten Gründen verneinen. Werden die<br />
Baubehörden die Konsequenzen daraus ziehen?« (Dr. Oeter, Hamburger<br />
Hygiene Institut) 2<br />
Die Ursachen werden im »gestörten Milieu und der veränderten<br />
Einwirkung geoatmosphärischer Reize« gesehen. Als Nachteil der
Abb. 4:<br />
Scheibe contra<br />
Wohnhof:<br />
a) Ein häufiger<br />
Typ: lOgeschossigeWohnscheiben<br />
in den für<br />
Hochhäuser<br />
üblichen Abständen.<br />
b) Errichtet<br />
man auf demselben<br />
Areal einen<br />
nur 3geschossigen<br />
Wohnhof -<br />
weniger Wohnraum?<br />
Im Gegenteil:<br />
der<br />
Wohnhof bringt<br />
um 20% mehr.<br />
c) Grün für alle<br />
Mieter: Eine Innenlandschaft,<br />
die vor den Türen<br />
der ebenerdig<br />
Wohnenden<br />
beginnt. Der erste<br />
Stock erhält<br />
Terrassen - der<br />
zweite Stock private<br />
Freiräume<br />
auf dem Dach<br />
(Graphik: H.<br />
Katzmann und<br />
B. Lötsch).<br />
31
1. Ordnet man das gesamte Bauvolumen ebenerdig an, frißt das enorm viel Fläche.<br />
2. Baut man denselben Wohnraum zweigeschossig, gewinnt man die Hälfte der Geschoßfläche als Grünland.<br />
3. Stockt man dasselbe Bauvorhaben auf drei Etagen, gewinnt man zusätzlich ein Sechstel der Geschoßfläche.<br />
4. Baut man viergeschossig, wird nur mehr ein Zwölftel hinzugewonnen ... und ...<br />
5. beim Übergang von vier auf fünf Etagen gar nur mehr ein Zwanzigstel zusätzlich erspart.<br />
Das heißt: Der durch Stockwerkshäufung erzielbare Grünflächengewinn sinkt nach einer 2——<br />
Kurve steil ab und wird bereits ab dem 4. Stockwerk vernachlässigbar klein. n V n ><br />
Aus dieser Überlegung folgt als Optimum für neue <strong>Stadt</strong>gebiete, wenn es darumgeht, eine gegebene Fläche mi<br />
hoher Wohndichte und bester Grünflächenzuordnung zu bebauen, das zwei- bis dreigeschossige Haus.<br />
Abb. 5: Der Mythos vom Grüngewinn durch Geschoßhäufung.<br />
32
Hochhäuser wird ferner die Vereinsamung der Bewohner, die Verführung<br />
zur Trägheit und zum Stubenhockertum betrachtet.<br />
Solche Aussagen stimmen - wie fast alles in Biologie und Psychologie<br />
- statistisch, d.h. es kann ohne weiteres sein, daß sich einzelne<br />
Personen auch in Hochhäusern sehr wohl fühlen. Auch sind wir von<br />
der Kenntnis genauerer Ursachen weit entfernt.<br />
In einem Punkt aber sind sich fast alle Untersucher einig:<br />
Wohntürme sind kinderfeindlich<br />
Vom 6. Stockwerk an auf den Lift angewiesen, um rasch ins Freie<br />
und zurück zu gelangen, dürfen Kinder ihn ohne Erwachsene nicht<br />
benützen (»können es auch nicht, weil sie die Rufknöpfe nicht erreichen,<br />
können auch nicht zu Fuß gehen, weil sie sich im kahlen Einerlei<br />
der Etagen verirren. Statt Spiel und Sport im Freien genießen sie das<br />
Flimmern der Mattscheibe. Die Folgen merken die Kinderärzte«).<br />
Hochhauskinder hätten, so der Berliner Kinderarzt Karl Härtung,<br />
oft eine unterentwickelte Muskulatur und seien auffallend blaß und<br />
aggressiv.<br />
Junge Mütter und ihre Kinder leiden unter den Schwierigkeiten,<br />
die es zu überwinden gilt, damit das Kleine zum Spiel ins Freie<br />
kommt - wo es dann ohne Sicht- und Rufkontakt zur Mutter ist.<br />
Die bewegungshungrigen Kinder bleiben deshalb meist Gefangene<br />
der Wohnungen, und dort sorgen immer neue Berührungstabus für<br />
zwangsweise räumliche Beschränkung: Elektrogeräte, neue Möbel<br />
usw. Die Kinder können sich nicht wehren. Aber es ist denkbar, daß<br />
die zurückgestaute natürliche Aggressivität während und nach der<br />
Pubertät in Form von Motorraserei, Gewalt und Vandalismus hervorbricht<br />
oder doch - neben Langeweile - zu diesen Erscheinungen<br />
wesentlich beiträgt, meint Wohnbauforscher Architekt E. Bramhas.<br />
Gestörte Sozialstrukturen, Anonymität und Unüberschaubarkeit fördern<br />
Kriminalität<br />
»Die Wohnungsprojekte mit hoher Verbrechensrate sind gewöhnlich<br />
sehr groß, und in ihnen wohnen über 1000 Familien. Sie bestehen aus<br />
turmartigen Hochhäusern mit über sieben Stockwerken. In solchen<br />
Wohnhochhäusern kommen siebeneinhalbmal soviel Kriminalität und<br />
Vandalismus vor als in kleinstädtischen Mehrfamilienhäusern.« (Prof.<br />
Dr. H. J. Schneider, Kriminologe, Münster/Westfalen)<br />
Warum also Hochhäuser in neuen <strong>Stadt</strong>vierteln?<br />
Die Frage ist berechtigt und führt rasch ins Irrationale. Baugrundersparnis<br />
kann schon deshalb keine Erklärung für viele Wohntürme<br />
bieten, da in Österreich und Deutschlands Provinzen oft die allerhöchsten<br />
Hochhäuser auf den allerbilligsten Gründen errichtet<br />
wurden.<br />
»Sie bauten einen Turm, denn sie wollten sich einen Namen machen,<br />
33
34<br />
gilt nicht nur für den Turmbau zu Babel, sondern auch für manche<br />
Bürgermeister und Architekten.« (R. Rainer, 1972)<br />
Was könnte hier eine deutlichere Sprache reden als die fortschrittstrunkenen<br />
Manhattan-Visionen mancher Provinzbürgermeister.<br />
»Provinz« verrät sich am verläßlichsten an der Art, wie sie versucht,<br />
die Provinz zu verleugnen.<br />
Das Versagen der Architektur<br />
Sicherlich mögen Bauherren und Fertigteil-Sachzwänge viel zur Verzerrung<br />
architektonischer »Human«-Programme beigetragen haben.<br />
Aber - das Wirtschaftssystem allein scheint nicht entscheidend: In<br />
den Vorstädten Budapests, Ost-Berlins und anderer Ostmetropolen<br />
finden sich dieselben unmenschlichen »Profitquader«, dieselben Entartungen<br />
des »sozialen Wohnbaues« wie im sogenannten kapitalistischen<br />
Westen. Es ist schon so, wie Konrad Lorenz und Hans Sedlmayr<br />
seit Jahren betonen: die Technokratie herrscht unabhängig von<br />
politischen Ideologien. Denn sie ist eine Ideologie für sich.<br />
Dort wo man führenden Architekten aus aller Welt die Chance zur<br />
totalen Selbstverwirklichung geboten hat - etwa in Brasilien oder<br />
beim Aufbau des total zerstörten Rotterdam, wo man gleichsam bei<br />
Null anfangen konnte, nicht eingeschränkt durch kleinliche Eigentumsrücksichten<br />
oder Geldknappheit -, sind Städte entstanden, in<br />
denen sich die Menschen nicht wohl fühlen, in denen sie nicht<br />
bleiben mögen, aus denen sie bei jeder Gelegenheit fliehen - wie<br />
etwa die brasilianischen Regierungsbeamten, die jedes Wochenende<br />
per Flugzeug eilig zurückfliegen in die alten Städte, ein totes Utopia<br />
hinterlassend, dessen <strong>Stadt</strong>zentrum aus einer riesigen Autobahnkreuzung<br />
(!) besteht, flankiert von technokratischen Monstern.<br />
Bei Null beginnen mit dem Städtebau - das war auch die Idealvorstellung<br />
des französischen Architekturprogrammatikers Le Gorbusier:<br />
»Unsere alten Stahlrohre mit ihren Domen und Munstern müssen<br />
zerschlagen und durch Wolkenkratzer ersetzt werden«, proklamierte<br />
er um 1923, als er mit seinem Plan Voisin demonstrierte, wie er sich<br />
eine radikale Operation des <strong>Stadt</strong>körpers von Paris vorstellte.<br />
Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, daß diese riesenhaften Vertikalarchitekturen<br />
und monoton gerasterten Betonfassaden ausschließlich<br />
ökonomisch erzwungen worden seien. Als Ideen sind sie viel älter als<br />
die sie bedingenden Sachzwänge:<br />
In Le Corbusiers Buch »Kommende Baukunst« (1926) finden sich<br />
bereits Skizzen jener Betonmonster - als ersehnte ästhetische Visionen<br />
-, lange bevor es eine machtvolle Fertigteilbauindustrie gab. Die<br />
architektonischen Wunschbilder eilten der Bauindustrie voraus - voll<br />
Begeisterung erhoben sie die Technologie zum neuen Gott des
Bauens, Sachzwänge mitbegründend, die heute zum Verhängnis<br />
werden.<br />
Der Glaube an die technische Machbarkeit aller Lebensbereiche<br />
muß damals in der Architektenschaft unvorstellbar stark gewesen<br />
sein:<br />
»Architektur bedient sich rückhaltlos der stärksten Mittel; Maschinen<br />
haben von ihr Besitz ergriffen, und die Menschen sind nur noch<br />
geduldet in ihrem Bereich«, heißt es noch in einem bekannten Manifest<br />
zweier junger Architekten der sechziger Jahre (der eine hat sich<br />
später davon distanziert, der andere ist heute Hochschulprofessor).<br />
Die Flucht ins Grüne<br />
Nach Umfrageergebnissen und Aussagen zahlreicher <strong>Stadt</strong>planer kauft<br />
ein Großteil der Städter das Auto nicht in erster Linie zur Berufsausübung,<br />
sondern für den Sonntag - als Freiheits- und Kraftsymbol, als<br />
Urlaubsinstrument. Man braucht das Auto, um der Unwirtlichkeit, dem<br />
Lärm und der Luftverschmutzung moderner Großstädte zu entfliehen.<br />
Das Auto ermöglicht diese Flucht - es hat sie aber auch erst notwendig<br />
gemacht.<br />
• Einfamilienhaus und Privatgrün - nur für wenige erfüllbar?<br />
Noch nie zuvor sehnten sich so viele Städter nach dem Einfamilienhaus<br />
im Grünen. Der Trend ist steigend: Hatten 1972 immerhin 74%<br />
der Deutschen diese Sehnsucht, so ergaben gleiche Umfragen 1979<br />
bereits 81 % der Wohnwünsche.<br />
Ergebnis: Verheerender Landschaftsverbrauch, wildwuchernde<br />
Bungalowrudel statt Dorfgemeinschaft und <strong>Stadt</strong>kultur, zwanghafte<br />
Abhängigkeit vom Automobil bis hin zur Prügelei an den Tankstellen,<br />
sobald das kostbare Benzin auch nur vorübergehend langsam<br />
fließt. Jede dritte Wiener Familie verfügt bereits über einen Wochenendwohnsitz<br />
im Grünen.<br />
Man opfert vielerorts die ackerbaulich wertvollen Talsohlen der<br />
Bauwut und überzieht landschaftlich ehemals reizvolle Abhänge mit<br />
einem »Gitternetz« umzäunter Parzellen, jede besetzt mit einem<br />
freistehenden Siedlungshäuschen. In dieser städtebaulich und wirtschaftlich<br />
verhängnisvollen Form (z.B. auch enorme Erschließungskosten<br />
für Fahrwege, Kanalisation, Wasserversorgung) entstehen<br />
Einfamilienhäuser massenweise aber erst seit etwa 60 Jahren.<br />
• Von alten <strong>Stadt</strong>kulturen lernen<br />
In alten Dorf- und <strong>Stadt</strong>strukturen wußte man sehr wohl hohe<br />
Wohndichten mit reizvoller Urbanität und der Intimität privaten<br />
Grüns zu vereinen - das Geheimnis war die Hofkultur: Haus und<br />
35
36<br />
Hofmauer umschließen schützend den privaten Freiraum, für welchen<br />
hier ein Bruchteil der Fläche genügt, um wesentlich mehr<br />
Intimität, Sicht-, Lärm- und Staubschutz und private Nutzbarkeit zu<br />
bieten als die offenen 600-1200 qm Gärten isolierter Einzelhäuser,<br />
welche den 5- bis 7fachen Landschaftsverbrauch bedingen und hauptsächlich<br />
Kulissen- und Pufferfunktion erfüllen (um Nachbarn und<br />
Neugierige »auf Distanz zu halten«) - denn intensiv benützt wird<br />
meist nur ein kleiner Bereich beim Haus.<br />
»Der Garten im Haus« lautet das Rezept - und nicht (wie bisher)<br />
»der Garten ums Haus«.<br />
Dies zwingt zur Revision sinnloser behördlicher Vorschriften, welche<br />
durchsichtig eingezäunte Vorgärten und streng reglementierte<br />
Mindestabstände zwischen Haus und Zaun fordern (z.B. 3 m)- und<br />
solcherart kleine Gärten zu wertlosen Streifchen rund ums Haus<br />
degradieren.<br />
Gartenmauern sparen. Fläche<br />
Oberstes Gebot für das private Grün sollte Sichtschutz, also Intimität<br />
sein. Ist dies erfüllt, genügen private Grünräume in einer<br />
Größe von VA bis 3 Zimmern.<br />
a) Intimität: Sonnenbäder (UV-Konsum für Vitamin-D-Haushalt),<br />
Lesen, Handarbeiten im Freien. Gesicherter Spielraum für das<br />
Kleinkind. Bioklimatische und psychologische Pufferzone vor der<br />
eigenen offenen Tür und dem Fenster. Gesunde körperliche Arbeit<br />
unter freiem Himmel (statt des Fahrradsimulators im Schlafzimmer).<br />
b) Eigengestaltung: Möglichkeit zur selbständigen Gartengestaltung<br />
auf kleinstem Raum, Auswahl der Pflanzen (auch Anbau von<br />
Gemüse), ständige Beobachtung von sich wandelnden Naturobjekten,<br />
Verwirklichung persönlicher Vorstellungen, damit verbunden.<br />
c) Heimatgefühl: maximale Identifikation mit der Wohnstätte.<br />
Man staunt, wie viele geschützte Hofgärtchen es selbst in den gedrängten<br />
mittelalterlichen Städten gab - etwa heute noch in Rothenburg<br />
zu sehen -, wo ja einst jeder verfügbare Quadratmeter für Obst,<br />
Beeren, Gemüse und Heilkräuter genutzt wurde. Selbst die Vertikale<br />
an den Hausfronten wurde genutzt - für Wein und Spalierobst.<br />
Damals mußte das <strong>Stadt</strong>grün seine Daseinsberechtigung und Nützlichkeit<br />
nicht durch klimatologische und psychologische Argumente<br />
rechtfertigen - wie »Luftverbesserung« oder »Naturerinnerung«.<br />
Selbstversorger in der <strong>Stadt</strong><br />
An seinen Nutzpflanzen konnte der Bewohner den Wandel der<br />
Jahreszeiten viel intensiver erleben als an irgendwelchen xerohyti-
sehen »Architektenpflanzen«, die heute zur Kaschierung von Bausünden<br />
über die Sichtbeton-Fertigteile gestreut werden, wie Petersilie<br />
über den Schweinskopf (liefern etwa manche Betonwerke die<br />
pflegeleichten Zwergkoniferen und den ruppigen Cotoneaster gleich<br />
mit?).<br />
Der bescheidene Selbstversorgungsgrad war ganz wichtig. Die<br />
größte Demütigung, die ein fremder Eroberer einer mittelalterlichen<br />
<strong>Stadt</strong> zufügen konnte, war es, die Obstbäume niederzumachen, denn<br />
diese Wunde brauchte Jahrzehnte, um zu heilen.<br />
Alte Hofsysteme in deutschen Städten könnten gerade heute unsere<br />
Phantasie wieder anregen. Jedem jungen Architekten kann man<br />
empfehlen zu studieren, wie unsere Vorfahren es fertigbrachten, bei<br />
hoher Dichte zugleich jene erstaunlich intensive Grünflächenversorgung<br />
zu verwirklichen.<br />
Städtische Wohnformen, welche dies ermöglichen, gibt es - wie<br />
erwähnt - seit langem, sie haben »... nämlich als durchwegs aneinandergebaute<br />
Häuser auf sehr kleinen Parzellen mehrere tausend Jahre<br />
lang den Städtebau fast aller großen Kulturen beherrscht - sei es als<br />
Atriumhäuser des Mittelmeerkreises oder der mohammedanischen<br />
Großstädte West- und Zentralasiens, sei es ab chinesische Hofhäuser,<br />
sei es als Reihenhäuser der west-, nord- und mitteleuropäischen Städte;<br />
Einfamilienhäuser prägen auch heute das Wohnungswesen der sehr gut<br />
funktionierenden holländischen und englischen Städte aller Größen,<br />
einschließlich Londons.« (Zit. n. Rainer)<br />
Daß dies - etwa bei Planung neuer Siedlungsgebiete - flächenmäßig<br />
verkraftbar wäre, stützt R. Rainer mit folgender Argumentation.<br />
So haben z.B. die Parzellen:<br />
»... der holländischen und englischen Reihenhäuser nur 150-250<br />
qm, das sind etwa 40 bis 60 Häuser mit rund 200-250 Einwohnern je<br />
Hektar Wohnbauland - etwa halb so viel wie bei normalen Mehrfamilienhäusern.<br />
Denkt man sich diese Mehrfamilienhäuser durch Einfamilien-Reihenhäuser<br />
ersetzt, so würden die jetzigen Baugebiete der Miethäuser<br />
solcherart zwar verdoppelt; denkt man sich aber gleichzeitig Reihenhäuser<br />
anstelle der freistehenden Einfamilienhäuser der Außenbezirke,<br />
so wären deren ausgedehnte Flächen auf ein Fünftel reduziert. Das<br />
bedeutet, daß die Wohngebiete der meisten Städte insgesamt nicht<br />
größer, sondern kleiner wären, wenn sie durchwegs aus Atriumhäusern<br />
oder Reihenhäusern bestünden, und erklärt, warum das in der<br />
Vergangenheit so war und in vielen Städten noch weitgehend so ist.«<br />
»Verdichteter Flachbau« - eine Planungsweisheit mit mehrtausendjähriger<br />
Bewährung<br />
Das moderne Ergebnis solcher Einsichten eröffnet faszinierende<br />
37
38<br />
städtebauliche Perspektiven, ohne Gefahr zu laufen, zur tragisch<br />
irrenden Heilslehre ä la Corbusier zu werden - denn sie nutzt die<br />
Weisheit gewachsener <strong>Stadt</strong>kulturen, den akkumulierten Erfahrungsschatz<br />
Hunderter Generationen.<br />
Nach diesen Prinzipien neu konzipierte »Gartenstädte« - etwa die<br />
überaus sozialen Reihenhaussiedlungen eines Tessenow, Savisberg<br />
oder Ehn, die Atriumhäuser Rainers oder das romantische Wohndorf<br />
»Seldwyla« von Rolf Keller in Zumikon bei Zürich -, sie alle geben<br />
den Planern in punkto Wirtschaftlichkeit und Wohnzufriedenheit<br />
vollkommen recht. Eine vom österreichischen Bautenministerium<br />
veranlaßte Untersuchung hat ergeben, daß die Bewohner von<br />
Atriumhäusern drei Viertel ihrer Sonntage zu Hause in ihren Gartenhöfen<br />
verbringen, während andererseits z.B. Hochhausbewohner<br />
drei Viertel dieser Freizeit außerhalb sind, und daß die Bewohner der<br />
Atriumhäuser sich besonders guter Sozialkontakte und besonders<br />
guten Wohlbefindens erfreuen.<br />
Ähnliches könnte auch für alte romantische und orientalische<br />
<strong>Stadt</strong>kulturen gesagt werden. Ob wir uns auch in Europa wieder<br />
sozio-biologisch richtige Wohnformen leisten können, hängt davon<br />
ab, welche Flächenopfer wir weiterhin für andere städtische Funktionen<br />
bringen - vor allem für den Verkehr!<br />
Auch die oben erwähnten erfolgreichen Neuplanungen im verdichteten<br />
Flächenbau'sind vielfach dadurch besonders flächenökonomisch,<br />
daß sie als »fußläufige Gartenstädte« ausgelegt sind. Wo man<br />
Autos nicht zwischen die Wohnhäuser hineinfahren läßt, entfällt die<br />
Notwendigkeit breiter Straßenflächen in der Siedlung. An Randpunkten<br />
finden sich Sammelgaragen, von denen es in der Regel nicht<br />
weiter als 100 m zum Wohnhaus ist.<br />
Dadurch wären wieder prinzipiell reizvolle Gäßchen, kleine Plätzchen<br />
und Winkel derselben Intimität möglich wie in den alten<br />
Städten, die wir zur Erholung aufsuchen.<br />
Dieses Planungsprinzip lautet also - statt landschaftszerstörender<br />
Punkthäuser und chaotischer Bungalowrudel wieder dörflich-kleinstädtisch<br />
verdichtete Strukturen - aber unter Wahrung des privaten<br />
Freiraumes, etwa als geschützter Grünhof. <strong>Stadt</strong>viertel dieser Wohndichte<br />
sind dann auch (im Unterschied zu den zu lockeren Cottagevierteln)<br />
durch öffentliche Nahverkehrsmittel wieder wirtschaftlich<br />
zu bedienen.<br />
Für das Bauen in Entwicklungsländern sind diese Erkenntnisse<br />
von allergrößter Bedeutung - um so mehr, als »fußläufige« Städte<br />
aus ein- bis zweigeschossigen Einfamilien-Atriumhäusern für viele<br />
heiße Regionen der Dritten Welt typisch sind - angepaßte Bautraditionen,<br />
an die behutsam anzuknüpfen wäre (s. Lötsch, 1979/81).
Einzelhäuser in offener Bauweise: »Das Haus im Garten«. Gegenseitige Einblicke von<br />
Straßen und Fenstern in Fenster, Vorgärten, Seitenabstände und rückwärtige Gärten.<br />
Störung aller Außenräume durch Lärm und Abgase der Autos. Weder Privatsphäre noch<br />
öffentliche Sphäre!<br />
Aneinandergebaute Hofhäuser: »Der Garten im Haus«. Keine gegenseitigen Einblicke von<br />
einer Privatsphäre in die andere - jeder Garten nur vom eigenen Haus einsehbar, keine<br />
Störung der Häuser, Höfe und Gärten durch Verkehr, Lärm und Abgase.<br />
Vollkommen geschützte Privatsphäre, klar gestaltete öffentliche Sphäre!<br />
Aus: »Lebensgerechte Außenräume«, Roland Rainer, Verlag für Architektur Artemis,<br />
Zürich 1972, S. 48<br />
Abb. 6a: Prinzipskizzen: Sichtverhältnisse in Punkthaus-und in Hofhaussiedlungen<br />
(aus R. Rainer, 1978).<br />
39
40<br />
Abb. 6b und c: Einfamilien-Reihenhäuser<br />
für Arbeiter<br />
von H. Tessenow um<br />
1907. Obwohl an viele traditionelle<br />
Elemente anknüpfend<br />
(was seinen<br />
Schöpfungen anheimelnde<br />
Wärme verleiht), war Tessenow<br />
einer der fortschrittlichsten<br />
Architekten. Gartenstadtidee<br />
,»<strong>Stadt</strong>haus«<br />
und »Verdichteten Flachbau«<br />
mit zutiefst sozialen<br />
Überlegungen verbindend,<br />
ermöglichte er sinnvolle<br />
Tätigkeit in frischer Luft<br />
für einen bescheidenen<br />
Selbstversorgungsgrad, gesicherten<br />
Spielraum für<br />
Kinder, Wäschetrocknen,<br />
Kartenspielen, Sozialkontakte<br />
- alles vor der eigenen<br />
Haustür.
Abb. 7: Seldwyla - Beispiel für Verdichteten Flachbau und Planungsdemokratie für Individualisten. Ein Exempel des Anfanges<br />
setzte der Architekt Rolf Keller (bekannt durch sein Buch »Bauen als Umweltzerstörung«) in Zumikon bei Zürich. Die<br />
Bebauungsdichte ist viel höher als die der Villensiedlungen der Umgebung, der Planungsprozeß mit den rund 40 Familien des<br />
gehobenen Mittelstandes wurde zum erfolgreichen Partizipationsmodell und schuf eine »Dorfgemeinschaft« (Strichzeichnung R.<br />
Keller).
Abb. 8: Wohndorf für Romantiker - Ferienarchitektur ganzjährig (a, b, c, d).<br />
Rolf Kellers stark handwerklich bestimmte Siedlung knüpft erkennbar an Formen<br />
des anonymen Bauens an. Mitgebrachte Türen und liebgewonnene Details aus<br />
abgebrochenen Althäusern wurden auf Wunsch eingefügt. Fläche gespart wurde<br />
bei den Gäßchen (fußläufige Gartenstadt) - die Hausgärten gewähren weiten<br />
Ausblick, werden hingegen von den Wegen kaum eingesehen.<br />
42
Die engen und daher selbstbeschattenden Gäßchen der Altstädte<br />
sind nicht nur kühler als die breiten Autostraßen (aus denen einem<br />
ein Gluthauch entgegenschlägt, als würde man ein Backrohr öffnen) -<br />
sie geben, weil Autos darin chancenlos sind, Mensch und Tier noch<br />
Raum für Aufenthalt und Kommunikation. All dies und vieles mehr<br />
ließ klimagerechte Lösungen ohne teures Airconditioning entstehen<br />
und schuf menschengerechte Urbanstrukturen ohne Computerplanung.<br />
Es repräsentiert den akkumulierten Erfahrungsschatz Hunderter<br />
Generationen - und damit ungleich mehr Weisheit als eine<br />
Generation westlichen Fertigteilbauens - mit dem man heute die<br />
Städte des Orients ruiniert (nicht nur die Städte ruiniert, sondern<br />
auch das bodenständige Bauhandwerk, die Energiebilanz und die<br />
Familienstrukturen, den angepaßten Lebensstil: In den Wohnzellen<br />
der Menschensilos kann man nicht in der Großfamilie leben, kann<br />
man nicht auf dem Dach schlafen und kann man keine Tiere halten -<br />
obwohl ein bescheidener Selbstversorgungsgrad mit Protein für die<br />
bettelarmen Volksmassen Ägyptens und anderer heißer Länder lebensentscheidend<br />
ist). Ganz wesentlich ist die Erkenntnis, daß man<br />
den Menschen nicht ungestraft die Erdbasis, ein eigenes Fleckchen<br />
bebaubaren Erdbodens rauben darf, oder wie der Inder Satish Kumar<br />
es sagt:<br />
»Erdreich und Seele gehören zusammen.«<br />
Und in einem für Orientalen typisch bildhaften Gleichnis kritisiert<br />
der weltberühmte ägyptische Architekt Hassan Fathy den Hochhausbau<br />
in Ländern der Dritten Welt:<br />
Wenn ich ein Wasserglas mit 100 ccm Inhalt vor mir habe, kann ich<br />
nicht 110 ccm einfüllen - es würde überlaufen. Wenn aber ein<br />
Politiker daherkommt und sagt: »Sie haben 1000 ccm hineinzubringen«<br />
dann würde ich entgegnen: »Gut, mein Verehrter, das kann ich -<br />
aber dann muß ich das Wasser zuerst einfrieren und die Eisstange in<br />
das Glas stellen!«<br />
Und das gleiche passiert, wenn Sie zu viele Leute übereinanderstapeln,<br />
dann müssen Sie auch etwas einfrieren, und zwar im Menschen<br />
...<br />
Zwischenbilanz - Konsequenzen für bestehende <strong>Stadt</strong>strukturen<br />
Mietergärten, statt Abstandsgrün<br />
Was fehlt dem heutigen Städter besonders? Ein privater, sichtgeschützter<br />
Freiraum unter offenem Himmel, Intimgrün, nicht nur Sozialgrün!<br />
Wahrscheinlich wird man die sterilgrünen Gemeinderasen zwischen<br />
44
den Wohnscheiben hingeklotzter Neustadtviertel dereinst als Mietergärten<br />
parzellieren, denn dies wäre die sicherste Art, ohne öffentliche<br />
Mittel ein menschlich intensivst genutztes Gartenparadies entstehen zu<br />
lassen - auf bisher anonymen Freiräumen zunehmender Kriminalitätsbelastung<br />
könnten plötzlich liebevoll betreute Selbstversorgergärtchen<br />
wuchern, eine neue Gartenlaubenromantik sprießen - aus Pachtgärten<br />
würden Prachtgärten.<br />
Hofschutz<br />
Doch was tun im Häusermeer dichtbebauter <strong>Stadt</strong>bezirke? Gewiß - man<br />
beginnt die grünen Höfe wieder zu entdecken - soweit sie nicht längst zu<br />
ölbefleckten Autostellflächen verödet sind. Ein wirksames Hofschutzgesetz<br />
wäre heute zehnmal wichtiger als die seit Adolf Hitler in verhängnisvoller<br />
Weise immer wieder novellierte (Reichs-)Garagenordnung, die<br />
den Hauseigentümer verpflichtet, bei Neu- und Umbauten auf seinem<br />
Grund eine der Wohnungszahl gemäße Zahl von Stellplätzen zu errichten.<br />
Flucht aufs Dach - Grünes Glück über Großstadtgiebeln<br />
Wie die Überlebenden großer Flutkatastrophen oft nur mehr einen<br />
Fluchtweg offen haben - den nach oben, auf ihr Dach -, beginnen sich<br />
gequälte Städter der unermeßlichen Dachflächen zu erinnern, um sich<br />
auf ihnen vor der allgemeinen Sintflut aus Blech, Benzin, Beton, Lärm<br />
und Gestank zu retten. In keinem Jahrhundert zuvor wurden in unseren<br />
Klimazonen so viele Flachdächer gebaut wie in den letzten 70 Jahren -<br />
sattsam bekanntes Ziel berechtigter Kritik.<br />
Doch warum nicht die Not zur Tugend machen - wie Architekt Erich<br />
Bramhas schon 1973 schrieb:<br />
»Man muß sich in Erinnerung rufen, wozu ein Flachdach gut sein<br />
kann, um diese Phantasielosigkeit zu begreifen: Tischtennis spielen,<br />
baden, sonnenbaden, Wäsche aufhängen, turnen, malen, Blumen züchten,<br />
Hühner halten, schlafen, Sternschnuppen zählen, Gitarre spielen,<br />
lieben. Das Ausmaß an dazugewonnener Freude ist nicht meßbar. Die<br />
Mehrkosten gegenüber einer Dachnormausführung sind es schon. Das<br />
fällt kaum ins Gewicht? aber immerhin. Also spricht der kaufmännische<br />
Leiter: > Unwirtschaftlich.<br />
Der Schrumpfmensch im Fertigteilbau wird noch oft nach Italien auf<br />
Urlaub fahren müssen, um zu begreifen, daß >Wirtschaftlichkeit< mitunter<br />
die Narkose ist, in der man ihn kastriert.«<br />
45
46<br />
Abb. 9a, b: Improvisiertes<br />
Grünparadies des Kleingewerberentners<br />
E. R; Finsches<br />
auf dem geteerten<br />
Kiesdach des Althauses<br />
Gerlgasse 16, 3. Bezirk in<br />
Wien.
Verglichen mit dem, was unsere Bautechnik heute alles fertigbringt,<br />
ist ein begehbares Flachdach mit Pflanzenkübeln und üppigen Containerbäumen<br />
ein geradezu bescheidener Aufwand, um den Menschen<br />
oben ein wenig von dem zurückzugeben, was man ihnen unten nimmt.<br />
Die Welt der Kinder in der <strong>Stadt</strong> - ein Indikator für soziale Politik<br />
Die Menschlichkeit einer <strong>Stadt</strong>politik erkennt man daran, wie sie mit<br />
den Schwachen verfährt, mit den Randgruppen unserer »Benzingesellschaft«,<br />
mit den Alten und mit den Kindern. Die Kinder der »Motornomaden«:<br />
wie Astronauten unbeweglich festgeschnallt am Rücksitz der<br />
Autos ihrer ruhelosen Eltern, hilflose Opfer rhythmischer »Völkerwanderungen<br />
aus Blech« (in Österreich nennen wir sie »Benzinhunnen«).<br />
Die empfindlichen Kleinen bekommen hier Kohlenmonoxydstöße und<br />
Abgaskonzentrationen in das Wageninnere, die zu den höchsten gehö-<br />
Abb. 10: Stundenlang niedergeschnallt wie Astronauten - die Kinder der Motornomaden<br />
(Photo Lötsch).<br />
47
en, die im Verkehrsgeschehen überhaupt gemessen werden, weil ja die<br />
Feiertagsspitzen oft höher als der Werktagsstau sind, und das Kind hat<br />
gar nichts von dieser hektischen Zwangsmobilität. Es ist nur außerordentlich<br />
gehemmt, beengt. Das Kind braucht keine großen Landschaften<br />
und Ferienziele, es braucht die »G'stetten« (d.h. unreglementierte,<br />
allmählich verwildernde Freiräume).<br />
Kinder brauchen »halbwilde Zustände«<br />
Ich bin als Fünf- bis Zehnjähriger außerordentlich glücklich auf den<br />
Ruinenfeldern von Wien aufgewachsen. Hundertwasser wird mißverstanden:<br />
Keiner von uns will deshalb Bomben schmeißen, obwohl ich mir bei<br />
manchen dieser riesigen Betonklötze schon eine Feldhaubitze wünschen<br />
würde (was nichts an meiner pazifistischen Grundeinstellung ändert), aber<br />
wir haben es noch in Erinnerung, wie sich solche G'stetten zum Erlebnisraum<br />
, zum artenreichen, stimulierenden Abenteuerspielplatz entwickeln,<br />
wo innerhalb von zwei Jahren eine reiche Ruderalflora wuchert, wo Kinder<br />
vom Marienkäfer bis zum Tagpfauenauge, vom Ailanthusspinner bis zum<br />
Laufkäfer alles finden. Kinder erleben Umwelt im Nahbereich, wie ein<br />
Naturfotograf mit der Makrolinse. Sie sind explorativ, sie wollen auch<br />
verändern, graben. Mitscherlich hat schon gesagt:<br />
»Der junge Mensch ist noch arm an höherer geistiger Leistungsfähigkeit,<br />
er ist weitgehend ein triebbestimmtes Spielwesen, er braucht deshalb<br />
seinesgleichen, nämlich Tiere, überhaupt Elementares - Wasser, Dreck,<br />
Erde, Gebüsch, Spielraum. Man kann ihn auch ohne das alles aufwachsen<br />
lassen - er überlebt es. Doch man soll sich dann nicht wundern, wenn<br />
er später bestimmte soziale Grundleistungen nie mehr lernt -z.B. Zugehörigkeitsgefühl<br />
zu einem Ort und Initiative.«<br />
Ein Landjunge kann sich eine Haselrute schneiden und damit Disteln<br />
köpfen - aber was soll denn so ein Kümmerkind auf Asphalt und Beton<br />
köpfen? Es zerlegt dann, wenn es älter wird, Telefonzellen, Parkbänke,<br />
es sieht Ersatzabenteuer auf der Straße und Ersatzerlebnisse im Rausch.<br />
Das ästhetische Gefühl und die Phantasie eines Menschen - sie<br />
werden nachhaltig von den Formerfahrungen seiner frühen Kindheit<br />
geprägt. Diese Grünanlagen, die aus der Nähe erforscht werden können,<br />
sind die ersten Erlebnisräume des Kindes. Sie sind Biotop für<br />
Blumen, Schmetterlinge, Käfer, Schnecken, Frösche, Eidechsen und<br />
Vögel. Und beobachten Sie Ihre Kinder, verfolgen Sie sie mit dem<br />
Teleobjektiv. Sie können hier wesentliche Aussagen machen über das,<br />
was unsere wertvollsten Geschöpfe, in denen alle unsere Hoffnungen<br />
liegen, wirklich brauchen - einen Auwaldtümpel, eine Schlammlache,<br />
Formbares, Veränderbares, Lebendiges. Ja, und das stellt man ihnen<br />
dann hin und sagt, man belebe die kindliche Phantasie, weil man den<br />
48
Abb. 11: Kinder brauchen »halbwilde Zustände«. Vergessene Baulücken, Unkraut<br />
und summende Sommerwiesen - Kinder wollen graben, abreißen, erhaschen<br />
- sie erleben die Natur im Nahbereich.<br />
49
Chlorkautschuklack des Betonbeckens eingefärbelt hat (Kinderplanschbecken<br />
aus der Olympiastadt bei München). Das ist ja fürchterlich! Sie<br />
werden jetzt verstehen, warum der Wildbiologe Antal Festetics, Konrad<br />
Lorenz und ich einen »Verein zur Herstellung und Erhaltung halbwilder<br />
Zustände« gegründet haben, wobei wir Louis Le Roy aus Holland,<br />
Friedensreich Hundertwasser aus Österreich und Bengt Warne aus<br />
Schweden als Ehrenmitglieder kooptieren. Und Rudolf Doernach ist<br />
ebenfalls in höchstem Maße verdächtig.<br />
Das ist das Entscheidende: Schaffung und Revitalisierung von Feuchtbiotopen.<br />
Wir haben jetzt seit Jahrzehnten Feuchtbiotope aus unserem<br />
Gesichtskreis verbannt: begradigt, verrohrt, zugeschüttet, planiert. Dafür<br />
taucht dann in Spielwarengeschäften eine zunehmende Zahl trauriger<br />
Ersatzobjekte - Plastikfrösche, Blechschildkröten, Kautschuksalamander<br />
- auf. Der lebende Frosch läßt keine Kasse klingeln. Der Kauf<br />
von Blechattrappen hebt das Bruttosozialprodukt. Sind diese kleinen<br />
Lebensräume - Gartenteiche, Tümpel, Naturgärten - auch oft nur Ersatznatur,<br />
so geben sie dem weltoffenen Neugierwesen Mensch doch vielfältige<br />
Stimulation und Experimentiermöglichkeiten. Sie vermögen zur<br />
Entwicklung von Naturliebe und Natursehnsucht beizutragen. Kinder<br />
zwischen monotonen Betonfassaden großzuziehen und ihnen dann noch<br />
ihre Spielwelt zu verbetonieren und sich mit kinderpsychologischen<br />
Stahlrohrgestellen auf Plastikrasen ein Alibi verschaffen zu wollen,<br />
bedeutet eine erschütternde Wohlstandsverarmung, eine Fehlprägung<br />
heranwachsender Kinder mit gefährlichen seelischen Langzeitfolgen. In<br />
manchen Gegenden der großen Städte - auch Wiens - gibt es die<br />
Schmetterlinge fast nur mehr auf den schönfärbenden Plakaten der<br />
Informationszentren der Gemeinde - »Freizeitstadt Wien«. Und sagen<br />
Sie mir nicht, daß Kinder diese Versteinerung und Verarmung nicht<br />
empfänden!<br />
Es ist uns ein herausgeschmuggelter Brief aus einem deutschen Konzentrationslager<br />
bekanntgeworden. Da hat ein kleines Mädchen nur<br />
diesen einen Satz daraufgeschrieben:<br />
»Hier gibt es keine Schmetterlinge.«<br />
City-farming - ein gelungenes Experiment in der großen <strong>Stadt</strong><br />
Es gibt überall aufgelassene Betriebsgelände, überwucherte Bahnkörper<br />
und dergleichen, so wie etwa hier in englischen Städten. Während sich<br />
die Spekulanten um diese Gelände noch stritten, haben Initiativgruppen<br />
einen Fonds gebildet, um sie für gemeinnützige Zwecke aufzukaufen.<br />
Man hat den Leuten Visionen vermittelt, bunte Bildtafeln aufgestellt<br />
wie »This could be a nature-reserve« oder »77z« could be a duckpond«<br />
(da könnte ein Ententeich sein). Man hat mit Enthusiasmus das Land an<br />
50
Pensionisten und Kinder verteilt - die einzige Auflage war, sich aktiv<br />
darum zu kümmern. Man hat sie selbst gestalten lassen, man hat<br />
parzelliert, man hat die Flächen den Benutzern persönlich zugeordnet,<br />
zur Betreuung anvertraut. Auch ich glaube, daß die persönliche Zuordnung,<br />
selbst von wenigen Quadratmetern Grün, wesentlich wichtiger ist<br />
als große, repräsentative, sterilgrüne Kommunalflächen, die nicht angenommen<br />
werden. So hat man die Aktion »City-farming« gestartet. Das<br />
Architektenehepaar Knights 3 in England ist hier führend. Und während<br />
sonst überall, wo Großstadtkinder hinkommen können, Schilder hängen<br />
»Nicht füttern« und »Nicht berühren«, »Nicht betreten«, heißt es hier<br />
»Phase touch the animals« oder »Come in and help us«. Aus leeren<br />
Magazinen hat man Pferdeställe und Schweineställe gemacht, die Kinder<br />
haben den Kontakt mit dem Elementaren, und für eine bestimmte<br />
Stundenzahl von Pferdepflege dürfen sie dann auch selbst reiten. Steigende<br />
Erlöse erzielen die City Farms alleine schon aus den Besuchen<br />
zahlreicher Schulklassen der näheren und weiteren Umgebung. Ein<br />
beispielhaftes Konzept zur Schaffung von mehr Selbständigkeit und<br />
Naturnähe in den großen Millionenstädten des angelsächsischen Raumes.<br />
Für unheilbare Autofetischisten bietet man sogar einige Reparaturplätze<br />
mit Schlauchanschluß für die rituellen Waschungen des Blechlieblings<br />
an. Interessanterweise - und dies bestätigte die Erwartungen<br />
der Planer - zieht es auch diese Typen alsbald in das pulsierende Farmund<br />
Gartenleben, denn auch dort werden Bastler benötigt - für sinnvollere<br />
Aufgaben als den Schwachsinn sonntäglicher Autowäsche.<br />
<strong>Stadt</strong>ökologie als Beschäftigungspolitik<br />
Ich möchte zum Schluß meiner verbalen Ausführungen noch einen ganz<br />
wichtigen Punkt anschneiden. Wir haben echte Arbeitslosenprobleme.<br />
Eine verlogene Propaganda in Österreich und Deutschland redet den<br />
Leuten ein, die Arbeitslosigkeit sei eine Folge der Energieverknappung<br />
und werde noch schlimmer werden, weil böse Umweltschützer gegen<br />
Kernkraftwerke demonstrieren.<br />
Kein einziger der 17 Millionen Arbeitslosen der OECD ist wegen<br />
Energiemangels arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit ist eine Folge der Überproduktion,<br />
weiters internationaler Marktsättigungen - etwa auf dem<br />
Grundstoffsektor - und schließlich eine Folge des Hinausrationalisierens<br />
von Arbeitskräften unter dem Druck des internationalen Wettbewerbs.<br />
Daher benötigen wir nun neue Strategien zur Arbeitsplatzsicherung,<br />
indem man etwa beschäftigungsintensive, aber ressourcenschonende<br />
Aktivitäten öffentlich fördert. Hier ist die Altstadtsanierung, die Altstadtrevitalisierung<br />
die beste Möglichkeit, um öffentliche Förderungsmilliarden<br />
für die Bauwirtschaft von umweltzerstörenden Projekten auf<br />
51
umweltschonende Qualitätsverbesserungen umzulegen. Auf derselben<br />
Ebene läge verstärkte städtische Grünraumpflege, die Schaffung von<br />
Radwegsystemen und - ebenfalls beschäftigungssichernde - Investitionen<br />
in den öffentlichen Verkehr. Hier von »Defizit« zu reden ist<br />
irreführend - er ist eine kommunale Dienstleistung, die zum Überleben<br />
des <strong>Stadt</strong>organismus nötig ist - ebenso wie Kanalisation, Müllabfuhr<br />
oder Wasserversorgung. Wie diese kann und muß er kein »Geschäft«<br />
sein. Profite machen die Gemeinden anderswo und »Defizite« erst recht.<br />
»Qualitatives Wachstum« am Beispiel Bauwirtschaft<br />
Das Wirtschaftswachstum seit den fünfziger Jahren hat nach Aussage<br />
kompetenter Denkmalpfleger mehr historische Bausubstanz und urbane<br />
Kulturgüter zerstört als die Bomben des Zweiten Weltkrieges. Anläßlich<br />
der Verleihung der Europa-Goldmedaille für Denkmalpflege an die<br />
<strong>Stadt</strong> Bamberg erklärte ihr Bürgermeister Mathieu (2. September 1977):<br />
»Sicherlich haben wir Bamberger unseren Weg nicht aufgrund unserer<br />
besseren Einsicht oder besonders ausgeprägter Liebe zu unserer <strong>Stadt</strong><br />
eingeschlagen. Wir hatten nicht genügend Geld, um mit reicheren Städten<br />
zum Beispiel beim Bau von Hochhäusern mitzuhalten... und Bamberg<br />
bekam anfangs nur wenige staatliche Finanzmittel für den Wohnungsbau.<br />
.. Wie oft wurden wir ah rückständig geschmäht, weil wir nicht auch<br />
so >modern< bauten wie andernorts. Heute sind wir aber alle - Kritiker<br />
und Kritisierte - froh, daß uns so manche Bausünde erspart blieb.«<br />
Trotz des katastrophalen Zusammenwirkens zwischen dem industrialisierten<br />
Fertigteilbauen hochmechanisierter Riesenunternehmen und<br />
einer Architektenmentalität, die seit den 20er Jahren mit traditionsfeindlichen<br />
Thesen jenen gerasterten Brutalismus auch ästhetisch zu rechtfertigen<br />
suchte, indem sie Gewaltakte aus Sichtbeton, Aluminium Und Glas<br />
mit dem Dogma in Altstadtensembles knallte: »gute Architektur paßt<br />
überall hin« - trotz alldem diesen Typus von Bauwirtschaft weiter zu<br />
fördern (weil Großunternehmen mehr politischen Einfluß haben als die<br />
kleinen) - das wäre nicht »konservativ«, sondern schlichtweg überholt<br />
und auch beschäftigungspolitisch dumm: denn diese hochrationalisierte<br />
Bauweise ist weniger Arbeitsplatzsicherung als vielmehr Maschinenamortisation<br />
(ähnlich dem heutigen Straßenbau, bei dem drei Gastarbeiter<br />
hinter einem landschaftsfressenden Riesenroboter einherschreiten -<br />
wenn etwa an einer einzigen Autobahnbaustelle 60 Mann 220 Millionen<br />
Schilling aus öffentlichen Geldern »ver«-bauen). Diese Großstrukturen<br />
verlangen ständig mit Aufträgen für riesige Bauvolumina gefüttert zu<br />
werden - mit einer kleinen Baulücke vermögen sie nichts anzufangen -,<br />
ihr unerschwinglicher Maschinenpark wird zum Mittel der Ausschließung<br />
gegenüber finanzschwachen Kleinunternehmern.<br />
52
Für die ökonomische Praxis muß die Konsequenz heißen:<br />
• Qualitätsorientierte, umweltkonforme Förderungsimpulse für die<br />
Bauwirtschaft in Form von Altstadtsanierung und -revitalisierung<br />
anstelle grünraumzerstörender Fertigteilkasernen und Profitquader<br />
am <strong>Stadt</strong>rand.<br />
Altstadtsanierung benötigt kaum technische Energie und wenig Rohstoffe,<br />
ist nicht mechanisierbar, sondern braucht hochqualifizierte<br />
Handwerker und Bauleute (die dafür neu geschult werden müssen -<br />
siehe Kurse in Krems als »Arche Noah für das Handwerk«), gibt<br />
vielen kleinen Baumeistern wieder eine Chance, schafft menschlich<br />
befriedigende Tätigkeiten, macht <strong>Stadt</strong>viertel wieder lebenswert und<br />
attraktiv, erhält kulturelle Werte...<br />
• »Beschäftigungspolitik ohne Marktsättigung«<br />
Dieser wirtschaftlichen Aktivität droht keine Sättigung; denn hat<br />
man eine <strong>Stadt</strong> wie Salzburg oder Krems von vorne nach hinten<br />
durchrenoviert, kann man wieder von vorne anfangen: ständiger<br />
Einsatz von Arbeit zur Erhaltung hochgeordneter kultivierter Strukturen<br />
(beinahe ein »biologisches Prinzip«, da es bei der Erhaltung<br />
von Organismen längst in analoger Weise verwirklicht ist).<br />
• Volkswirtschaftlich betrachtet: abgesehen von der Bauwirtschaft, hat<br />
ganz allgemein das Gewerbe in vielen Branchen echten Bedarf an<br />
Arbeitskräften, während die Industrie ihrem Wesen nach dazu geschaffen<br />
ist, menschlichen Arbeitseinsatz zu minimieren.<br />
Die Einrichtung eines gewerblichen Arbeitsplatzes erfordert im allgemeinen<br />
weniger Kapital und viel weniger Energie als die Schaffung eines<br />
industriellen Arbeitsplatzes (so hatte 1977 das österreichische Gewerbe<br />
mehr Beschäftigte als die Industrie).<br />
Können wir uns das überhaupt leisten?<br />
Wer glaubt, daß sich unsere moderne Gesellschaft handwerkliche<br />
Qualität nicht mehr leisten könne, sei daran erinnert: Die Nachfrage<br />
nach bestimmten Gütern und Leistungen ist wandelbar und Ausdruck<br />
herrschender Wertempfindungen. Galt Denkmalpflege und Altstadtsanierung<br />
gerade zur Zeit des Wirtschaftswunders als unerschwinglich, ist<br />
sie heute florierender Zweig des Baugewerbes.<br />
Was sich unsere Gesellschaft hingegen wirklich nicht mehr leisten<br />
dürfte - sich aber infolge überholter Wertvorstellungen noch immer<br />
leistet -, ist der hypertrophierende <strong>Stadt</strong>- und Landzerstörer Straßenbau<br />
- eine ausschließliche Frage staatlicher Förderungsmilliarden und<br />
nicht echter Nachfrage im Marktgeschehen. Man kann ohnehin keine<br />
Meßlatte mehr ins Erdreich treiben, ohne daß sich alsbald protestierende<br />
Bürger darum versammeln.<br />
Die einseitige Zweckbindung der Mineralölsteuer für die Förderung<br />
53
des rollenden Mineralölverbrauchs ist ähnlich unsinnig, als würde man<br />
die Alkoholsteuer ausschließlich zur Förderung des Saufens verwenden.<br />
Eine weitere, nicht mehr zeitgemäße Privilegierung des Straßenbauens<br />
ist das preislimitierte Vorkaufsrecht - eine Art staatlichen Enteignungsrechtes<br />
für Wohnhäuser und Gärten, um jede beliebige Trassenführung<br />
durchzusetzen. Wenn hingegen ein Bürgermeister Privatgründe<br />
ankaufen möchte, um daraus öffentlichen Erholungsraum und Kinderspielplätze<br />
zu machen oder darauf ein Pensionistenheim zu errichten,<br />
kann er auf dem freien Markt von Grundstücksspekulanten erpreßt<br />
werden. Was ich damit sagen will, ist dieses: Vieles in unserer Gesellschaft,<br />
das so furchtbar rational und ökonomisch wirkt, hat eigentlich<br />
irrationale Wurzeln. Auch das große, überlebenswichtige grüne Umdenken<br />
der kommenden Jahrzehnte wird streng rational nicht zu bewältigen<br />
sein. Jede geistige Revolution, jeder humanitäre Durchbruch und jede<br />
große kulturelle Leistung bekommt ihre starken Antriebskräfte aus dem<br />
Irrationalen, wird aus dem Emotionalen gespeist, dort wo auch unsere<br />
Wertempfindungen sitzen. Genau dies ist auch die große Aufgabe der<br />
künstlerischen Menschen auf diesem Simposium. Und an künstlerischen<br />
Impulsen für eine Trendwende hatte es hier in den letzten zwei<br />
Tagen wahrlich nicht gefehlt. Das gibt mir Hoffnung. Und die Farbe der<br />
Hoffnung ist seit jeher »Grün«.<br />
Anmerkungen<br />
1 Deshalb sind Sozietäten, in denen das Zusammenleben in Großfamilien und<br />
Sippen vorherrscht, dichte toleranter als solche, die aus Kleinfamilien bestehen<br />
(vgl.: Cairo, Hongkong u.a. Entwicklungsländer).<br />
2 Siehe dazu auch: Wohnmedizin 11. Jg. H. 5-6, S. 47, 1973, 10. Jg. H. 1, S. 4,<br />
1972, 12. Jg. H. 1-2, 1974.<br />
3 City Farms, 15 Wilkin Street, London NW 5, 3 NG, England, GB.<br />
Literatur<br />
Fathy Hassan 1973, Architecture for the poor - An Experiment in Rural Egypt.<br />
The University of Chicago Press, Chicago and London, (Zweite Auflage) 1976,<br />
232 Seiten und Bildanhang. 132 Illustrationen. Erstveröffentlichung: Gourna:<br />
A tale of two villages, Ministry of Culture, Cairo 1969<br />
Guttmann, G., Kühberger, F. 1974, Wohnerfahrung und Wirtschaftlichkeit einer<br />
fußläufigen Gartenstadt. (Ein- und Mehrfamilienhäuser aus der Sicht ihrer<br />
Bewohner) Studie der Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen,<br />
Wien 1974, 48 Seiten<br />
Keller, Rolf 1978, Am Leben vorbei normiert. Beobachtungen zum unterdrückten<br />
Identifikationsbedürfnis; Separatdruck aus Werk Antithese Nr. 21-22/1978<br />
Keller, Th. 1974, Über die Filterwirkung von Hecken für verkehrsbedingte<br />
54
staubförmige Luftverunreinigungen, insbesondere Bleiverbindungen; Schweizerische<br />
Zeitschrift für Forstwesen, 125. Jahrgang, Nr. 10, S. 719-735<br />
Könnecke, K.-R. 1979, Wenn Häuser aus der Reihe tanzen. Seldwyla (Schweizer<br />
Ausbruch aus genormter Wohn-Langeweile) und Klostermuren (Schwedisches<br />
Planspiel für mündige Bauherren). In: Hauser Schöner Wohnen, Nr. 2, 1979,<br />
S. 75-90<br />
Le Corbusier 1926, Kommende Baukunst; Berlin, Leipzig, 253 Seiten.<br />
Le Roy, Louis 1978, Natur ausschalten - Natur einschalten; Stuttgart.<br />
Lötsch, Bernd 1974, Die Pflanze im menschlichen Lebensraum - Sauerstoff-<br />
Frage und Klimawirkung. In: Natur und Land, Heft 4/5, 60. Jahrgang, 1974,<br />
S. 87-106. Herausgeber: Österreichischer Naturschutzbund<br />
Lötsch, Bernd 1979, Städtebau heute - Krise der Technokratie. In: Scheideweg<br />
(Klett-Cotta, Stuttgart) 9. Jahrgang, Heft 1, 1. Quartal 1979, S. 79-88<br />
Lötsch, Bernd 1981, Zwischen Häusle und Horror. In: Natur (Horst Sterns<br />
Umweltmagazin), Nr. 6, Juni 1981, S. 33-40, Zürich, München<br />
Newman 1972, Defensible Space - Crime Prevention through Urban Design;<br />
New York<br />
Rainer, R. 1978, Kriterien der wohnlichen <strong>Stadt</strong>. Trendwende in Wohnungswesen<br />
und Städtebau; Graz<br />
Rebsamen, Hanspeter 1978, Siedlung »Seldwyla« alias Rockwil. Ein Modellfall;<br />
Separatdruck aus Werk Antithese, Nr. 21-22/1978<br />
Schäfer, Ueli 1979, Herausgefordert - Bewohner und Architekten diskutieren<br />
mit Journalisten. Siedlung »Seldwyla« Zumikon. In: Bauen und Wohnen, 1/2,<br />
1979, S. 6-11<br />
Schneider, Hans Joachim 1978, <strong>Stadt</strong>planung und Verkehrsbekämpfung; Manuskript<br />
des Rundfunkvortrages Süddeutscher Rundfunk, Studio Heidelberg,<br />
»Lebendige Wissenschaft« (Red. Johannes Schlemmer) 20. August 1978,<br />
10.30-11.00, SF 2<br />
Weichinger, R., Schulz, W., Graefe, G. 1973, Kriterien der Wohnungsgestaltung;<br />
Forschungsbericht - Wohnbauforschung. Bundesministerium für Bauten und<br />
Technik-Wien, Juni 1973<br />
55
Friedensreich Hundertwasser<br />
Humanisierung der städtischen<br />
Umwelt - die Kehrtwendung<br />
Nur wenn Architekt, Maurer und Bewohner eine Einheit, eine Dreieinigkeit<br />
sind, d.h. ein und dieselbe Person, kann man von Architektur sprechen.<br />
Alles andere ist keine Architektur, sondern eine verbrecherische<br />
gestaltgewordene Tat. Die kaputte Dreieinigkeit der Architektur ist:<br />
• Der Architekt hat keine Beziehung zum Haus. Er kann die Bedürfnisse<br />
des Bewohners nicht voraussehen.<br />
• Der Maurer hat keine Beziehung zum Haus. Es ist ihm ganz egal. Er<br />
tut es nur fürs Geld.<br />
• Der Bewohner hat keine Beziehung zum Haus. Er hat es ja nicht<br />
gebaut. Sein menschlicher Raum wäre ganz anders.<br />
Schon das Bei-sich-Tragen einer geraden Linie müßte, zumindest moralisch,<br />
verboten werden. Das Lineal ist das Symbol des neuen Analphabetentums.<br />
Das Lineal ist das Symptom der neuen Krankheit des<br />
Zerfalls.<br />
Wir leben heute in einem Chaos der geraden Linien. Wer dies nicht<br />
glaubt, der gebe sich einmal die Mühe uiid zähle die geraden Linien, die<br />
ihn umgeben, und er wird es begreifen, weil er niemals ans Ende<br />
gelangen wird.<br />
Vor nicht allzu langer Zeit war der Besitz der geraden Linien ein<br />
Privileg der Könige, der Begüterten und der Gescheiten. Heute besitzt<br />
jeder Trottel Millionen von geraden Linien.<br />
Dieser Urwald der geraden Linien, der uns immer mehr wie Gefangene<br />
in einem Gefängnis umstrickt, muß gerodet werden. Jede moderne<br />
Architektur, bei der das Lineal oder der Zirkel auch nur eine Sekunde<br />
lang - und wenn auch nur in Gedanken - eine Rolle gespielt hat, ist zu<br />
verwerfen. Gar nicht zu reden von der Entwurf-, Reißbrett- und Modellarbeit,<br />
die nicht nur krankhaft steril, sondern wahrhaft widersinnig<br />
geworden ist.<br />
Die gerade Linie ist gottlos und unmoralisch. Die gerade Linie ist<br />
keine schöpferische, sondern eine reproduktive Linie. In ihr wohnt nicht<br />
Gott und menschlicher Geist, sondern nur die bequemheitslüsterne<br />
gehirnlose Massenameise.<br />
56
Aus dem Verschiinmelungsmanifest<br />
Wefln sich an einer Rasierklinge der Rost festsetzt, wenn eine Wand zu<br />
schimmeln beginnt, wenn in einer Zimmerdecke das Moos wächst und<br />
die geometrischen Winkel abrundet, so sollman sich doch freuen, daß<br />
mit den Mikroben und Schwämmen das Leben in das Haus einzieht und<br />
wir so bewußter als jemals zuvor Zeugen von architektonischen Veränderungen<br />
werden, von denen wir viel zu lernen haben.<br />
Um die funktionelle Architektur vor dem moralischen Ruin zu retten,<br />
soll man auf die sauberen Glaswände und Betonglätten ein Zersetzungsprodukt<br />
gießen, damit sich dort der Schimmelpilz festsetzen kann.<br />
Die materielle Unbewohnbarkeit der Elendsviertel ist der moralischen<br />
Unbewohnbarkeit der funktionellen, nützlichen Architektur vorzuziehen.<br />
In den sogenannten Elendsvierteln kann nur der Körper des<br />
Menschen zugrunde gehen, doch in der angeblich für den Menschen<br />
geplanten Architektur geht seine Seele zugrunde. Daher ist das Prinzip<br />
der Elendsviertel, d. h. der wild wuchernden Architektur, zu verbessern<br />
und als Ausgangsbasis zu nehmen und nicht die funktionelle Architektur<br />
(Hervorhebung des Herausgebers).<br />
Falls das Haus dazu bestimmt ist, Menschen in seinem Inneren zu<br />
beherbergen, so ist der Abbruch der Bautätigkeit vor Einzug des<br />
Menschen als widernatürliche Sterilisierung des Wachstums und somit<br />
als kriminelles Vergehen zu betrachten und zu ahnden.<br />
Berlin - die zusammengefallene Kongreßhalle<br />
Berlin hat eine große Chance.<br />
Das teilweise • Zusammenfallen der Kongreßhalle und die dadurch<br />
entstandene gottgewollte Formenwelt ist ein Geschenk, das wir mit<br />
Dankbarkeit entgegennehmen.<br />
Bombentrichter sind schön. Wenn die Natur die Kongreßhalle formal<br />
verbessert hat, so hat das einen tiefen Sinn, den wir nicht zerstören und<br />
nicht eliminieren dürfen. Die Kongreßhalle wird so die erste mit viel<br />
Liebe konservierte Ruine der bankrotten rationellen Architektur. Nur<br />
ist das dann keine Ruine mehr, sondern ein echt funktionierendes Haus,<br />
das man benutzt, das man liebt, weil es sich wandelt und erneuert so wie<br />
eine alte Eiche. So beginnt von Berlin aus eine neue Ära der wahren,<br />
lebenden, sich stets wandelnden Architektur, die nicht mehr auf zerstörter<br />
Natur aufgebaut ist, sondern im Einklang mit der Natur ist, die die<br />
Entfaltung der Natur ermöglicht und selbst Natur ist.<br />
Es gibt keinen besseren Baumeister als das Schicksal, als die Natur,<br />
als den Zufall oder wie man es immer nennen mag. Daher ist der jetzige<br />
57
Ruinenstand sorgfältig und gewissenhaft zu konservieren, zu akzentuieren<br />
und bautechnisch zu stabilisieren. Die Konstruktion muß verstärkt<br />
werden durch schöne Säulen usw., damit sie stark genug ist, um oben<br />
auf dem Dach einen wild gewachsenen Wald zu tragen, so wie in der<br />
freien Natur. Das wäre eine mutige Konzeption unter Einbeziehung der<br />
vorhandenen Bausubstanz, die neue Maßstäbe setzt.<br />
Wir leben am Beginn einer neuen Evolution, bei der die uns von der<br />
Natur geschenkten Unregelmäßigkeiten zu ehren und zu achten sind.<br />
Die uns von Architekten und Bauherren oktroyierte Sterilität, die sich<br />
herzlos des Lineals und Reißbretts bedienen, hat sich international als<br />
eine groteske Pleite erwiesen, die den modernen Menschen schädigt.<br />
Die sterile symmetrische vorfabrizierte Architektur führt den Menschen<br />
nicht in eine bessere, schönere Welt, sondern ganz im Gegenteil, in<br />
Versklavung, Unglück und Verlust der Menschenwürde.<br />
Deswegen wäre es von größter Bedeutung, daß an einem »beispielhaften«<br />
Bau wie die Berliner Kongreßhalle einer breiten Weltöffentlichkeit<br />
demonstriert wird, wie der Tyrann Architektur auf ganz natürliche,<br />
selbstverständliche Art mit Hilfe eines natürlichen Kreislaufes wieder zu<br />
einem beispielhaften Bauwerk wird. Das heißt ein beispielhaftes Bauwerk<br />
unter anderem Vorzeichen. Ein Bauwerk, das sozusagen die<br />
Fronten wechselt.<br />
Mit einem beispielhaften Bauwerk der rationellen Architektur wird<br />
ein zukunftsweisendes Bauwerk der ökologischen Architektur. Die<br />
Kongreßhalle soll als Mahnmal und Symbol dafür stehen, daß der<br />
Mensch mit seinem giftigen sterilen Intellekt die Natur vergewaltigen<br />
kann und darf. Die Kosten, um das Bestehende zu erhalten und noch zu<br />
verbessern, sind ein Bruchteil einer totalen Wiederherstellung oder<br />
eines Neubaues. Die nationale und internationale Wirkung eines solchen<br />
Vorgehens ist immens, da sie Pioniercharakter hat.<br />
<strong>Öko</strong>logie und Architektur<br />
Um glücklich zu sein, braucht der Mensch keinen äußeren Reichtum,<br />
sondern einen inneren Reichtum der Seele. Um glücklich zu sein,<br />
braucht der Mensch keine mechanische Energie, sondern eine innere<br />
schöpferische Energie. Der heutige Mensch ist das gefährlichste Ungeziefer,<br />
das die Erde je bevölkert hat. Der Mensch ist ein ökosystemfremder<br />
Schädling geworden. Perfekte <strong>Öko</strong>logie muß den Menschen in seine<br />
ökologischen Schranken verweisen, damit sich die Erde regenerieren<br />
kann. Der wahnsinnige unbegründete Verbrauch des Menschen muß<br />
einer verantwortungsbewußten, schöpferischen Intelligenz entsprechen.<br />
Der Mensch ist ein dummes Herdentier geblieben, das plötzlich<br />
58
irrsinnige Mengen von Energie, Giften und anderen Mordmitteln zur<br />
Verfügung hat, die er wild verpulvert oder rücksichtslos zur Vernichtung<br />
der Umwelt und der eigenen Brüder einsetzt. Und gierig verlangt dieser<br />
Mensch, dieses dumme Herdentier, nach noch mehr Energie, noch<br />
mehr Giften und noch mehr Mordmitteln. Atomenergie ist eine wirtschaftliche<br />
und eine ökologische Katastrophe. Atomenergie kommt uns<br />
teuer zu stehen, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch. Der Mensch,<br />
besonders die sogenannten Experten, haben die Kontrolle über die<br />
Energiehebel verloren. Sie wissen nicht mehr, was sie tun.<br />
Es gibt kein sicheres Versteck oder Depot für nuklearen Abfall, auch<br />
nicht in scheinbar vorläufig erdbebenfreien Gebieten. Wissen wir, wo<br />
die Inkas; wo die Karthager Dinge vergraben haben? Und das ist erst<br />
2000 Jahre her. Wissen wir, wo unsere Großmutter ihre Goldmünzen<br />
versteckt hat? Und das ist erst 50 Jahre her. Nuklearer Abfall aber bleibt<br />
500000 Jahre todesgefährlich für alles Leben. Atommüll läßt sich nicht<br />
vergraben wie eine schöne Leiche. Atommüll wird nicht zu Humus.<br />
Einstein hat gesagt: Wenn die Formel nicht schön ist, kann sie auch<br />
nicht richtig sein. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die<br />
Funktionalisten, Rationalisten und Technokraten predigen.<br />
Nicht ohne Grund waren die ersten technischen Einrichtungen vor<br />
hundert Jahren noch schamhaft verkleidet - die Autos als Pferdekutschen,<br />
die Maschinen, Aufzüge, Telefone, Gaslaternen, elektrischen<br />
Luster, Metro- und <strong>Stadt</strong>bahnaufgänge als Kunstwerke, die jetzt im<br />
Museum stehen. Man wußte damals sehr genau, daß technische Rationalität<br />
eine Sünde ist, und hat sie hinter Kunst versteckt.<br />
Heute erleben wir den Triumph der rationellen Technik, stehen<br />
jedoch gleichzeitig vor dem Nichts. Ästhetische Leere, uniforme Wüste,<br />
mörderische Sterilität, schöpferische Impotenz.<br />
Den Architekten entgleitet die Verantwortung ihres Tuns. Die Architekten<br />
bauen verbrecherisch und menschenunwürdig oder zu Beton<br />
gewordene Schnapsideen. Sie bauen Gefängniszellen, in denen die Seele<br />
des Menschen zugrunde geht. Der Architekt handelt wie ein Kriegsverbrecher.<br />
Der befolgt gehorsam Befehle auch gegen sein Gewissen.<br />
Auch den Malern entgleitet die Verantwortung ihres Tuns. Der moderne<br />
Künstler hat sich zu einem Möchte-gern-Diktator entwickelt.<br />
Entfremdet von den Gesetzen der Natur und von dem, was der Mensch<br />
braucht und wonach der Mensch sich sehnt. Moderne Kunst ist eine<br />
intellektuelle Onanie geworden, erzwungen als kurzlebiges Statussymbol,<br />
häßlich, kalt, gottlos, herzlos. Die Künstler und Architekten hätten<br />
aber gerade jetzt eine Pflicht zu erfüllen als Warnende und Auswegsuchende.<br />
Nur wer nach den Gesetzen der Natur und Vegetation und im Einklang<br />
mit dem kosmischen Kreislauf lebt, kann nicht fehlgehen. Wer<br />
59
sich gegen diese Gesetze stellt, sei es aus Überheblichkeit, sei es aus<br />
Unterwürfigkeit, wird mitverantwortlich am Zusammenbruch und geht<br />
zugrunde.<br />
Es geht nicht an, daß Industrien Kläranlagen verhindern, die aufgrund<br />
natürlicher Prozesse funktionieren, weil sie dann ihre hochtechnisierten,<br />
komplizierten, häßlichen und teuren Kläranlagen nicht verkaufen<br />
können. Eine natürliche Kläranlage ist schön wie ein Paradiesgarten<br />
und kostet nichts. Das ist nur ein Beispiel, wie <strong>Öko</strong>logie schöpferisch<br />
und im Einklang mit der Natur gehandhabt werden muß.<br />
Sonnenkollektoren, Windmühlen, Gasometer, Segelschiffe können<br />
nur funktionieren, wenn sie schön sind. Wenn sie häßlich sind, funktionieren<br />
sie falsch.<br />
Die neue Revolution wird von der Basis her, vom Volk ausgehend,<br />
den diktatorisch aufgezwungenen, präfabrizierten Wohnbau hinwegfegen.<br />
Die neue Revolte wird schöpferisch und schön sein. Die herzlose<br />
Rationalität der Wohnsilos wird von außen nach innen zerfressen<br />
werden.<br />
Das Fensterrecht garantiert das.<br />
Das Anrecht des Menschen auf seine dritte Haut, seine Innen- und<br />
Außenwände. Wir sind Gast der Natur und müssen die freie Natur auf<br />
unsere Dächer zurückbringen.<br />
Wir brauchen Schönheitshindernisse. Diese Schönheitsbarrieren bestehen<br />
aus nicht reglementierten Unregelmäßigkeiten. Nur mit ihrer<br />
Hilfe können wir den Kampf gegen die gerade Linie gewinnen und zu<br />
einem natur- und menschengerechten Leben zurückkehren. Wir brauchen<br />
Schönheitsbarrieren, damit die Welt größer wird. Wenn du und der<br />
Nachbar schöpferisch tätig sind, braucht man nicht weit zu reisen, nicht<br />
weit zu gehen, denn das Paradies ist um die Ecke.<br />
60
Helmut Creutz<br />
<strong>Öko</strong>logie und <strong>Öko</strong>nomie<br />
Wenn die von uns gebauten Häuser nach 20-30 Jahren immer wieder<br />
rissig würden und einzustürzen drohten, dann würden wir ganz gewiß<br />
mit allen Kräften nach den Ursachen forschen. Wären sie im Fundament<br />
zu finden, würden wir dasselbe verstärken und bei allen Folgebauten die<br />
Berechnung korrigieren.<br />
Wenn die von uns geschaffenen »Wirtschaftsgebäude« nach 20-30<br />
Jahren immer wieder »rissig« werden (Inflation, Arbeitslosigkeit,<br />
Staatsverschuldung usw.) und die Einsturzgefahr bedrohlich wächst<br />
(Pleiten, Staatsbankrott und Kriegsbedrohung), kurieren wir jedoch nur<br />
an den Symptomen herum. Das »Fundament« von Wirtschaft und<br />
Gesellschaft, die Geld- und Währungsordnung, bleibt von der Überprüfung<br />
ausgeschlossen. Einigen der »Risse« im »Wirtschaftsgebäude« wollen<br />
wir deshalb einmal konkreter nachgehen. Dabei sollen sowohl die<br />
ökologischen wie die ökonomischen Auswirkungen der »Fehlkonstruktion<br />
im Fundament« verdeutlicht werden.<br />
1. <strong>Öko</strong>nomische Aspekte<br />
a) Warum sind die Neubaumieten häufig unbezahlbar?<br />
Selbst in Fachveröffentlichungen wird als Grund der überhöhten Neubaumieten<br />
immer wieder der Anstieg der Baukosten genannt. Diese<br />
aber sind, wie auch die allgemeinen Marktmieten, bedeutend langsamer<br />
gestiegen als die Löhne - wie die erste Abbildung zeigt -. Nur die<br />
kalkulatorischen Kostenmieten schießen unregelmäßig immer wieder<br />
über die Lohnentwicklung hinaus.<br />
b) Woraus setzt sich ein Preis zusammen?<br />
Alle Preise bestehen aus sach- und kapitalbezogenen Kosten. Nur für<br />
die erstgenannten erhalten wir bei Kauf und Nutzung eine Gegenleistung,<br />
die zweiten verteuern lediglich den Preis.<br />
61
Die absolute Größe des kapitalbezogenen Preisanteils resultiert aus<br />
Kapitaleinsatz mal Zins. Die relative Größe im Gesamtpreis hängt vom<br />
Umfang der sachbezogenen Kosten ab, also Löhnen, Material, Abschreibungshöhe<br />
usw. In Abb. 2 ist das an einigen Beispielen aufgezeigt.<br />
c) Warum ist der Zinsanteil in Mieten so besonders hoch?<br />
Dies ist darum der Fall, weil in der Wohnungsmiete dem kapitalbezogenen<br />
Anteil nur relativ geringe sachbezogene Kosten gegenüberstehen,<br />
einschließlich einer extrem geringen Abschreibung. Je nach Zinssatzhöhe<br />
schwankt der Kapitalanteil zwischen 50 und, 80 % der Miete (siehe<br />
Abb. 3), und eine Zinserhöhung um einen Punkt wirkt sich als Mieterhöhung<br />
von etwa 10-14% aus. Damit werden auch die »Ausreißer« in<br />
Abb. 1 verständlich, die jeweils aus Hochzinsphasen resultieren. Die<br />
letzte Hochzinsphase, mit einem Zinsanstieg von rund 5%, hat die<br />
Neubau-Kostenmiete um etwa 60% verteuert.<br />
d) Was bewirkt der Zinsanteil in allen Preisen?<br />
Der Zinsanteil bewirkt nicht nur eine Verteuerung der Güter und<br />
Leistungen ohne Erhöhung des Gegenwertes, sondern auch eine Einkommensumverteilung<br />
von den Leistenden zu den Besitzenden.<br />
Die Höhe der Verluste für den Verbraucher hängt von der Summe<br />
seiner Ausgaben ab (Preise, Steuern und Gebühren). Sie liegen im<br />
Mittel etwa zwischen 20 und 30 Prozent derselben.<br />
Die Höhe der Gewinne aus dem Zinstransfer hängt von der Größenordnung<br />
des eingesetzten Kapitalbesitzes ab, über den ein Haushalt<br />
verfügt. Dieser steigt von Null auf mehrere Mrd. an.<br />
Beide Größen - Gewinne wie Verluste - wachsen mit dem ständig<br />
zunehmenden Kapitaleinsatz und werden durch jeden Zinssatzanstieg<br />
zusätzlich verstärkt. Da Ausgaben und Kapitalbesitz der Haushalte<br />
nicht gleichmäßig verteilt sind, klaffen auch die Vor- und Nachteile des<br />
Zinssystems entsprechend auseinander. Verteilt man alle Haushalte<br />
nach Einkommen und Vermögen auf 10 gleich große Gruppen, dann<br />
ergibt sich das in Schaubild 4 gezeigte Ertrags- und Lastenbild (siehe<br />
Abb. 4).<br />
62
Abb. 1: Entwicklung der Mieten, Einkommen und Preise (1962 = 100)<br />
63
Abb. 2: Konkrete<br />
Beispiele<br />
für Zinsanteile<br />
in Preisen und<br />
Gebühren<br />
Erläuterungen<br />
Die absolute Größe des in die Preise eingehenden Zinsanteils<br />
wird einmal von der Kapitalgröße bestimmt und zum -anderen von<br />
der jeweilig zum Ansatz kommenden Zinshöhe. Ein Anstieg der<br />
2insen von z.B. 5 auf 7,5# lassen also den absoluten Zinsanteil<br />
um die Hälfte ansteigen.<br />
Die relative Größe des Zinsanteils im Gesamtpreis wird von der<br />
Größe der anderen in den Preis eingehenden Kosten bestimmt, in<br />
oft entscheidendem Umfang z. B. von den jeweiligen Personaikosten<br />
oder der Abschreibung.<br />
Investiert beispielsweise jemand loo.ooo DM in Mietwagen, die<br />
in fünf Jahren abgeschrieben werden müssen, dann beträgt die<br />
Abschreibung jährlich 1/5 des Kapitals = 2o.ooo DM.<br />
Bei einer gleichhohen Investition in Mietwohnungen, bei denen<br />
von einer hundertjährigen Nutzungsdauer ausgegangen wird, beträgt<br />
die Abschreibung jährlich nur 1/1OO des Kapitals = 1.000<br />
DM.<br />
Da der Zinsanteil, bei angenommenen 6?S, in beiden Fallen jedoch<br />
mit 6.000 gleich ist, wird der relative Zinsanteil in den<br />
Preisen also von der AbschreibungshÖhe stark beeinflußt.
Angenommene Werte:<br />
Bau- und Nebenkosten je qm Wohnfläche DM 2.25o<br />
Bodenkosten je qm Wohnfläche DM 25o<br />
Gesamtkosten je qm Wohnfläche: DM 2.5oo<br />
Mietausfallwagnis<br />
2% der Gesamtmiete<br />
Verzinsung des eingesetzten<br />
Kapitals<br />
(darin Zinsanteil<br />
für Boden)<br />
Verwalfungsko st en<br />
Instandhaltung<br />
Betriebskosten<br />
Abschreibung<br />
1,25$S der Bauk.<br />
Abb. 3: Zusammensetzung der Kostenmiete je Quadratmeter Wohnfläche und<br />
ihre Veränderung bei unterschiedlicher Kapitalverzinsung von 4 bis 10 %<br />
65
Angesetzter Habenzins im Durchschnitt 5,3<br />
Alle Werte in Tsd DM je Haushalt<br />
Zinslasten in<br />
Tsd DM de HH :<br />
Zinserträge in<br />
Tsd DM je HH :<br />
Zinssalden :<br />
2,3<br />
o,5<br />
1,7<br />
4,1<br />
o,7<br />
5,9<br />
1,1<br />
6,5<br />
1,5<br />
7,6<br />
2,3<br />
9,1<br />
3,2<br />
3,* 4,8 5,o 5,3 5,9<br />
1oß 13,5 16,5 32,3<br />
5,5<br />
5,o<br />
8,8 18,o 66,5<br />
+<br />
*,7 1,7 34,2<br />
Abb. 4: Gegenüberstellung der Zinsbelastungen und -ertrage der Haushalte<br />
aufgeteilt auf zehn Gruppen mit je 2,5 Mio. Haushalten<br />
66
e) Was ist die Folge dieser Einkommensumschichtung?<br />
Wie wir aus der Abbildung erkennen, ist der Saldo zwischen Lasten und<br />
Erträgen nur bei den zwei reichsten Haushaltsgruppen positiv. Im<br />
gleichen Maße, wie etwa 15% der Haushalte gewinnen, müssen 85%<br />
verlieren. Die sowieso schon Überreichen werden also durch den Zinstransfer<br />
noch reicher. Geht das Wirtschaftswachstum gegenüber dem<br />
des Kapitals zurück, wird der Umschichtungsprozeß beschleunigt, und<br />
damit die Zunahme der Sozialprobleme.<br />
2. <strong>Öko</strong>logische Aspekte<br />
a) Was hat die Geldordnung mit Wachstum zu tun?<br />
Jedes gesunde und natürliche Wachstum kennt optimale Grenzen und<br />
Größen. Anfangs sehr rasch zunehmend, geht es mit meist kleiner<br />
werdenden Wachstumsschritten in eine stabile Phase und aus quantitativem<br />
in qualitatives Wachstum über.<br />
Exponentielles Wachstum zeigt - wie aus Abb. 5 ersichtlich - genau den<br />
gegenteiligen Verlauf. Dieses Wachstum kann darum als krankhaft und<br />
widernatürlich bezeichnet werden, mit Wucherungen vergleichbar.<br />
Gleichbleibend prozentuales Wachstum ist mit exponentiellem identisch.<br />
Durch den Zinseszinseffekt wächst also jedes Kapital auf exponentielle<br />
Weise mit Verdoppelungsraten. Wachsendes Kapital verlangt<br />
jedoch nach zusätzlichen Kapitalanlagen und erzeugt damit einen ansteigenden<br />
Wachstumsdruck auf Produktion und Verbrauch, notfalls über<br />
kontramenschliche Investitionen wie Ramsch und Wegwerfgüter, unnötige<br />
Atomspaltwerke, Startbahnen und Kanäle, Raumfahrt, Rohstoffverbrauch<br />
und Rüstung, ohne Rücksicht auf Umwelt, Erde und Zukunft.<br />
b) Wohin führt exponentielles Wachstum?<br />
Eine Krebsgeschwulst, die schneller als der Gastorganismus wächst, in<br />
dem sie lebt, oder die bei einem nicht mehr wachsenden Gastorganismus<br />
weiterwächst, führt zunehmend zu Komplikationen und Krisen und<br />
schließlich zum Kollaps desselben.<br />
Das gilt auch für ein Wirtschaftswachstum, das keine Rücksicht auf<br />
unseren »Gastorganismus« Erde nimmt. Ein Ausstieg aus dem langgepflegten<br />
Wachstumswahn ist darum dringend erforderlich. Selbst ein<br />
Wachstum von »nur« 2,7 Prozent würde den Verbrauchszuwachs der<br />
67
1i Grundsätzliche Arten von<br />
Wachstumsabläufen<br />
Zunahme<br />
2. Prozentual gleichbleibende<br />
Wachstumsablaufe<br />
Vervielfachung<br />
Abb. 5: Verschiedenartige Wachstums- und prozentuale Vermehrungsabläufe<br />
68
DARSTELLUNG NR. 1<br />
aus: "Überwindung der Wirtschaftskrise durch Verzicht<br />
auf Wachstum" Er. ing. Friedrich Feldmann<br />
eigene Ergänzung:<br />
. . . . a) wahrscheinlicher Verlauf ohne Weltkriege<br />
ooo b) wünschenswerter Auslauf des realen Wachstums<br />
Abb. 6: Die Entwicklung des Bruttosozialproduktes seit 1700 in realen<br />
Preisen von 1970<br />
69
letzten drei Jahrzehnte in kaum 20 Jahren nochmals verdoppeln (siehe<br />
Abb. 6). .<br />
Anstelle des schon lange überzogenen quantitativen Wachstums muß<br />
darum ein qualitatives treten (Kultur, Bildung, Freizeit, Verbesserung<br />
der Umwelt-, Zukunfts- und Gesundheitsbedingungen). Diesem notwendigen<br />
und not-wendenden Umschwanken aber stehen heute noch<br />
die Kapitalinteressen entgegen.<br />
c) Welche Probleme gibt es noch durch Kapitalwachstum?<br />
Wenn ein wachsender Organismus sich vergrößert, können dies im<br />
gleichen Maß auch seine Teile tun. Das Wachstum unserer wirtschaftlichen<br />
Organismusteile aber driftet zunehmend auseinander.<br />
Wie Abb. 7 zeigt, sind Leistung, Löhne und Staatseinnahmen in den<br />
letzten 14' Jahren etwa auf das Dreifache gestiegen. Die kapital- und<br />
zinsbezogenen Größen sind jedoch in der gleichen Zeit auf ein Mehrund<br />
Vielfaches hochgeschossen. Mit diesen Diskrepanzen müssen<br />
zwangsläufig auch die Probleme in unserem Wirtschaftsorganismus größer<br />
werden.<br />
d) Gibt es auch im Wohnungsbau Wachstumsprobleme?<br />
Da die Bevölkerung nicht mehr zunimmt, kann auch das Tempo des<br />
Wohnungsbaues der letzten 30 Jahre unmöglich weitergehen. Außerdem<br />
liegen wir in der Wohnungsversorgung weltweit in der Spitzengruppe (s.<br />
Abbildung 8 und 9). Was bei uns allenfalls vonnöten ist, das ist eine<br />
gerechtere Verteilung der Wohnflächen und der Wohnungskosten.<br />
Jede zusätzliche Ausweitung des Wohnungsbestandes verbietet sich<br />
allein aus Umwelt- und Ressourcengründen. Statt Weiterbauen und<br />
Totalsanierung ist darum eine pflegliche Bestandserhaltung gefordert.<br />
Doch auch hier gibt es den Widerstreit zwischen Vernunft und Kapitalinteressen.<br />
3. Zinsfunktion und Wege zur Problemlösung<br />
Der Zins sorgt heute (wie z. T. die Inflation) für den Umlauf des<br />
Geldes. Der Zinsen wegen bringt man überschüssiges Geld zur Bank,<br />
und diese schleust es über Kredite wieder in den Geld- und Wirtschaftskreislauf<br />
ein. Das ist erforderlich, um Störungen im Marktgeschehen zu<br />
vermeiden.<br />
70
Abb. 7: Anstieg verschiedener Wirtschaftsindikatoren von 1968-1982<br />
Der Zins erfüllt die Rolle des »Umlaufsicherers« jedoch nur bis zu<br />
einem gewissen Grade und nicht gleichmäßig genug. Außerdem sind -<br />
wie wir gesehen haben - mit ihm negative Nebenwirkungen verbunden,<br />
die mit der Zeit zumeist noch größer werden:<br />
• Er bewirkt eine ständige und ständig zunehmende Einkommensumschichtung<br />
von den Leistenden zu den Besitzenden.<br />
• Er erzwingt über die Kapitalakkumulation einen ständigen und zunehmend<br />
problematischer werdenden Wachstumsdruck.<br />
71
Abb. 8: Wohnungs- und Wohnflächenentwicklung in der Bundesrepublik<br />
1950-1980<br />
72
Zusätzliche Verp;leichszahlen im nationalen Bereich<br />
Stand 195o<br />
1o qm<br />
Soz. Whg.bau<br />
2 5 qm<br />
1982<br />
Westberlin<br />
38 qm<br />
1982<br />
Abb. 9: Pro-Kopf-Wohnflächen im internationalen Vergleich<br />
(Stand: 1980-1982)<br />
73
• Er führt aus mathematischen Gründen und der Unhaltbarkeit des<br />
Zinseszinsversprechens zu immer größeren Wirtschaftskrisen und<br />
schließlich zum Zusammenbruch.<br />
Ausgehend von diesen Fakten zwingt sich die Lösung auf: Der destruktive<br />
Umlaufsicherer Zins muß durch einen konstruktiven ersetzt werden.<br />
Geld und Wirtschaft müssen dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.<br />
Das öffentliche Tauschhilfsmittel Geld kann und darf nicht gleichzeitig<br />
privates Besitz- und Spekulationsmittel sein, so wenig wie jedes<br />
andere öffentliche Gut. Anstelle der Zinsbelohnung bei der Rückgabe<br />
des Geldes in den Wirtschaftskreislauf muß eine Belastung für die<br />
Rückhaltung treten. So wie bei der Bahn ein »Standgeld« dafür sorgt,<br />
daß Waggons nicht länger als erforderlich zurückgehalten werden.<br />
Die Lösung ist also im Prinzip sehr einfach. Sie wird jedoch nicht nur<br />
von Minderheitsinteressen blockiert, sondern noch mehr vom Unwissen<br />
über die Zusammenhänge und von jahrtausendealten Gewohnheiten.<br />
Doch wie wir die Goldbindung und -deckung des Geldes überwunden<br />
haben (die einen Strom von Blut und Tränen in der menschlichen<br />
Geschichte verursacht hat) und beinahe auch die festen Wechselkurse<br />
(die immer eine Seite auf Kosten der anderen bevorzugt), so müssen wir<br />
auch den letzten grundlegenden Fehler im Fundament unseres Zusammenlebens<br />
überwinden. Ohne eine Änderung dieser Fehlkonstruktion<br />
sind alle anderen Bemühungen, die Sozial-, Umwelt- und Friedensfragen<br />
zu lösen, zum Scheitern verurteilt. Die Geschichte beweist das<br />
ebenso wie die Geschehnisse und Entwicklungen in unseren Tagen.<br />
74
Gustav Hämer<br />
Zum Beispiel Berlin-Kreuzberg*<br />
^»Später in diesem Jahrhundert, dort, wo die Städte noch bewohnbar<br />
waren, dort, wo es sie überhaupt noch gab, sah man immer mehr Pack<br />
auf den Straßen... manche hatten Bretter, Wellblech, Kunststoffbahnen<br />
hergeschleppt, andere schliefen in zerfetzten Zelten... Das Pack behinderte<br />
die Fußgänger, aber die Fußgänger waren zugleich das Pack...<br />
Niemand blickte zu den Häuserfronten empor; der Anblick war gespenstisch,<br />
deprimierend... Die meisten Wohnungen waren leer, die neu<br />
erbauten merkwürdigerweise schon am längsten. Die Polizei war nicht<br />
immer fähig, vor jenen Tobsüchtigen zu schützen, die sich... beim<br />
Monopol}'-Spiel aufgeputscht hatten, um nun... als sengender Mordhaufen<br />
durch die Straßen zu ziehen...<br />
Dies war der Grund, warum das Pack auf den Straßen hordete: Seit die<br />
Löhne stagnierten, die Mietpreise aber im bisherigen Maße weiterstiegen,<br />
also seit den achtziger Jahren, waren immer mehr und zuletzt alle Mieter<br />
gezwungen gewesen, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Vermieter machten,<br />
vom Gesetz gedeckt, weiterhin Investitionen, Renovationen, Quartiersüblichkeit,<br />
Verzinsung, Abschreibung, Teuerung, steigende Grundstückspreise<br />
und allgemeine Kosten geltend - die Wohnungen wurden,<br />
auch wenn man nicht mehr aß, trank, rauchte, Auto fuhr, sich kleidete<br />
und überhaupt auf alles verzichtete, außer auf das Wohnen selbst, ganz<br />
unbezahlbar. Noch später, vielleicht zu spät, hieß es, das Pack sei so<br />
gefährlich geworden, daß die Situation nicht mehr zu halten sei. Die<br />
Regierung, zu jener Zeit endlich 100 % FDP, erwog - und griff damit<br />
zum letzten Mittel, zur fürchterlichsten aller Maßnähmen - die Verteilung<br />
von Boden und Wohnungen unter das Pack. Enteignung - so endete das<br />
Jahrhundert mit einer makabren Pointe.«<br />
So Dieter Bachmann im Tagesanzeigermagazin Nr. 19 vom 14. Mai<br />
1983 mit dem PS: »Papier sei geduldig, denkt nun vielleicht der geneigte<br />
Leser. Gefehlt, lieber Geneigter! Denn Obiges ist nur, mit verbalen<br />
Mitteln, Fortschreibung dessen, was Hans Haldiman mit Zahlen belegt<br />
* Erschien zuerst in »Der Architekt« 11/83, S. 33-35<br />
75
hat unter dem Titel >Der Luxus des Wohnens, der nun freilich schon für<br />
die Gegenwart gilu.«*<br />
Das Problem ist international, in Berlin aber von besonderer Dimension.<br />
Es gibt keine Großstadt, in der so viele Mietskasernen so heruntergekommen<br />
sind wie in Berlin. Schon 1974 hieß es in einer Schrift des<br />
zuständigen Senators: »Sollte das erste und zweite <strong>Stadt</strong>erneuerungsprogramm<br />
mit zusammen etwa 110000 sanierungsbedürftigen Wohnungen im<br />
Jahre 2000 abgeschlossen sein, würden im Jahre 2000, statt der heute 200 000<br />
Wohnungen, die älter als 75 Jahre sind, 340000 sanierungsbedürftig sein.«<br />
(siehe oben) <strong>Stadt</strong>erneuerung ist also kein kurzfristiges Tagesproblem.<br />
In Berlin beschloß man, nach dem Motto »Die Innenstadt als Wohnort«<br />
in einem groß angelegten Experiment »kaputte <strong>Stadt</strong> zu retten«,<br />
jedenfalls hierzu einen Lösungs- und Diskussionsbeitrag zur Rettung der<br />
Städte zu entwickeln. Weil es den Politikern, der Verwaltung, den<br />
Wohnungsbaugesellschaften bisher auch mit Hilfe aller beteiligten Architekten<br />
nicht gelungen war, wurde eigens eine Gesellschaft gegründet,<br />
die Bauausstellung Berlin GmbH (IBA) mit zwei, von der Aufgabe und<br />
vom Thema sehr unterschiedlichen Geschäftsbereichen: <strong>Stadt</strong>neubau<br />
(Kleihues) und <strong>Stadt</strong>erneuerung - auch IBA-arm genannt, mit dem<br />
»Demonstrationsgebiet« Kreuzberg - SO 36, einem dichtbebauten und<br />
genutzten Gebiet mit ca. 30000 Wohnungen und 620000 qm Gewerbeflächen,<br />
der »Kreuzberger Mischung«, geschunden von wechselnden<br />
Planungen, weiträumigen »Freimachungen«, hochragenden Neubauten<br />
und flächendeckender Unterlassung von Instandhaltung. Der 1979 erreichte<br />
Zustand ließ den Zuständigen und den Betroffenen keine Hoffnung:<br />
am liebsten vergessen, gar nicht hinsehen, solche Probleme überträgt<br />
man anderen..., geht's gut, verbucht man es für sich, voraussichtlich<br />
geht es aber schief, dann haben die versagt, denen man diese<br />
hoffnungslose Aufgabe übertragen hatte.<br />
Um es vorwegzunehmen: Schritt für Schritt konnten die politischen<br />
Entscheidungsträger zunächst überzeugt werden von einem Modell, das<br />
wir »behutsame <strong>Stadt</strong>erneuerung« nennen. Das läuft jetzt seit etwa zwei<br />
Jahren. Kreuzberg - SO 36 ist zur Zeit »die größte Baustelle Berlins«.<br />
Eine Baustelle, die fast voll bewohnt ist und wo noch während dieses<br />
Prozesses immer mehr Bewohner zuziehen und seit der Verkündung der<br />
»72 Grundsätze zur behutsamen <strong>Stadt</strong>erneuerung« die Zahl der Betriebe<br />
zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder leicht ansteigt.<br />
Die 12 Grundsätze sorgen dafür, daß Maßnahmen der Erneuerung an<br />
den Bedürfnissen der im Kiez Lebenden orientiert werden und der<br />
Versorgung mit bezahlbaren Wohnungen dienen. Darüber hinaus ist sie<br />
ein Sparprogramm für die öffentliche Hand: Im Vergleich mit dem 1979<br />
* ebenda, S. 32<br />
76
ursprünglich vorgegebenen Konzept werden z. B. im Teilgebiet Kottbusser<br />
Tor allein 290 Millionen DM an Baukosten »gespart«, d.h. für die<br />
Laufzeit unserer Arbeit in diesem Gebiet geminderte Aufwendungen<br />
von jährlich ca. 36 Millionen DM.<br />
Zur »Rettung der kaputten <strong>Stadt</strong>« ist dies ein Beschleunigungsprogramm:<br />
Obwohl die Grundsatzentscheidung des Senators erst im April<br />
1982 fiel, werden die Erneuerungsmaßnahmen bis 1984 die ursprünglich<br />
bis dahin verlangte Zahl von Wohnungen überschreiten.<br />
Die »behutsame Erneuerung« schafft Arbeitsplätze im Gebiet: kleinteilige<br />
Instandsetzungsmaßnahmen sind arbeitsintensiv. Und die Altbauerneuerung<br />
bietet langfristig Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche<br />
(auf dieser Grundlage bildeten sich Einrichtungen gegen Arbeitslosigkeit<br />
wie »Jugendwohnen im Kiez«, »Kreuzwerk«, »Kiezbündnis<br />
gegen Jugendarbeitslosigkeit«, »Arbeitslosenladen«, »Zukunft im Beruf«).<br />
Für viele Handwerksbetriebe bietet die bauliche Erneuerung<br />
Betätigungsmöglichkeiten in der Nähe. Und die weitgehende Erhaltung<br />
der Gewerbegebäude ermöglicht niedrige Gewerbemieten, eine Voraussetzung<br />
für die Erhaltung der Gewerbebetriebe. Zu diesem Konzept<br />
gehört auch die behutsame Einfügung von Infrastrukturmaßnahmen.<br />
Bearbeitet werden 34 Projekte, darunter 1209 Kindertagesplätze und<br />
1500 Schulplätze, die zur Zeit mit Nachdruck bearbeitet werden (60%<br />
sind ausführungsreif abgestimmt).<br />
Die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen ist enorm, sie wird<br />
insbesondere getragen von der Notwendigkeit und dem Wunsch zu<br />
bleiben! Das Konzept blieb nicht Papier, die Verwirklichung ist voll im<br />
Gange. Aber:<br />
Dieser unerwartete Durchbruch ging vielen - sehr bestimmten Interessen<br />
- nun doch zu weit! Die dabei ins Feld geführten Gegenargumente<br />
sind leicht zu durchschauen:<br />
1. Die für die behutsame <strong>Stadt</strong>erneuerung investierten Mittel seien eine<br />
Verschwendung öffentlicher Gelder, weil die ganz deutlich geringeren<br />
Aufwendungen - gegenüber der durchgreifenden Modernisierung<br />
zuvor - die Häuser höchstens 10-15 Jahre erhalten könnten. -<br />
Dabei wird übersehen, daß im anderen Fall die Mittel nur für 10%<br />
der Wohnungen ausgereicht hätten und 90 % dem Verfall preisgegeben<br />
wären, ohne Instandsetzung. Und es wird verkannt, daß die<br />
wesentlichen Mißstände der unterlassenen Instandhaltung und fehlenden<br />
Ausstattung, insbesondere haustechnische Anlagen, im Zuge<br />
der behutsamen Maßnahmen grundsätzlich aufgearbeitet werden.<br />
Verkannt wird auch, daß die hier lebenden Menschen sich mit der<br />
Verbesserung ihrer Wohnungen und Häuser bei geringst möglicher<br />
Mietsteigerung mit ihrem Ort identifizieren und aktiv dafür sorgen -<br />
z.B. durch Selbsthilfe -, daß sie hier bleiben können.<br />
77
2. Die Beteiligung der betroffenen Bewohner mit Hilfe von trägerunabhängigen<br />
Mieterberatungseinrichtungen und die Abstimmung der<br />
Grundsätze oder Konfliktfälle in <strong>Stadt</strong>teilkommissionen mit den<br />
Betroffenen sei für die Eigentümer unzumutbar, weil ihre Verfügungsrechte<br />
damit eingeengt werden, für die Verwaltung eine unzulässige<br />
Einengung ihrer Kompetenz und für die, auf der Grundlage<br />
demokratischer Wahlen, bestehenden Entscheidungsgremien des Bezirkes<br />
oder des Landes Berlin konkurrierende Entscheidungsebenen<br />
ohne Mandat. Im übrigen verzögere die Mitwirkung der Betroffenen<br />
am Entscheidungsprozeß den Fortschritt der Erneuerung erheblich.<br />
Vergessen wird dabei, daß ohne Beteiligung der Betroffenen vorher<br />
20 Jahre lang die immer kürzer gesteckten Sanierungsziele niemals<br />
erreicht werden konnten, daß es vielmehr immer unmöglicher<br />
wurde, die aus der Ferne dem Gebiet zugedachten Sollvorstellungen<br />
durchzusetzen. Träger und Eigentümer vergessen, daß die Verwendung<br />
staatlicher Mittel für die Erneuerung gebunden ist an die<br />
Verwirklichung eines Heilungsprozesses (Sanieren heißt Heilen) im<br />
wohlverstandenen Interesse des Gemeinwohles, dem nicht gedient<br />
werden kann mit einer Verlagerung und Verschärfung der sozialen<br />
Probleme. Verwaltung und Entscheidungsgremien sind am Abstimmungsprozeß<br />
in den <strong>Stadt</strong>teilkommissionen beteiligt. Soweit sie sich<br />
in ihrer Kompetenz beengt fühlen oder die für den Abstimmungsprozeß<br />
vor Ort notwendige Zeit meinen nicht aufbringen zu können,<br />
muß in Erinnerung gerufen werden, wie lange und wie vergeblich<br />
Arbeitszeit der Verwaltung und Behandlung von Vorlagen in Ausschüssen<br />
und Gremien ergebnislos blieben, wenn nicht gar negative<br />
Nebenerscheinungen der früher praktizierten Entscheidungsverfahren<br />
zu den allseits beklagten und erschreckenden Verschlechterungen<br />
der Lebensverhältnisse und Vernichtung von Arbeitsplätzen beigetragen<br />
haben.<br />
Das Beispiel IBA-alt (arm) in Berlin-Kreuzberg zeigt, daß dem von<br />
Dieter Bachmann projizierten Ende der Städte als Wohnraum auch da<br />
ein Kraut gewachsen sein könnte, wo keine Hoffnung mehr zu sein<br />
schien. Aber man muß das Kraut suchen, und das fällt den Augen<br />
schwer, die, durch eigene Interessen geblendet, den eigenen Vorteil<br />
allein als Ziel ihres Handelns sehen und den Staat in die Pflicht nehmen,<br />
vor allem diese, ihre Interessen zu schützen.<br />
Wie sagte Bruno Taut: »Architektur ist die Kunst der Proportion...<br />
Was ist aber die Proportion?... Sie zeigt sich eben in den Beziehungen<br />
zwischen den Menschen..., dem Staat und bei den Staaten, wo die<br />
Verhältnisse, d. h. Proportionen nicht immer schön sind...«<br />
Wir Architekten, gewohnt, die Proportion im engeren Sinne als<br />
78
harmonische Ordnung und Gliederung der Architektur zu sehen und<br />
dies beim Entwerfen als unsere Aufgabe zu betrachten, müssen zunehmend<br />
erkennen, in welches Mißverhältnis, als Unproportion, die Rahmenbedingungen<br />
geraten, die für das Leben bestimmend sind, und<br />
damit auch für die Arbeit der Planer und Architekten. Die Arbeit in<br />
Kreuzberg macht diesen Zusammenhang ganz deutlich. Wir hoffen darüber<br />
hinaus, für die Leute im Kiez möglichst viel zu bessern. »Kaputte<br />
<strong>Stadt</strong> retten« ist heute ein sehr hohes und dringendes Ziel, auch für<br />
Architekten. Soll das gelingen, dann geht das nur mit den Bewohnern,<br />
und das haben wir in Kreuzberg wirklich erfahren.<br />
79
Energie-, Material- und<br />
Wasserhaushalt
Per Krusche<br />
Maßnahmen zur ökologischen<br />
<strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
Städtische Kultursysteme sind maßgeblich an der Verschwendung von<br />
Energie und Rohstoffen sowie an der Umweltzerstörung direkt und<br />
indirekt beteiligt. Jede einzelne Planungs-, Organisations- oder Baumaßnahme<br />
kann ein Beitrag zur weiteren Verschärfung oder zur Lösung<br />
der Umweltprobleme sein. Eine vereinzelte Maßnahme zeigt zwar kaum<br />
Wirkung, im Verbund mit anderen jedoch führt sie mit zunehmender<br />
Anwendung auch in Städten zu ausgeglichenen Materie- und Energiehaushalten,<br />
die in Harmonie mit den Natursystemen stehen, so daß<br />
Städte wieder Orte mit hoher Lebensqualität werden können.<br />
Für die Internationale Bauausstellung in Berlin (IBA) wurde 1982<br />
eine Zusammenstellung ökologischer Einzelmaßnahmen zur <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
und für Neubaumaßnahmen erarbeitet. Die folgende Kurzfassung<br />
des umfassenden Katalogs behandelt sowohl stadtökologische als<br />
auch bauökologische Maßnahmen auf Wohnungs- und Gebäudeebene,<br />
die ursächliche Verbesserungen, weniger Schutzmaßnahmen und Symptombekämpfung<br />
darstellen.<br />
Grundgedanken<br />
Menschliche Lebensbereiche können in Harmonie mit der Natur organisiert<br />
werden, wenn die Grundregeln und Mechanismen des Naturhaushaltes,<br />
wie sie in der <strong>Öko</strong>logie erforscht werden, auch auf künstliche<br />
Kultursysteme übertragen werden.<br />
Siedlungen und Städte können sich danach zu »<strong>Öko</strong>systemen besonderer<br />
Art« entwickeln, die ähnlich »natürlichen <strong>Öko</strong>systemen« in stetiger<br />
Entwicklung (Sukzession) immer vernetztere Ver- und Entsorgungsstrukturen<br />
aufweisen. Mit fortschreitender Entwicklung nimmt die Vielfalt<br />
der Lebenspartner und Lebensbeziehungen, die Effizienz der Energie-<br />
und Stoffnutzung, die Stabilität und Eigenständigkeit zu.<br />
Die »qualitativen Wachstumsschritte« verändern stetig die Umweltbedingungen,<br />
so daß sich allmählich ein »anthropogenes <strong>Öko</strong>system« entwickelt,<br />
welches optimal an die örtlichen klimatischen und geologischen<br />
83
Bedingungen angepaßt ist. Voraussetzung dazu sind menschliche Wohnund<br />
Lebensformen, die sich in die ökologischen Systeme integrieren,<br />
Lebensformen, die keinesfalls Verzicht auf Komfort und Lebensqualität<br />
bedeuten.<br />
Eine Anleitung zur Gestaltung von städtischen <strong>Öko</strong>systemen können<br />
die Prinzipien der natürlichen <strong>Öko</strong>systeme sein. Nach heutigen Kenntnissen<br />
sind dies im wesentlichen:<br />
• Anpassung an die Faktoren des Standortes;<br />
• Optimale Nutzung des örtlichen Naturpotentials an Energie und<br />
Materie;<br />
• Vernetzung der Stoff- und Energieflüsse, Einbindung in die globalen<br />
Kreisläufe;<br />
• Selbststeuerung in Regelkreisen;<br />
• Angemessene Populationsdichte;<br />
• Relative Eigenständigkeit und Vernetzung mit benachbarten Systemen;<br />
• Sukzession als offener Entwicklungsprozeß mit zunehmender Vielfalt<br />
und Stabilität;<br />
• Prinzip der Symbiose.<br />
Funktionsmischung und Vernetzung<br />
Das größte Hindernis einer ökologischen <strong>Stadt</strong>erneuerung ist die monofunktionale<br />
Zergliederung der Städte mit zentralisierter Ver- und Entsorgungsstruktur<br />
und dem dadurch hervorgerufenen Versorgungsverkehr<br />
und Verwaltungsaufwand mit seinen Folge Wirkungen.<br />
Anzustreben sind multifunktionale städtische Einheiten mit einer<br />
ausgewogenen Mischung von Wohnen und Arbeiten. Die Einrichtungen<br />
der Ver- und Entsorgung, der Dienstleistungen und Freizeit sind unmittelbar<br />
den Nutzern zuzuordnen. Je komplexer die Einheiten aufgebaut<br />
sind, desto weniger Verkehr und Transport ist notwendig und desto<br />
günstiger lassen sich die Energie- und Stoffhaushalte mit Verbund- und<br />
Kaskadensystemen koppeln. Das hat sowohl eine Minimierung der<br />
Energie- und Stoffmengen als auch geringeren Flächenbedarf zur Folge,<br />
so daß eine schadfreie Einbindung in die Natursysteme ermöglicht wird.<br />
Langfristig bedeutet das eine Umstrukturierung der Städte in multifunktionale,<br />
zum Teil selbstversorgende und selbstregelnde <strong>Stadt</strong>teileinheiten.<br />
Verdichtete <strong>Stadt</strong>teile müßten gegliedert und zum Teil aufgelockert<br />
und weniger dichte zu »kompakten städtischen Inseln« zusammengefaßt<br />
werden. Das so entstehende »grüne Netz« umschließt eine Vielzahl<br />
selbständiger <strong>Stadt</strong>teile, die kulturell spezielle Einheiten entsprechend<br />
84
Abb. 1: Schema der vernetzten Beziehungen eines <strong>Öko</strong>systems unter Einbeziehung<br />
des Menschen. Alles hängt mit allem zusammen und beeinflußt sich<br />
gegenseitig. Die Sonne bestimmt den Rhythmus und liefert die Energie. (Abb.<br />
aus »<strong>Öko</strong>logisches Bauen«, Wiesbaden/Berlin, 1982)<br />
ihrer historischen, sozialen, ethnischen und naturräumlichen Gegebenheiten<br />
sind.<br />
Der Verkehr zwischen diesen <strong>Stadt</strong>einheiten könnte sich weitgehend<br />
auf den sozialen und kulturellen Austausch beschränken und leicht<br />
durch emissionsfreie Verkehrsmittel bewältigt werden.<br />
Solche <strong>Stadt</strong>teile bauen sich analog zu natürlichen Systemen aus<br />
Teilsystemen auf, die in sich bereits eine hohe Autonomie erreichen.<br />
Die Wohnung als kleinster Baustein sollte bereits in der Wärmeversorgung<br />
teilautonom, in anderen Ver- und Entsorgungsbeieichen einen<br />
Baustein für das nächstgrößere System des Hauses darstellen.<br />
Ein Gebäude kann mit Garten und Gewächshaus zusammen mit<br />
seinen Bewohnern bereits die meisten elementaren Lebensfunktionen<br />
85
86<br />
NETZWERK DER ABHÄN^IßJ^ElTEN -VON NATUR UND KULTUR
DEN BALLUN6S6EBIETEN<br />
Abb. 2: Netzwerk der Abhängigkeiten von<br />
der Natur und Kultur in den Ballungsgebieten.<br />
Unsere städtischen Ballungsgebiete sind<br />
gekennzeichnet durch eine immer weiter zunehmende<br />
Funktionstrennung, die zu einer<br />
monofunktional zergliederten <strong>Stadt</strong> führt, in<br />
der alle Lebensbereiche getrennt an verschiedenen<br />
Orten zentralisiert sind.<br />
Dies bedeutet für den einzelnen Bewohner<br />
eine zeitliche und räumliche Zergliederung<br />
aller Lebensvorgänge, die außerdem zu einem<br />
Maximum an Verkehr und Bauwerken führt<br />
mit allen daraus entstehenden negativen Folgewirkungen.<br />
Die Ver- und Entsorgungsrichtlinien sind<br />
ebenfalls monofunktional zentralisiert und<br />
müssen mit Verteiler- und Sammlersystemen<br />
immer größer werdenden Maßstabs die Lebensgrundlagen<br />
sicherstellen. Solche Großsysteme<br />
wirken naturzerstörend, da sie nicht in<br />
das kleinteilige Netz natürlicher <strong>Öko</strong>systeme<br />
zu integrieren sind.<br />
Eine grundlegende Änderung der Leitlinien<br />
für eine <strong>Stadt</strong>- und Regionalentwicklung ist<br />
dringend geboten. Anzustreben sind multifunktionale<br />
Einheiten mit einer ausgewogenen<br />
Mischung von Wohnen und Arbeiten.<br />
Ver- und Entsorgungsrichtlinien, Dienstleistungen<br />
und Erholung sind unmittelbar den<br />
Nutzern zuzuordnen und einer Nutzverantwortung<br />
zugänglich zu machen.<br />
87
selbständig aufrechterhalten. Seine volle Eigenständigkeit erhält es in<br />
der Vernetzung und Einbindung in die nächstgrößeren Systeme.<br />
Die Siedlung, der Block bis hin zum <strong>Stadt</strong>teil als Summe von Einzelsystemen<br />
verschiedener Art ergibt dann eine neue Einheit auf höherer<br />
Ebene hinsichtlich ihrer ökologischen und sozialen Qualität.<br />
<strong>Öko</strong>logische <strong>Stadt</strong>erneuerung bedeutet die Bestandsaufnahme und<br />
Einbeziehung vorhandener Systeme und Aufbau neuer, weitgehend<br />
eigenständiger Kleinsysteme technischer, biologischer, organisatorischer<br />
und sozialer Art, wie beispielsweise Abfallrecyclingstationen,<br />
Werkstätten- und Betriebseinheiten, Nahrungserzeugungseinheiten,<br />
Energie- und Wassergewinnungseinheiten oder Bildungs- und Sozialeinheiten<br />
formeller wie informeller Art, Die Erarbeitung von Vernetzungsund<br />
Kombinationsschemata auf Blockebene, Einordnung der Teilsysteme<br />
auf <strong>Stadt</strong>teilebene und Vernetzungen mit den angrenzenden <strong>Stadt</strong>teilen<br />
und dem Umland setzten Planungsmethoden und -maßnahmen<br />
voraus, die in vernetzten Denkprozessen jeweils die Folge-, Neben- und<br />
Rückwirkungen erfassen und einbeziehen.<br />
Dieses Ziel kann durch eine neue interdisziplinäre <strong>Stadt</strong>planung<br />
angestrebt werden, in der ökologisch orientierte Fachleute der Ver- und<br />
Entsorgung, Betriebs- und Volkswirtschaft, <strong>Öko</strong>logie, Soziologie u. a.<br />
gemeinsam mit <strong>Stadt</strong>- und Bauplanern neue dezentrale Konzepte und<br />
ihre schrittweise Durchsetzung erarbeiten. Erste Schritte zur Realisierung<br />
bieten sich immer, wenn zentrale Ver- und Entsorgungssysteme<br />
ersetzt oder erweitert werden sollen; die Mittel können dann für die<br />
Installation von dezentralen Einrichtungen eingesetzt werden.<br />
<strong>Öko</strong>logische Entwicklungsschritte können nur »Initialzündungen«<br />
sein, die von den Bewohnern und Betrieben aufgenommen und weiterentwickelt<br />
werden müssen. Ausgehend vom heutigen Erkenntnisstand<br />
müssen die ersten Schritte eingeleitet werden, und erst nach Rückkoppelung<br />
der Erfahrungen dürfen weitere Schritte folgen.<br />
Eine solche Entwicklungsstrategie mit stetiger Rückkoppelung muß<br />
langsam genug sein, damit genügend Zeit für Bewußtseins- und Verhaltensänderungen<br />
der Bewohner bleibt und damit spätere wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse einfließen können.<br />
<strong>Öko</strong>logische Planung ist daher eine sukzessive Planung, die keinen<br />
Stillstand und keine fixierte Zukunft kennt, die in einen offenen Selbststeuerungsprozeß<br />
überleitet.<br />
Rückkoppelung und Selbststeuerung der Bewohner<br />
Durch Rückkoppelung in Regelkreisen halten sich natürliche <strong>Öko</strong>systeme<br />
im Gleichgewicht.<br />
Für menschliche Wohn- und Lebensformen können Rückkoppelungs-
mechanismen entwickelt werden, die anders als in natürlichen <strong>Öko</strong>systemen<br />
über das Bewußtsein die aktive Selbststeuerung nutzen. So ist<br />
Einsicht und Wiedererleben der Abhängigkeit vom Naturhaushalt der<br />
erste Schritt zur ökologischen Selbststeuerung.<br />
Die Ver- und Entsorgungseinrichtungen im Gebäude, Block- und<br />
<strong>Stadt</strong>teil müssen dann so gestaltet werden, daß jeder Bewohner selbständig<br />
sein Verhalten bestimmen kann, ohne übergeordnete Kontrollinstanzen<br />
zu benötigen. Voraussetzung dazu ist die Überschaubarkeit und das<br />
Verständnis der Systemzüsammenhänge und Einrichtungen sowie der<br />
eigenen Rolle im System, um direkte Verantwortung übernehmen zu<br />
können. So sollte eigenes Fehlverhalten unmittelbar den Verursacher<br />
treffen, ökologisches angemessenes Verhalten unmittelbaren Gewinn<br />
bringen (z.B. geringe Heizkosten bei richtiger Wärmehaushaltung).<br />
Mit zunehmender Entwicklung werden sich immer komplexere, vernetztere<br />
Strukturen und Systeme herausbilden, die nur scheinbar die<br />
Nutzer und Bewohner überfordern. Die Komplexität ökologischer Konzepte<br />
setzt einerseits Vorkenntnisse biologisch-natürlicher Vorgänge<br />
voraus, die meist heute nicht mehr vorhanden sind. Sie ist aber andererseits<br />
mit relativ einfachen, zum Teil vertrauten Maßnahmen durch<br />
Modelle für jeden sichtbar, erlebbar und er-faß-bar. Da das »Ganze<br />
einfacher als die Summe seiner Teile ist«, kann bei frühzeitiger Einbeziehung<br />
der Bewohner, bei Verantwortungsübernahme und Selbstorganisation<br />
sowie eigener kreativer Weiterentwicklung sehr wohl mit wachsendem<br />
Verständnis und Identifikation der Bewohner gerechnet werden.<br />
Der Gewinn an Lebensqualität besteht außer in der wiedergewonnenen<br />
Überschaubarkeit und Verantwortlichkeit der eigenen Lebensvorgänge<br />
und einer unmittelbaren sozialen Einbindung in einer Einsparung<br />
an Arbeits- und Zirkulationszeit, an Energie-, Ver- und Entsorgungskosten<br />
sowie in den Vorzügen einer unbelasteten Umwelt.<br />
Großzügige ökologische Modellbauten sind das beste Mittel, um die<br />
Funktionsfähigkeit und ihre Vorteile zu beweisen, damit ökologische<br />
Konzepte von Nutzern und Planern akzeptiert und übernommen<br />
werden.<br />
Das' Erleben von ökologisch integrierten Systemen verschiedener<br />
Größenordnungen ist die wichtigste Voraussetzung zur Durchsetzung<br />
ökologischer <strong>Stadt</strong>erneuerung.<br />
Die folgenden Einzelmaßnahmen sind geordnet nach:<br />
• Lufthaushalt und <strong>Stadt</strong>klima<br />
• Energiehaushalt<br />
• Wasserhaushalt<br />
• Materialhaushalt<br />
• Natureinbindung und Regeneration<br />
• Soziale Einbindung und Vernetzung<br />
89
Zwischen den einzelnen Themenbereichen bestehen vielfache Wechselbeziehungen,<br />
so daß einzelne Maßnahmen für mehrere Bereiche gelten.<br />
Die dadurch entstehenden Überschneidungen verdeutlichen die Komplexität.<br />
Lufthaushalt und <strong>Stadt</strong>kiima<br />
Das wichtigste Ziel ist, in Städten wieder sauerstoffreiche und schadstofffreie<br />
Luft als notwendiges »Lebensmittel« zu schaffen. Um dieses<br />
Ziel zu erreichen, sind die wichtigsten Prinzipien:<br />
• die Reduzierung bzw. Vermeidung von Emissionen durch Produktion,<br />
Verkehr und Hausbrand;<br />
• die Schaffung von Luftregenerationsbereichen im Außenraum durch<br />
Vegetation, Wasserflächen und aktives Bodenleben.<br />
Die Schaffung von großräumigen <strong>Stadt</strong>durchlüftungssystemen zum Abtransport<br />
der Schadstoffe sind ebenso wie der Immissionsschutz von<br />
bewohnten Außen- und Innenräumen aufwendige Lösungen, welche die<br />
Ursachen unverändert lassen. In Verbindung mit einer verbesserten<br />
Versorgung mit Erholungsflächen, Schaffung von störungsfreien Fußund<br />
Radwegen sowie einer Reaktivierung von Naturbereichen und<br />
deren netzartigen Verbindungen können Durchlüftungsschneisen sinnvoll<br />
sein.<br />
Wichtiger ist der Austausch der Luftmassen an windstillen Tagen<br />
durch thermische Zirkulation und zur eigenständigen Lufterneuerung<br />
durch Grünanlagen im unmittelbaren Wohnumfeld. Nur Maßnahmen<br />
mit gegenseitiger Ergänzung haben spürbare Auswirkungen.<br />
Ein weiteres Ziel ist die Schaffung von klimatischen Vorzugsbedingungen<br />
im Innenraum und Außenbereich des Hauses mit natürlichen<br />
Mitteln.<br />
Dieses Ziel wird erreicht durch die Prinzipien:<br />
• der passiven Solarnutzung (außen/innen);<br />
• der Materialeigenschaften, wie Wärme, Feuchte- und Dampfdruckausgleich,<br />
Feinfaser- und Staubminimierung, keine luftelektrische<br />
Beeinflussung usw.;<br />
• der einfachen, jahreszeitlich anpaßbaren Lüftung mit Zuluft-/Abluft-<br />
Wärmetausch im Winter;<br />
• des Klimaausgleichs und der Luftregeneration durch Pflanzen und<br />
Wasser.<br />
90
Energiehaushalt<br />
Langfristiges Ziel ist es, den Energieverbrauch auf das örtlich verfügbare<br />
natürliche und regenerierbare Energiepotential abzustimmen. Kurzfristiges<br />
Ziel ist es, die derzeitige Energienutzung zu optimieren und den<br />
Verbrauch der Leistungsverluste erheblich zu reduzieren.<br />
Die wichtigsten Prinzipien sind die Minimierung der Energieverluste,<br />
die Erhöhung des Wirkungsgrades technischer Einrichtungen sowie die<br />
Energienutzung in Koppelungs- und Kaskadensystemen. Darüber hinaus<br />
sollte die Energiegewinnung, -Umwandlung und -Verteilung dezentral,<br />
d.h. überschaubar und möglichst in direkter Rückkoppelung durch<br />
den Verbraucher erfolgen.<br />
Das Angebot regenerativer Energiequellen (Sonne, Wind, Biomasse)<br />
ist dabei in allen Formen auszuschöpfen und mit möglichst einfachen,<br />
wartungsarmen Systemen an die spezifische Nutzung anzupassen.<br />
Da der Heizenergiebedarf den größten Teil der bundesdeutschen<br />
Energiebilanz und über M des Gebäudeenergiebedarfs ausmacht, stellen<br />
die Maßnahmen zur Gebäudeheizung den wichtigsten Teil dar. In der<br />
Reihenfolge des Vorgehens sind die wichtigsten Prinzipien:<br />
• die Wärmebewahrung durch Dämmen, Dichten und Puffern;<br />
• die Wärmerückgewinnung aus Abluft, Abgas und Abwasser;<br />
• die Prinzipien der passiven Solarnutzung;<br />
• die aktive Solarnutzung (Warmwasserbereitung);<br />
• die Prinzipien der optimalen Wärmeverteilung (hoher Anteil an<br />
Strahlung und warme Wandoberflächen etc.).<br />
Wasserhaushalt<br />
Langfristige Ziele sind der Aufbau eines eigenständigen, vielfach vernetzten<br />
Wasserver- und -entsorgungssystems auf Haus-, Block- und<br />
<strong>Stadt</strong>teilebene, das sich in den natürlichen Wasserhaushalt einbindet.<br />
Hierzu sind die wichtigsten Prinzipien:<br />
• die Reduzierung der Wassermengen mit Trinkwasserqualität;<br />
• die Entwicklung von Brauchwassersystemen mit Doppel- oder Kaskadennutzungen;<br />
• die Entwicklung von geschlossenen Wassernutzungssystemen für gewerblichen<br />
und industriellen Gebrauch;<br />
• eine ausgewogene Nutzung der örtlich vorhandenen Wasserquellen<br />
(Niederschläge, Grundwasser, Oberflächenwasser) mit einer auf die<br />
Art der Nutzung gezielt abgestimmten Aufbereitung (geringe Entnahmemengen,<br />
kurze Verteilerwege);<br />
• Erfassung und Spezialbehandlung für Sonderabwässer;<br />
91
• direkt den Nutzern zugeordnete Kontrollmöglichkeiten gegen biologisch<br />
schädliche Abwassereinrichtungen mit negativer Rückkoppelung<br />
für den Nutzer;<br />
• Entwicklung von Abwassernutzungssystemen (biologische Weiternutzung),<br />
die speziell auf die Art der örtlichen Belastung abgestimmt<br />
sind;<br />
• Wiedereinbindung nach Nutzung und Reinigung in den Oberflächenund<br />
Grundwasserhaushalt; Abstimmung der Menge auf die Aufnahmekapazität.<br />
Ein zweites wichtiges Ziel ist die Sanierung des Grundwassers und der<br />
Oberflächengewässer. Hierzu sind die wichtigsten Prinzipien:<br />
• die Minimierung der versiegelten Oberflächen (in Städten bis zu<br />
90%) und die Reaktivierung des Bodenlebens sowie die Versickerungsmöglichkeit<br />
zum Grundwasser;<br />
• die Minimierung der Luftverschmutzung (siehe Lufthaushalt) und<br />
somit die Reduzierung der Niederschlagsbelastung;<br />
• die Vermeidung von Streusalzen, Überdüngungen, Pestiziden, Tropföl<br />
und anderen Verunreinigungen des Bodens;<br />
• die Vermeidung der Einleitung belasteten Abwassers, Einleitung erst<br />
nach Aufbereitung in biologisch reinem Zustand;<br />
• die Erhöhung der natürlichen Selbstreinigungskraft der Oberflächengewässer<br />
durch gezielte Biotopverbesserungen, besonders der Uferzonen;<br />
• Wiederfreilegung verrohrter oder zugeschütteter Gewässer;<br />
• Anlegen von neuen naturnahen Gewässern und Feuchtbiotopen,<br />
integriert in die Grünanlagen;<br />
• möglichst lange Rückhaltung der Niederschläge.<br />
Der Ausbau eines ökologisch ausgeglichenen Wasserhaushaltes kann<br />
schrittweise erfolgen im Zuge der sowieso notwendigen Erneuerungsmaßnahmen<br />
und Verbesserungen des Wohnumfeldes.<br />
Bei größeren Neubauprojekten besteht die Möglichkeit, von vornherein<br />
ein fein abgestimmtes Wassernutzungssystem zu installieren, das den<br />
oben genannten Prinzipien entspricht.<br />
Materialhaushalt<br />
Langfristiges Ziel ist es, eine vollständige Versorgung für Lebensmittelund<br />
Verbrauchsgüter im kleinräumigen Verbund mit Weiternutzung der<br />
Abfälle ohne Umweltschädigung zu erreichen.<br />
Das gleiche gilt im großräumigen Verbund für langlebige Gebrauchs-<br />
92
guter, die geeignet sind, dezentral handwerklich gewartet und repariert<br />
zu werden.<br />
Orientiert am Stoffhaushalt der Natur, wo die »Reststoffe« eines<br />
biologischen Prozesses immer »Rohstoffe« des nächsten Prozesses sind,<br />
kann für Haushalts- und Produktionsabfälle jeweils eine geeignete<br />
Weiternutzung gefunden werden (»Abfälle sind Rohstoffe am falschen<br />
Ort«).<br />
Müll als Konglomerat verschiedener Abfallstoffe erschwert eine Weiternutzung<br />
ganz erheblich und macht sie trotz aufwendiger Mülltrennanlagen<br />
zum Teil ganz unmöglich. <strong>Öko</strong>logisch sinnvoller ist es, Müll gar<br />
nicht erst entstehen zu lassen, d.h.:<br />
O die Abfallstoffe haushalts- und betriebsweise zu trennen, zu.sammeln<br />
und einer Weiternutzung zuzuführen (Stoffe aus Abgas, Abwasser<br />
und festen Abfällen);<br />
• Aufbau von vernetzten Betriebs- und Haushaltssystemen zur unmittelbaren<br />
Weiternutzung der Abfälle in Materialkaskaden (zugleich<br />
Koppelung der Energieflüsse möglich);<br />
• Aufbau von Reparatur- und Umnutzungsbetrieben für gebrauchte<br />
Geräte und Güter;<br />
• Materialsammellager auf <strong>Stadt</strong>teilebene für Baustoffe und Ausbauteile;<br />
• Mengenreduzierung der Abfallstoffe durch bewußtes Kauf- und<br />
Konsumverhalten (wie langlebige reparaturfreundliche Gebrauchsgüter,<br />
Verbrauchsgüter ohne Verpackungsanteile);<br />
• Aufbau von Verbundsystemen der Nahrungsversorgung und der<br />
organischen Abfälle wie: selbständige <strong>Stadt</strong>-Land-Betriebe, direkt<br />
gekoppelte Verarbeitungs- und Versorgungsbetriebe bis hin zur Nutzbarmachung<br />
von Haus und Umfeld für eine hochproduktive, städtische<br />
Nahrungsmittelproduktion.<br />
Eine besondere Bedeutung haben die Baustoffe. Hier sollten für Neubauten<br />
die physiologischen (biologischen) Eigenschaften neben der<br />
Nutzung von Recyclingstoffen Beachtung finden.<br />
Natureinbindung und Regeneration<br />
Städte sind biologisch verarmte Gebiete mit nahezu vollständig zerstörter<br />
Regenerationskraft bei gleichzeitig höchster Emissionsbelastung.<br />
Ein Ziel ökologischer <strong>Stadt</strong>erneuerung ist eine biologische Aufwertung<br />
des Standortes (<strong>Stadt</strong>) durch angepaßte Lebensgemeinschaften mit<br />
hoher Eigenständigkeit und Stabilität, die bei reduzierter Immission<br />
eine vollständige Regeneration garantieren.<br />
93
Städte bieten eine große morphologische und elementare Diversität,<br />
die richtig genutzt zu einer größeren Artenvielfalt führen könnte, als sie<br />
natürliche Landschaften aufweisen.<br />
Gebäude, technische Einrichtungen und Außenräume werden als<br />
Bestandteile eines »Biotops besonderer Art« gesehen, das durch gezielte<br />
Gestaltung die Lebensbedingungen aller Bewohner fördert und besonders<br />
den symbiotischen Nutzen für den Menschen optimiert. (Alle<br />
Bewohner sind: Menschen, Haustiere, Nutzpflanzen sowie Wildtiere,<br />
Wildpflanzen und Mikroorganismen.)<br />
Die wichtigsten Prinzipien zur städtischen Naturregeneration sind:<br />
• die Vermeidung von Emissionen und der daraus folgenden Luft-,<br />
Boden- und Gewässerverseuchung;<br />
• die Reduzierung der befahrenen Flächen;<br />
• die Beseitigung aller unnötig versiegelten Bodenflächen und Belebung<br />
aller freien, nicht intensiv genutzten Flächen für natürliche<br />
Vegetation, einschließlich Dach und Fassadenflächen;<br />
• die Erhaltung von vorhandenen selbstangepaßten Vegetationsflächen<br />
und Förderung von Vegetation, die sich an die speziellen Freiflächennutzungen<br />
selbsttätig anpaßt;<br />
• die Schaffung von natürlichen Vegetationsbereichen, die für Menschen<br />
unerreichbar bleiben (für wertvolle ungestörte Naturbiotope),<br />
z.B. Dächer, unzugängliche Bereiche in Grünanlagen usw. mit sporadischer<br />
Pflege, um einen bestimmten Sukzessionsgrad zu stabilisieren;<br />
• die netzartige Verbindung der Vegetationsflächen mit Anschluß an<br />
die großen Grünbereiche und das Umland;<br />
• die Integration von Wasser- und Feuchtbiotopen in die Grün- und<br />
Erholungsflächen mit zum Teil intensivem Schutz der wertvollen<br />
Uferbereiche;<br />
• die Integration von Nutz- und Ziergärten, von Spiel- und Freizeiteinrichtungen<br />
in die standortangepaßten Naturgrünflächen,<br />
Wichtigste Voraussetzung für solche Maßnahmen ist die Entwicklung<br />
des Bewußtseins der Bewohner, die gegebenenfalls die Verantwortung<br />
für die Pflege und den Schutz dieser Flächen übernehmen müssen.<br />
Soziale Einbindung und Vernetzung<br />
Ziel einer ökologischen <strong>Stadt</strong>erneuerung ist die Harmonisierung<br />
menschlichen Lebens mit der Natur. Alle Maßnahmen, die dies ermöglichen,<br />
können zugleich zu einer Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen<br />
führen, wie:<br />
94
• Schaffung von Lebensbedingungen, die der menschlichen Natur angemessen<br />
sind;<br />
• Förderung und Ausschöpfung der vollen sinnlichen Erlebnisfähigkeit;<br />
• Schaffung von physischen und psychischen Vorzugsbedingungen,<br />
gleichberechtigt für alle Lebensphasen (vom Kleinkind bis zu alten<br />
Menschen);<br />
• Förderung der Selbständigkeit und des Zusammenlebens der Generationen,<br />
der Frauen und Männer;<br />
• Schaffung der Voraussetzungen, den Lebenszyklus wieder als Einheit<br />
erkennbar und erlebbar zu machen.<br />
Da die Bewohner eine aktive Rolle im »städtischen <strong>Öko</strong>system« übernehmen<br />
müssen, sind organisatorische Modelle zu entwickeln, die frühzeitig<br />
die Bewohner und Gewerbetreibende mit den ökologischen Systemen<br />
vertraut machen, die Eigeninitiative fördern und die Verantwortlichkeit<br />
für den unmittelbaren Lebensbereich wieder entstehen lassen.<br />
Folgende Funktionen müssen übernommen bzw. neu entwickelt werden:<br />
• »Zusatzfunktionen« zur Mehrfachnutzung der Gebäude- und Freiflächen<br />
sowie der technischen Anlagen (ggf. Differenzierung monofunktionaler<br />
Einrichtungen);<br />
• »Ergänzungsfunktionen« zur Bildung von Kaskaden und Vernetzungen<br />
des Material- und des Energie- und Wasserhaushaltes;<br />
• »Grundversorgungsfunktionen« zur eigenständigen, gebietsinternen<br />
Versorgung mit den täglichen Bedarfsgütern, insb. Nahrungsmitteln;<br />
• »Regelungsfunktionen« und Überwachung der ökologischen Systeme<br />
und ihre natürliche Einbindung;<br />
• »Selbstverwaltungsfunktionen«, Entwicklung entsprechender Gremien<br />
zur Regelung der internen Beziehungen sowie zu benachbarten<br />
und übergeordneten Systemen.<br />
Kernpunkt der sozialen Vernetzung ist die Integration von Wohnen und<br />
Arbeiten, von Freizeit und Erholung in überschaubaren Einheiten. Im<br />
Zusammenhang mit den ökologisch sinnvollen Koppelungen ergeben<br />
sich daraus eine Reihe von neuen Arbeitsplätzen und Gewerbeansiedlungen,<br />
die sich gegenseitig fördern können:<br />
• ökologisch integrierende, blockeigene Ver- und Entsorgungssysteme<br />
(Planung, Aufbau, Wartung, Verbesserung etc.);<br />
• Nahrungsmittelanbau, <strong>Stadt</strong>-Land-Verbund, Lagerung, Verarbeitung,<br />
Verteilung etc.;<br />
• Ergänzungsbetriebe, die für die Betriebskoppelungen zu Energieund<br />
Materialkaskaden notwendig werden;<br />
• Werkstätten, Läden, Reparatur- und Veredelungsbetriebe etc.;<br />
95
• Reintegration der sozialen Einrichtungen wie der Gesundheitsversorgung,<br />
Kinderpflege, Sozialpflege und^des Bildungswesens unmittelbar<br />
in die einzelnen Wohngebiete und Nachbarschaftseinheiten;<br />
• weitere Einrichtungen im sozialen und kulturellen Bereich zur Erhöhung<br />
der Eigenständigkeit des Gebiets.<br />
Langfristig gilt es, eine ökologisch angemessene Bewohnerdichte und<br />
Grüppenstruktur zu entwickeln, welche zugleich den sozialen Anforderungen<br />
gerecht wird. Die Dichte muß sich aus den Abhängigkeiten der<br />
»sozialen Distanz« zur Sicherung des individuellen Freiraums, der<br />
»kommunikativen Nähe« zum kulturellen und sozialen Lernen, der<br />
notwendigen Dichte, um optimale Funktionsmischungen für Energieund<br />
Materialkaskaden zu erhalten, und aus der Belastbarkeit der natürlichen<br />
Umweltsysteme definieren.<br />
Die meisten innerstädtischen Wohngebiete sind eindeutig zu dicht<br />
besiedelt. Neuplanungen sollten daher auch der Entlastung der zu<br />
dichten Wohngebiete dienen (z.B. Südliche Friedrichstadt zur Entlastung<br />
von Kreuzberg SO 36).<br />
Die frei werdenden Räume könnten dann für »ökologische Wohnfolgeeinrichtungen<br />
und Betriebe« genutzt werden, die zur weiteren Entlastung<br />
der Wohngebiete führen. Entsprechende Umstrukturierungsmodelle<br />
müßten der jeweiligen Situation angepaßt werden.<br />
Wege zur Durchsetzung<br />
Neben der grundsätzlichen Frage, ob es überhaupt eine rechtzeitige<br />
Umkehr vor Katastrophen gibt, müssen wir uns fragen, welches eine<br />
richtige und mögliche Strategie zur Durchsetzung für eine bessere<br />
Zukunft ist. Was kann der einzelne tun? Was kann z.B. die IBA tun?<br />
Was kann eine <strong>Stadt</strong> wie Berlin leisten, um wichtige Weichen (noch)<br />
richtig zu stellen?<br />
Zunächst ist zu untersuchen, welche Faktoren in einer <strong>Stadt</strong> auf den<br />
Menschen einwirken, wie das System <strong>Stadt</strong> vernetzt ist. Man wird<br />
schnell feststellen, daß eine grundsätzliche organisatorische Umstrukturierung<br />
notwendig ist. Eine Umstrukturierung<br />
• hin zu dezentralen Versorgungssystemen,<br />
• zum Zusammenfügen bisher (künstlich) getrennter Funktionen.<br />
Solche wesentlichen und grundsätzlichen Prozesse sind nicht durch<br />
architektonische oder planerische Modelle auslösbar, sondern nur durch<br />
politische Entscheidungen.<br />
Wie aber werden politische Entscheidungen beeinflußt und gesteuert?<br />
96
Ein erstaunlich wirkungsvoller Weg ist nicht, gegen jemanden (Politiker<br />
oder Behörden) zu kämpfen, weil hierfür viel zu viel Energie notwendig<br />
wäre, sondern statt dessen mit den vorhandenen Kräften (Wirtschaftsstruktur,<br />
Finanzströme etc.) zu arbeiten, sie für die ökologische Sache<br />
zu gewinnen und selbst wirken zu lassen. Überall sind mittlerweile<br />
Verbündete zu finden, deren Einfluß durch qualifizierte Mitarbeit gestärkt<br />
werden kann. Darüber hinaus bieten umweltorientierte Technologien,<br />
Produktionen, Planungs-, Sozial- und Dienstleistungen schon<br />
heute eine Möglichkeit, eine selbständige Existenz aufzubauen, die<br />
gleichzeitig ein zukunftsorientiertes Modell darstellen kann.<br />
Es müssen politische Ziele, Programme und Handlungsweisen entwikkelt<br />
werden. Architekten und Planer können zu politischen Strategien<br />
ihren Beitrag leisten, indem sie mögliche und sinnvolle Ziele durch die<br />
Gestaltung einer »schönen, heilen Welt« verdeutlichen. Solche Beiträge<br />
sind in vielfältigen Varianten so häufig wie möglich als Zukunftsmodelle<br />
zu realisieren.<br />
Zukunftsmodellen liegt bisher die Fragestellung zugrunde: »Was muß<br />
sich ändern, damit es so bleibt wie bisher?« D.h. unsere Lebensart und<br />
unser Lebensstandard sollen unangetastet bleiben. Eine solche Problemlösung<br />
erfordert einen enormen Planungszeit- und Kostenaufwand, die<br />
dann ökonomisch nicht mit traditionellen Lösungen konkurrieren können.<br />
Werden jedoch Lebensart und Lebensstandard sowie bestehendes<br />
Recht (z.B. Baurecht, DIN, Ver- und Entsorgungsbestimmungen etc.)<br />
mit zur Disposition gestellt, so könnte ein breites Spektrum von Modellen<br />
entstehen, die ökologisch besser, ökonomisch günstiger sind als<br />
herkömmliche Lösungen und zusätzlich eine andere und höhere Lebensqualität<br />
bieten.<br />
Eine ökologische <strong>Stadt</strong>entwicklung benötigt, außer politischen und<br />
planerischen Entscheidungen, einen Umdenkungsprozeß bei der Bevölkerung.<br />
<strong>Öko</strong>logische <strong>Stadt</strong>erneuerung ist daher letztlich ein sozialer<br />
Prozeß, der sich über Generationen erstreckt. Da mit den Kräften der<br />
Natur gearbeitet wird, kann er nicht schneller sein, als Bäume wachsen.<br />
97
Florentin Krause<br />
Die bundesdeutsche Bausubstanz -<br />
ein Energiefaß ohne Boden<br />
Nach dem herkömmlichen Verständnis haben Ehergiepolitik und <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
wenig miteinander zu tun.<br />
Dies beruht einerseits darauf, daß die <strong>Stadt</strong> als Energieverbraucher<br />
scheinbar mehr oder weniger unveränderlich vorgegeben ist und die<br />
konventionelle Energiepolitik sich darin erschöpft, die <strong>Stadt</strong> von außen<br />
mit Brennstoffen und Strom zu versorgen.<br />
Andererseits war in der Vergangenheit die Belastung städtischer<br />
Einwohner mit Heizungskosten im Vergleich zur Mietpreisbelastung<br />
gering, und die sozialpolitisch motivierte Städtebaupolitik hatte wenig<br />
Anlaß, sich mit der Energieproblematik auseinanderzusetzen.<br />
Diese Situation hat sich grundlegend geändert. Die Heizkostenbelastung<br />
der Mieter in Altbauten übersteigt heute häufig die Mietkosten,<br />
und es ist absehbar, daß diese Tendenz sich in den nächsten Jahren<br />
fortsetzen wird. Die Städte wieder wohnlicher zu machen heißt deshalb<br />
heute nicht nur, die Natur in sie zurückzuholen und sie wieder zu<br />
begrünen und Lärm und Emissionen zu beseitigen, sondern die Mieter<br />
davor zu schützen, daß ihre Heizkostenrechnung ihnen das Hemd vom<br />
Leib reißt.<br />
<strong>Stadt</strong>erneuerung ist heute Kernstück der Energiepolitik, und das<br />
erfordert eine grundlegende Neuorientierung all derer, die sich in der<br />
kommunalen Politik und Verwaltung engagieren.<br />
Ich habe bereits in dem Buch »Energiewende« 1 begründet, warum die<br />
herrschende Energiestrategie, Öl durch die großtechnische Kohleumwandlung<br />
und Kernenergienutzung zu ersetzen, zum Schiffbruch führen<br />
muß. Jeder Monat in der weltpolitischen Entwicklung macht deutlich,<br />
daß die Bundesrepublik nur dann Versorgungssicherheit haben wird,<br />
wenn es ihr gelingt, rasch ihren Ölverbrauch und Energieeinsatz zu<br />
senken. Die bisherige Strategie des großtechnischen Zubaus von Anlagen<br />
draußen auf der Wiese ist nicht rasch und auch nicht kostengünstig.<br />
Statt unseren Erdball auf der Suche nach neuen Ölfeldern zu einem<br />
Schweizerkäse zu machen, gilt es heute, eine große, heimische Energiequelle<br />
anzubohren: den Raumheizungsbedarf unserer Gebäude drastisch<br />
zu senken.<br />
98
Die Bedeutung von Effizienzverbesserungen bei Gebäuden und Heizungen<br />
wird in der Energiepolitik immer noch verkannt. Der Anteil der<br />
Raumheizung am Endenergiebedarf der Bundesrepublik beträgt ca.<br />
40%. Für diese Heizenergie geben wir bei derzeitigen Energiepreisen<br />
jährlich 50 Milliarden DM aus, oder knapp tausend DM pro Kopf.<br />
Dabei befindet sich der Gebäudebestand der Bundesrepublik in einem<br />
hoffnungslos rückständigen Zustand, wenn man ihn mit den heutigen<br />
Möglichkeiten der baulichen Wärmeschutztechnik und der Heiztechnik<br />
vergleicht.<br />
Mit heute verfügbaren und längst erprobten einfachsten Techniken<br />
läßt sich der Raumwärmebedarf von Gebäuden gegenüber dem typischen<br />
mangelnden Wärmeschutz des westdeutschen Bestandes auf ein<br />
Zwanzigstel vermindern; bei Maßnahmen im Außenwand- und -deckenbereich<br />
auf ein Zehntel, bei Fensterisolierung auf ein Viertel, Belüftung<br />
auf ein Sechstel.<br />
Gebäude dieser Konstruktion sind in mehreren Ländern über Jahre<br />
hinweg getestet worden, in der Bundesrepublik z.B. das Phillips-Haus<br />
in Aachen. Bedenken, daß eine solche Superisolierung zu einem unerträglichen<br />
Innenklima (zu heiß im Sommer, Ersticken im Winter) führen<br />
würde, sind durch diese Tests ausgeräumt worden. Im Gegenteil, sie<br />
waren der üblichen Bauweise überlegen.<br />
Alle Maßnahmen, die in solchen superisolierten Gebäuden angewandt<br />
werden, sind prinzipiell auch auf Altbauten anwendbar. So lassen<br />
sich Fenster mit Mehrfachverglasung und Isolierböden einbauen, Dächer,<br />
Keilerdecken und Außenwände mit Isolierschichten und Wärmeaustauscher<br />
zur kontrollierten Belüftung vorsehen.<br />
Ziel der Wärmesanierung von Altbauten sollte es sein, den Raumwärmebedarf<br />
im Mittel um mindestens 75% zu senken, was etwa einer<br />
Umrüstung auf schwedische Standards entspricht.<br />
Bei Neubauten muß das Ziel sein, den Raumwärmebedarf auf mindestens<br />
ein Zehntel des durchschnittlichen Bedarfs zu senken.<br />
Wärmeschutzmaßnahmen dieser Art lassen sich gut mit anderen<br />
Sanierungsmaßnahmen verbinden, deren Ziele in erster Linie sozialpolitisch<br />
bestimmt sind.<br />
Schon heute werden - wenn auch in völlig unzureichendem Ausmaß -<br />
Fenster- und Außenwandisolierungen bei der Fassadenrenovierung mit<br />
angebracht.<br />
Die modernen mehrfachverglasten Fenster mit guter Fugendichte<br />
tragen ganz erheblich zum Schallschutz bei.<br />
Klappfensterläden, die zu Zwecken der Isolierung mit Styropor beschichtet<br />
angebracht werden, etwa bei Nachkriegsbauten, können eine<br />
ausgesprochen wohltuende auflockernde optische Wirkung auf die Fassaden<br />
haben.<br />
99
Umfangreiche Fassadenbegrünungen sind nicht nur attraktiv und<br />
staubbindend, sondern auch isolierend, indem sie ein stagnierendes<br />
Luftkissen unter ihren Blättern halten. Dieser Nebeneffekt kann dazu<br />
verwendet werden, die effektive Dämmschicht ohne zusätzliches<br />
Dämmaterial an der Außenwand zu vergrößern.<br />
Ebenso kann ein Dach mit Erdreich isolieren, etwa mit dem Erdreich,<br />
das in einem Dachgewächshaus zum Pflanzenanbau benötigt wird.<br />
Schließlich läßt sich eine effektive Wärmedämmung am Fenster auch<br />
durch Vorsatz eines Wintergartens oder Balkongewächshauses erreichen,<br />
was zusätzlich noch zu einer besseren Nutzung der Sonnenstrahlung<br />
führt (passiv-solare Maßnahme).<br />
Erst nachdem die Wärmesanierung weitestmöglich vorangetrieben ist,<br />
kann man über neue Heizsysteme nachdenken. Die gegenwärtige Praxis,<br />
den Wärmeschutz geringzuschätzen und einfach von einem Energieträger<br />
auf den nächsten umzurüsten, ist kurzsichtig. Überdies gibt es nur<br />
zwei Umrüstungsmaßnahmen in der Heiztechnik, die Unterstützung<br />
verdienen: die Umrüstung auf Sonnenwärme und die Umrüstung auf<br />
gekoppelte Produktion von Strom und Wärme.<br />
Es herrscht die weitverbreitete Illusion, daß unsere Heizungen einen<br />
Wirkungsgrad von 50 bis 80 % hätten. Tatsächlich ist dieser Wirkungsgrad<br />
zur Beurteilung der Heiztechnik völlig untauglich. Das einzig<br />
verläßliche Maß für die Umwandlung von Brennstoffen in Nutzenergie<br />
ist der sogenannte exergetische 2 Wirkungsgrad, in dem berücksichtigt<br />
ist, daß man einen großen Teil der Qualität des Brennstoffs Heizöl, Gas,<br />
etc. wegwirft, wenn man nur Wärme niederer Temperatur erzeugt,<br />
nämlich letztendlich eine Raumtemperatur von 20° C.<br />
Dieser exergetische Wirkungsgrad beträgt nur ca. 5% für eine herkömmliche<br />
Heizung, etwa 10% für eine Wärmepumpe, aber ca. 30%<br />
für die Heizung in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Aus dem Gebot der<br />
Stunde, fossile Brennstoffe so sparsam wie möglich zu verwenden,<br />
ergibt sich ein absolutes Primat für den Ausbau der KWK überall da, wo<br />
sich fossile Brennstoffe noch nicht durch Sonnenenergie ersetzen lassen.<br />
Gegenwärtig liegt der Anteil der KWK an der Raumheizung in der<br />
Bundesrepublik weit unter 5%.<br />
Berücksichtigt man die besseren Wirkungsgrade der KWK sowohl im<br />
Bereich der Brennstoffumwandlung in Endenergie als auch im Bereich<br />
der Nutzung der Endenergie im Haus, so ergibt sich eine Verminderung<br />
des fossilen Primär-Brennstoffverbrauchs auf ein Fünftel bis ein Zehntel,<br />
je nach vorhandener Heizung.<br />
Niemand kann es sich heute leisten, an einem solchen Einsparpotential<br />
vorbeizugehen. Dies gilt auch aus der Sicht der <strong>Stadt</strong>ökologie, wenn man<br />
bedenkt, welche drastischen Emissionsminderungen durch eine solche<br />
Umrüstung erreicht würden .Bisher boykottierten die Stromunternehmen<br />
100
den Ausbau der KWK, indem sie potentiellen kleinen Stromerzeugern in<br />
Industrie und im Wohnbereich lächerlich geringe Strompreise anboten.<br />
Diese reaktionäre Haltung von Monopolisten hat in einer zukunftsweisenden<br />
Energie- und <strong>Stadt</strong>politik keinen Platz.<br />
Es bleibt die Frage, mit welchen Techniken die KWK ausgebaut<br />
werden soll. Zur Wahl stehen Fernwärmeschienen von großen Kraftwerken<br />
aus 300 MW, kleinere örtliche Netze von 10-MW-Anlagen mit der<br />
Wirbelschichttechnik sowie noch kleinere Anlagen, wie Dieselmotoraggregate,<br />
für jeweils ein gut isoliertes Mehrfamilienhaus.<br />
Ich möchte hier für den Ausbau der kleinen Systeme plädieren, denn<br />
diese lassen sich wesentlich besser an den Wärmebedarf lokal anpassen,<br />
nachdem dieser stark durch Wärmedämmung reduziert wurde. Die<br />
Tendenz großer Fernwärmepläne wird hingegen sein, zum Schutze der<br />
Investitionen in die teuren Verteilungsnetze konkurrierende Investitionen<br />
in die Wärmesanierung zu behindern.<br />
Es herrscht immer noch der Mythos vor, die Wärmesanierung von<br />
Altbauten, wie ich sie vorschlage, sei unwirtschaftlich. Dieser Aberglaube<br />
rührt her von einer Zeit, als man glaubte, der Heizölpreis werde die<br />
Höhe von 60 Pf pro 1 erst um die Jahrhundertwende erreichen. Er hat<br />
diesen Wert aber schon letztes Jahr erreicht, und eine weitere Verdoppelung<br />
ist noch in diesem Jahrzehnt absehbar. Diese Preissteigerungen<br />
werden auch nicht auf Öl beschränkt bleiben, sondern Kohle und Gas<br />
befinden sich schon heute im gleichen Preissog.<br />
Praktische Erfahrungen haben gezeigt, daß die nachträgliche Isolierung<br />
typischerweise doppelt so teuer ist wie die beim Neubau, wenn man<br />
es gleich richtig macht. Man darf aber nicht vergessen, daß gerade die<br />
<strong>Stadt</strong>erneuerungsinvestitionen sich mit diesen Maßnahmen koppeln.<br />
Die höheren Kosten pro Quadratmeter Wärmesanierung werden durch<br />
die nebenbei bewirkte Fassadenerneuerung bzw. Schallschutz aufgehoben.<br />
In konkreten Zahlen ausgedrückt: eine nachträgliche Wärmedämmung,<br />
wie beschrieben, kostet 10000 bis 20000 DM pro Wohnung; sie<br />
rentiert sich, wenn man konstante Energiepreise unterstellt, in 10 bis 20<br />
Jahren (Einsparung pro Jahr ca. 1000 DM). In KWh-Preisen ausgedrückt:<br />
eine KWh Wärme aus Heizöl kostet heute 10 bis 14 Pfennig.<br />
Eine weggedämmte KWh kostet beim Übergang auf schwedische Standards<br />
etwa 5 bis 10 Pfennig.<br />
Wenn man diese Maßnahmen zum Wärmeschutz vernachlässigt, dann<br />
soll man nicht von arbeitnehmerfreundlicher Wohnungs- oder Energiepolitik<br />
reden.<br />
Wenn unser Ziel ist, in den nächsten drei bis fünf Jahrzehnten den<br />
Gebäudebestand zukunftssicher zu machen, so müssen wir jährlich etwa<br />
2 bis 4% unseres Gebäudebestandes umrüsten.<br />
101
Dies entspricht in Berlin einem Jahresvolumen von etwa 10000 bis<br />
20000 Wohnungen und einem jährlichen Kostenaufwand in der Größenordnung<br />
von 100 Mio. bis 200 Mio. DM.<br />
Die Herausforderung an die kommunale Politik ist, die Investitionstätigkeit<br />
in Gang zu bringen. Wenn man sich jedoch um die Wärmesanierung<br />
und Umrüstung des Heizungsbereichs drückt, kommen nur<br />
wesentlich teurere Lösungen in Frage, die sich nicht mit den Aufgaben<br />
des Städtebaus koppeln lassen. Solche Strategien mögen dem Konsortium<br />
von Banken und Unternehmen der Energiewirtschaft, die heute<br />
die Energiepolitik bestimmen, gelegener sein. Sie sind jedoch weder<br />
sozial noch verantwortlich.<br />
Anmerkungen<br />
1 H. Boßel, F. Krause, K. F. Müller, Reißmann: Energiewende - Wachstum und<br />
Wohlstand ohne Erdöl und Uran, Frankfurt/M. 1980<br />
2 Exergie -= der Anteil der Energie, der in die gewünschte, wirtschaftlich<br />
verwertbare Form umgewandelt wird.<br />
102
Willi Mauer<br />
Energiekonzept im Rahmen der<br />
behutsamen <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
Ein Teil der Probleme in den IBA-Altbaugebieten in Berlin-Kreuzberg<br />
hängt eng mit der bestehenden Art der Wärmeversorgung zusammen.<br />
Dies sind vor allem:<br />
• Mietkostenprobleme (auf das Zwei- bis Dreifache ansteigende<br />
Warmmieten nach der Modernisierung sind für den größten Teil der<br />
Bewohner nicht tragbar);<br />
• Umweltprobleme (höchste Luftbelastung in Berlin bzw. Deutschland)<br />
;<br />
• Probleme des Wohnstandards (überwiegend keine Bäder vorhanden,<br />
Beheizung mit Kohle-Einzelöfen).<br />
Im Rahmen der von der IBA verfolgten behutsamen <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
mußte daher ein besonderes Augenmerk auf örtlich angepaßte Maßnahmen<br />
zur Weiterentwicklung der Wärmeversorgung gerichtet werden.<br />
Aufgrund des schlechten Zustandes der überwiegenden Zahl der<br />
Gebäude (großer Instandsetzungsnachholbedarf, mangelhafte Ausstattung)<br />
und der nur begrenzt vorhandenen Fördermittel der öffentlichen<br />
Hand ergab sich die Forderung, den Einsatz der vorhandenen Mittel auf<br />
eine größere Gebäudezahl auszudehnen. Wesentliche Merkmale des behutsamen<br />
Erneuerungsansatzes sind dabei der Einsatz kostensparender<br />
Technologien sowie die Anwendung ressourceschonender Methoden im<br />
Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz. Dabei kommt dem Erkennen<br />
und Bewahren vorhandener Qualitäten besondere Bedeutung zu.<br />
Bezüglich der Wärmeversorgung sind dies:<br />
• Die energetisch günstigen Berliner Altbauten. Aufgrund der massiven<br />
und kompakten Bauweise zeichnen sich diese Gebäude gegenüber<br />
anderen Haustypen durch die geringsten spezifischen Wärme-<br />
~ bedarfswerte aus. (Abb. 1-3)<br />
• Die Beheizung mit Kachelöfen. Durch die Beheizung mit Kachelöfen<br />
wird zum einen ein behagliches Strahlungsklima sowie ein physiologisch<br />
günstiges Heizklima erzeugt, zum anderen bewirkt die Einzelofenheizung<br />
durch die geringere Benutzungsstundenzahl und den<br />
103
(1) 'Wärmeleistungsbedarf nach DIN 4701<br />
(2) Eigene Berechnungen nach Daten aus: Ueli Roth,Wechselwirkungen zwischen<br />
der Siedlungsstruktur und WärmeVersorgungssystemen (Zwischenbericht),<br />
Forschungsprojekt BMBau RS II 4 - 704102 - 77.10, 1980.<br />
(3) vgl. Forschungsauftrag:"Fernwärmeverbund Kreuzberg-Neukölln,Verfasser<br />
Energie-Anlagen Berlin GmbH,Auftraqgeber SenWl , Berlin 1975,S. 149 ff.<br />
Abb. 1: Beispielhafter Vergleich des spezifischen Primärenergieverbrauchs ausgewählter<br />
Gebäudetypen<br />
104
Abb. 2: Der Energieverbrauch pro m 2 Nutzfläche kann in freistehenden Einund<br />
Zweifamilienhäusern im Vergleich zu ofenbeheizten Berliner Altbauten um<br />
das Sechsfache höher liegen.<br />
Abb. 3: Bei Geschoßwohnungsneubauten der 50er und 60er Jahre liegt der<br />
Heizenergieverbrauch häufig viermal so hoch wie in ofenbeheizten Berliner<br />
Altbauten.<br />
105
geringeren spezifischen Wärmebedarf der Gebäude sehr niedrige<br />
Heizkosten (in über 80 % des Wohnungsbestandes der Bundesrepublik<br />
liegt der Energieverbrauch dreimal höher).<br />
• Etwa 2 A des Heizenergieverbrauchs der Bundesrepublik entfallen auf<br />
1- bis 2geschossige Gebäude. Ihr Anteil an der gesamten beheizten<br />
Nutzfläche beträgt ca 40%.<br />
• Nahezu sämtliche Altbauten sind an das Gasnetz angeschlossen.<br />
Neuere Untersuchungen der IBA belegen, daß eine weitgehende<br />
Nutzung der vorhandenen Gasnetze auch bei erheblicher Kapazitätsausweitung<br />
möglich wäre.<br />
Auch die in den Gebäuden vorhandenen Verteilungsleitungen<br />
bedürfen keiner oder nur geringer Verstärkung, insbesondere, wenn<br />
man die Einführung des Erdgases voraussetzt.<br />
Durch die wohnungspolitische Zielsetzung der IBA ergab sich eine<br />
praktische Eingrenzung des Lösungspotentials für die Konzeptentwicklung.<br />
Die folgenden Ergebnisse stammen aus der Bestandsanalyse der<br />
IBA-Arbeitsgruppe <strong>Stadt</strong>erneuerung »Energie- und Umweltprobleme im<br />
Berliner Altbaubestand«.<br />
Gebäude und Heiztechnik im Bestand<br />
Die Berliner Blockbebauung aus dem 19. Jahrhundert gehört zu den<br />
Gebäudetypen mit dem geringsten spezifischen Wärmebedarf. Der<br />
durchschnittliche Wärmeleistungsbedarf liegt in instand gehaltenen Gebäuden<br />
bei ca. 90 W/qm Wohnfläche.<br />
Typische energetische Schwachpunkte der Berliner Altbauten sind<br />
• die Einfachfenster (überwiegend auf der Hofseite)<br />
• die Fensternischen (25 cm Mauerwerk)<br />
• die Fugen an Fenstern und Türen<br />
• die freistehenden Brandgiebel (25 cm Mauerwerk in den obersten<br />
drei Geschossen)<br />
• Wände und Decken (zum Treppenhaus, Durchfahrt, Dachboden,<br />
Keller) (Abb. 4-13)<br />
Je nach Lage im Gebäude weisen die einzelnen Wohnungen große<br />
Unterschiede bezüglich ihrer Wärmebedarfswerte auf: Die exponiert<br />
gelegenen Wohnungen benötigen das Drei- bis Vierfache an Wärmeenergie,<br />
gemessen an den günstig gelegenen eingebauten Wohnungen,<br />
was zu erheblichen finanziellen und raumklimatischen Benachteiligungen<br />
der betreffenden Mietparteien führt. (Abb. 14-15)<br />
106
Die unterlassene Instandsetzung/Instandhaltung der Gebäudeaußenhaut,<br />
der Schornsteine und Öfen in Sanierungsgebieten erhöht den<br />
Brennstoffbedarf der ofenbeheizten Wohnungen in vielen Fällen um<br />
mehr als 100%. (Abb. 16-20)<br />
Als Folge von Schäden an Schornsteinen und Öfen sind eine Vielzahl<br />
von Räumen trotz einer Brennstoffbeschickung nicht mehr oder nur<br />
unzureichend beheizbar. (Abb. 21)<br />
Instand gehalten und regelmäßig gewartet kann der Berliner Kachelofen<br />
in Konkurrenz zu anderen Heizsystemen treten. Den Nachteilen<br />
der Kohle-Ofenheizung wie Schmutz durch Asche und der, besonders<br />
für ältere Menschen beschwerliche, Kohlentransport in die oberen<br />
Geschosse stehen die Vorteile hoher Wirkungsgrad, behagliches Raumklima<br />
und geringe Heizkosten gegenüber. (Abb. 22)<br />
Auswirkung bisheriger Sanierungspraxis<br />
Die bisherige Sanierungspraxis war vor allem auf die Umstellung von<br />
Ofenheizung auf Sammelheizung ausgerichtet. Die damit verbundene<br />
Komfortsteigerung bewirkte eine Erhöhung der Benutzungsstundenzahl,<br />
die ihrerseits einen erheblichen Anstieg des Energieverbrauches<br />
und somit der Heizkosten nach sich zog.<br />
Da gleichzeitig auch die Kaltmieten steigen, ergaben sich nach der<br />
Modernisierung für viele Bewohner untragbar hohe Warmmieten.<br />
Die bisherige durchgreifende Modernisierung führte zu einer weiteren<br />
Verknappung an preisgünstigem Wohnraum auf dem Berliner Wohnungsmarkt.<br />
Ein weiteres Merkmal der bisherigen Sanierungspraxis ist eine nur<br />
sehr mangelhafte Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes. Insbesondere<br />
durch kostengünstige Maßnahmen, die gezielt an den energetischen<br />
Schwachstellen ansetzen, könnte der Energiebedarf deutlich unter<br />
die heutigen Werte gesenkt werden.<br />
Extreme Immissionsbelastung<br />
Das Problem der extrem hohen Immissionsbelastung der Kreuzberger<br />
Luft kann nicht allein auf die vorhandenen Ofenheizungen zurückgeführt<br />
werden. Weitere Verursacher sind: die Kraftwerke, die Sammelheizungen<br />
und der Verkehr. Hinzu kommt die mangelnde Durchlüftung<br />
des Innenstadtbezirkes.<br />
Wohnungen mit Sammelheizung (Gasheizungen ausgenommen) ver-<br />
107
Ursachen nur unwesentlich geringere Emission als Wohnungen mit Ofenheizung.<br />
Auch in Kreuzberg werden fast zwei Drittel der beheizten Nutzfläche<br />
mit Sammelheizungen versorgt. Die zum größten Teil veralteten Anlagen<br />
haben einen schlechten Wirkungsgrad und einen entsprechend<br />
hohen Schadstoffausstoß.<br />
Nicht instand gehaltene Öfen und Schornsteine verschlechtern den<br />
Wirkungsgrad der Ofenheizung und erhöhen entsprechend den Schadstoffausstoß.<br />
Schwelbrand sowie undichte Schornsteine und Öfen führen in Sanierungsgebieten<br />
nicht selten zu Emissionswerten, die bis über 200%<br />
gegenüber den Werten in Wohnungen mit instand gehaltenen Öfen<br />
liegen.<br />
Ziele der Energieplanung innerhalb einer behutsamen<br />
Erneuerungsstrategie<br />
Die energetischen Fragen in Berliner Sanierungsgebieten können nur im<br />
Zusammenhang mit den übrigen vielfältigen Problemen sozialer, ökologischer,<br />
baulicher und stadträumlicher Natur gelöst werden. Die enge<br />
Verflechtung der genannten Bereiche erfordert ein schrittweises Vorgehen<br />
bei der Entwicklung eines differenzierten Lösungsangebotes. Im<br />
Bereich der Wärmeversorgung beschreitet die offizielle Planung häufig<br />
einen anderen Weg. Bei der Orientierung an einem »idealen« Versorgungssystem<br />
wurden örtlich angepaßte angemessene Lösungen bisher<br />
kaum verwirklicht. Insbesondere im Zusammenhang mit der Planung<br />
der zentralen leitungsgebundenen Versorgungssysteme Fernwärme und<br />
Gas besteht die Gefahr, daß aus Anforderungen der Kapazitätsausnutzung<br />
Sachzwänge geschaffen werden, die eine Durchsetzung örtlich<br />
angepaßter Wärmeversorgungskonzepte erschweren.<br />
Für die Energieplanung in den <strong>Stadt</strong>erneuerungsgebieten Kreuzbergs<br />
ergeben sich aus der vorhandenen Problemlage folgende Ziele:<br />
1. Begrenzung des Heizkostenanstieges auf ein für die ansässige Bevölkerung<br />
tragbares Maß. Die monatlichen Heizungsbetriebskosten<br />
sollten 1,20 DM/qm Wohnfläche nicht übersteigen.<br />
2. Senkung der Immissionsbelastung der Gebäude.<br />
3. Verbesserung der wohnhygienischen Situation: Beseitigung der gesundheitsbeeinträchtigenden<br />
baulichen Mängel (Feuchtigkeitsschäden,<br />
zugige Fenster und Türen etc.). Herstellung eines Mindestmaßes<br />
an raumklimatischer Behaglichkeit im Rahmen einer zeitgemäßen<br />
Instandsetzung (Mindestwärmeschutz im Bereich der energetischen<br />
Schwachstellen).<br />
108
Wichtige Schwachstellen:<br />
• Decke zum Dachbodea<br />
• lußbodea im Erdgeschoß<br />
• Fensternische»<br />
• Fenster<br />
• Außentüren<br />
Abb. 4: Energetische Schwachstellen (Manteuffelstraße 42-39 Systemschnitt,<br />
M 1:200).<br />
109
Schwachstellen Wände<br />
und Türen<br />
• vertikal offene Verbindung,<br />
zwischen Durchfahrt und<br />
Treppenhaus<br />
Abb. 5: Energetische Schwachstellen (Manteuffelstraße 42-39 Erdgeschoß,<br />
M 1:200).<br />
110
Abb. 6: Schwachpunkt Fensternische.<br />
Abb. 7: Schwachpunkt Einfachfenster, überwiegend an Hoffassaden vorzufinden,<br />
in einer wärmetechnisch ausreichenden 64-cm-Ziegelwand.<br />
111
Abb. 8: Schemaskizze der Dichtungsebenen am Fenster.<br />
Abb. 9: Zugerscheinungen sind häufig auf offene Fugen am unteren Fensteranschluß<br />
zurückzuführen.<br />
112
Abb. 10: Die Berliner Altbaufenster sind durch besonders große Fugenlängen<br />
gekennzeichnet und weisen bei Einfachfenstern ohne Abdichtung hohe Lüftungswärmeverluste<br />
auf.<br />
113
Abb. 11: Abgetretene Türschwellen<br />
und schlecht<br />
schließende Außentüren<br />
verursachen hohe Lüftungswärmeverluste<br />
.<br />
Abb. 12: Treppenhäuser kühlen sehr stark aus, wenn sie eine offene Verbindung<br />
zu Durchfahrten haben.<br />
114
Abb. 13 und 14: Wohnungen<br />
in freistehenden Seitenflügeln<br />
haben häufig<br />
den dreifachen Wärmebedarf<br />
gegenüber eingebauten<br />
Wohnungen im<br />
Vorderhaus.<br />
115
Re Ö enrinMn UChtiSkeitSSChäden Wege " fehlender In standsetzung schadhafter<br />
116
Abb. 16: Feuchtigkeitsschäden im Erdgeschoß/Keller-Bereich durch aufsteigende<br />
Feuchtigkeit. Horizontale Feuchtigkeitssperre fehlt.<br />
Abb. 17: Feuchtigkeitsschaden in der Fensternische: Schwitzwasser von innen<br />
wegen zu geringem Wärmeschutz und Durchfeuchtung von außen wegen beschädigter<br />
und teilweise fehlender Zinkabdeckung.<br />
117
118<br />
Abb. 18: Schäden an den<br />
Fugen von Fenstern und<br />
Türen führen zu den höchsten<br />
Wärmeverlusten aus<br />
unterlassener Instandhaltung.<br />
Einbaufugen mit breitem<br />
Luftspalt und große<br />
Fugen im Fensterfalz<br />
machen Räume im Winter<br />
fast unbewohnbar.<br />
Abb. 19: Fehlende Verkittung<br />
ermöglicht den Eintritt<br />
von Wasser und kalter<br />
Außenluft.
Abb. 20a: Feuchte Dekken<br />
im 4. OG wegen unterlassener<br />
Ausbesserung der<br />
Dachhaut. Folge: Verrottung<br />
der Decke (Pilzbefall<br />
u. a.); ungesundes und unbehagliches<br />
Raumklima;<br />
höhere Heizkosten.<br />
Abb. 20b: Pilzbefall auf<br />
Dachbodendielung<br />
119
Abb. 21: Durchgängig vorzufindende Schäden an Schornsteinen: versottete<br />
Schornsteinköpfe; undichte Schornsteinzüge. Folgen sind: höherer Brennstoffbedarf;<br />
fehlende Leistungskraft; schlechter Schornsteinzug führt zu Schwelbrand;<br />
einzelne Räume sind kaum noch beheizbar; erhöhte Schadgasabgabe; gesundheitliche<br />
Gefährdung der Bewohner durch möglichen Rückstau der Abgase.<br />
120<br />
Abb. 22: Mängel an den<br />
vorhandenen Kachelöfen<br />
resultieren überwiegend<br />
aus vernachlässigter Wartung:<br />
Undichtigkeiten (Kachelfugen<br />
und Ofentüren);<br />
langjährig unterlassene<br />
Entrußung. Folgen:<br />
»Falschluft« verhindert den<br />
notwendigen Zug, so daß<br />
es zu Schwelbrand kommt;<br />
schlechte Verbrennung<br />
führt zu hohem Brennstoffverbrauch;<br />
erhöhter Schadgasabgabe;<br />
die Schornsteinzüge<br />
verrußen stärker;<br />
die unverbrannt abziehenden<br />
Teerdämpfe bewirken<br />
eine Versottung der<br />
Schornsteine; die dicke<br />
Rußschicht in den Öfen<br />
wirkt als Isolierschicht, so<br />
daß die Wärmeabgabe verringert<br />
wird.
4. Verbesserung des vorhandenen Ausstattungsstandards:<br />
• Einbau einer energiesparenden und umweltfreundlichen Warmwasserzubereitung<br />
im Rahmen des Badeinbaues.<br />
• Verbesserung der vorhandenen Ofenheizung durch ein differenziertes<br />
Lösungsangebot. Hierzu gehört auch die Entwicklung<br />
von Konzepten einer mittleren Komfortstufe, die zwischen der<br />
Ofenheizung und zentralen Heizsystemen angesiedelt ist.<br />
5. Vorrang energiesparender vor komfortsteigernden Maßnahmen,<br />
wie z.B. Umstellung von Einzelöfen auf Sammelheizung.<br />
Der durch die Heizungsumstellung bedingte Brennstoffmehrbedarf<br />
sollte durch energiesparende Maßnahmen mindestens ausgeglichen<br />
werden. Die vollflächige und undifferenzierte Beheizung sämtlicher<br />
Räume mittels Sammelheizung (»Wohlstandsheizen«), ohne<br />
Berücksichtigung der erforderlichen Raumtemperaturen und Nutzungszyklen<br />
sollte bereits durch die Planung (z.B. Heizkörperanordnung)<br />
vermieden werden.<br />
6. Baukosteneinsparung durch Koppelung der Maßnahmen zur energetischen<br />
Verbesserung an solche zur Instandsetzung (stufenweise<br />
Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen analog dem Instandsetzungszyklus<br />
der Bauteile).<br />
7. Gezielte Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes im Bereich der<br />
energetischen Schwachstellen, vor allem auch zur Verbesserung<br />
benachteiligter Wohnungen.<br />
8. Einsatz dezentraler Heizsysteme, die die direkte Regulierbarkeit<br />
des Energieverbrauches durch die Mieter ermöglichen.<br />
9. Information der Bewohner über »richtiges« sprich: energie- und<br />
umweltbewußtes Heizen im Rahmen des Erneuerungsprozesses.<br />
10. Anleitung und Förderung der Selbsthilfe im Bereich der energetischen<br />
Verbesserungen.<br />
Maßnahmenkonzepte einer koordinierten Wärmeversorgungsund<br />
<strong>Stadt</strong>erneuerungsplanung<br />
Städtebauliche Maßnahmen:<br />
Auch in Altbauquartieren sind die städtebaulichen Maßnahmen der<br />
erste Ansatzpunkt zur Verringerung des Wärmeleistungsbedarfs.<br />
Die wichtigsten Maßnahmen auf dieser Planungsebene liegen im<br />
Bereich der energetischen Baukörperoptimierung, deren wesentlichstes<br />
Merkmal eine kompakte Bauweise mit relativ großen Nutzflächen ist,<br />
d. h. die äußere Oberfläche (Abkühlfläche) ist im Verhältnis zum Volumen<br />
der Innenräume relativ klein.<br />
121
Für Berliner Altbauquartiere bedeutet dies konkret:<br />
1. Erhaltung der energetisch günstigen Altbauten, vor allem in geschlossener<br />
Blockrandbebauung;<br />
2. energiegerechte Dachgeschoßausbauten, wodurch bei Kreuzberger<br />
Altbauten der spezifische Wärmeleistungsbedarf eines Gebäudes um<br />
bis zu 18% gesenkt werden kann;.<br />
3. Neubebauungen als Baulückenschließung;<br />
4. Neubauten als Brandwandanbauten (auch zur Reduktion des Wärmeleistungsbedarfs<br />
der vorhandenen Gebäude);<br />
5. Beschränkung der Gebäudeabrisse auf freistehende Seitenflügel und<br />
hierbei nur auf Fälle, in denen weitere Kriterien, wie schlechter<br />
Zustand der Bausubstanz, ungenügende Ausstattung, schlechte Belüftung<br />
und mangelnde Besonnung der Wohnhöfe dafür sprechen.<br />
Werden energetisch ungünstige Baukörper aus städtebaulichen<br />
Gründen erhalten, müssen zusätzlich wärmedämmende Maßnahmen<br />
durchgeführt werden.<br />
Bei Verwirklichung der genannten Maßnahmen zur energetischen<br />
Baukörperoptimierung bei städtebaulichen Konzepten können 3-8 %<br />
des Energiebedarfs eines Berliner Altbauquartiers der Innenstadt<br />
und Innenstadtrandgebiete eingespart werden.<br />
Einige weitere, hier nicht ausgeführte Maßnahmen auf städtebaulicher<br />
Ebene seien noch zu erwähnen:<br />
6. Energiegerechte Nutzungskonzepte (wärmebedarfsorientierte Zonierung,<br />
Nutzungsüberlagerungen etc.);<br />
7. Klimaanpassung der Gebäude (Südorientierung der Gebäudeöffnungen,<br />
Windschutzmaßnahmen etc.);<br />
8. Koordinierte Wärmeversorgungs- und <strong>Stadt</strong>erneuerungsplanung<br />
(Koordination der wärmebedarfssenkenden Maßnahmen mit den<br />
örtlich optimal angepaßten Wärmeversorgungssystemen, d.h. im<br />
Planungsbereich Kreuzberg insbesondere Berücksichtigung der sozialen<br />
Bedingungen und der Umweltsituation).<br />
Maßnahmen des baulichen Wärmeschutzes<br />
Die Dämmung der Gebäudeaußenhaut gehört zu den effektivsten Maßnahmen<br />
zur Reduktion des Wärmeleistungsbedarfs. Je nach Gebäudetyp<br />
(z.B. Mehrfamilienhäuser unterschiedlicher Baualtersstufen, Gewerbebauten<br />
etc.) ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten einer<br />
nachträglichen dämmtechnischen Verbesserung.<br />
Bei der Auswahl und Dimensionierung der Maßnahmen müssen je<br />
nach Gebäudetyp die unterschiedlichen baukonstruktiven und bauphysi-<br />
122
kaiischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Die ausschließliche<br />
Festlegung der Dämmstärken nach wirtschaftlichen Kriterien ist insofern<br />
problematisch, als in kurzen Zeitabständen, je nach Energiepreisentwicklung,<br />
größere Dämmstärken in den wirtschaftlichen Bereich<br />
kommen können. Am kostengünstigsten ist die Durchführung der Maßnahmen<br />
des baulichen Wärmeschutzes im Zusammenhang mit Instandsetzungs-<br />
und Modernisierungsmaßnahmen.<br />
Ein großer Teil der Maßnahmen des baulichen Wärmeschutzes eignet<br />
sich besonders gut für die Durchführung in Selbsthilfe durch die Bewohner.<br />
Viele Arbeiten können auch von handwerklich wenig geübten<br />
Laien ausgeführt werden. Im Rahmen einiger IBA-Projekte wurde die<br />
Durchführung dieser Arbeiten modellhaft erprobt. Für eine breitere<br />
Anwendung dieses nicht unerheblichen Selbsthilfepotentials fehlen jedoch<br />
noch die organisatorischen und technischen Voraussetzungen (z. B.<br />
Koordination mit den übrigen Instandsetzungsmaßnahmen, Anleitung<br />
und Überwachung der Arbeiten, Verbesserung der öffentlichen Förderung<br />
u.a.), auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. (Abb.<br />
23)<br />
Die Ausführungsarten der Maßnahmen, die für eine Durchführung in<br />
Abb. 23: Wärmedämmung einer 25-cm-Giebelwand als Selbsthilfemaßnahme<br />
der Bewohner - nicht komplizierter als Tapezierarbeiten.<br />
123
Selbsthilfe geeignet sind, unterscheiden sich von einer professionellen<br />
Handwerkerausführung 1 zum Teil erheblich. Wir unterscheiden zwei<br />
Maßnahmengruppen:<br />
a) Selbsthilfe Wärmeschutz - Basisvariante<br />
Hierzu gehören folgende Maßnahmen:<br />
• Dämmung des Fußbodens im Dachgeschoß<br />
• Dämmung der Fensternischen<br />
• Falzabdichtung an Fenstern und Türen<br />
• Doppelverglasung der Einfachfenster (Vorsatzflügel oder Folie)<br />
b) Selbsthilfe Wärmeschutz - Maximalvariante<br />
Zusätzlich zu den unter a) genannten Maßnahmen<br />
• Dämmung des Fußbodens über Durchfahrten<br />
• Dämmung der Kellerdecke<br />
• Dämmung der Giebelwände (von innen)<br />
• Dämmung der Innenwände zu unbeheizten Räumen (z.B. zu<br />
Treppenhäusern und Durchfahrten)<br />
Bei Anwendung der unter a) aufgeführten Maßnahmen können in<br />
Berliner Altbauten Senkungen des Wärmeleistungsbedarfs von 19 bis<br />
25% erzielt werden. Werden zusätzlich die Maßnahmen der Gruppe<br />
b) Maximalvariante durchgeführt, die ein erheblich höheres handwerkliches<br />
Geschick erfordern, so steigt die mögliche Senkungsquote auf<br />
durchschnittlich 25-35%.<br />
Dämmtechnische Maßnahmen zur maximalen Senkung<br />
des Wärmeleistungsbedarfs<br />
Die folgenden Maßnahmen zum baulichen Wärmeschutz im Rahmen<br />
der Altbauerneuerung gehören unter energetischen Gesichtspunkten in<br />
der Regel heute nicht zu den wirtschaftlichen Maßnahmen. Bei einem<br />
Teil der Maßnahmen scheitert eine breite Einführung darüber hinaus derzeit<br />
an weiteren Ursachen, wie Denkmalsschutz oder Nutzerverhalten.<br />
Da diese Maßnahmen auch eine Reihe weiterer qualitativer Verbesserungen<br />
bewirken, wie z.B. behagliches Raumklima, Schallschutz, Nutzungsverbesserungen<br />
etc., sollte die Anwendung dieser Maßnahmen in<br />
jedem Einzelfall geprüft werden. Hierzu gehören u.a.:<br />
• Die Anbringung von Dreifachfenstern (insbesondere an Nordfassaden)<br />
• Wintergärten, z.B. als Loggien- oder Balkonverglasungen<br />
• Maßnahmen des temporären Wärmeschutzes, z.B. in Form von<br />
Klappläden<br />
• Dämmung der Fensterfassaden (insbesondere an Nordfassaden)<br />
• Dach- und Fassadenbegrünung (Abb. 24-26)<br />
124
Abb. 24: Verglaste Loggien und angelehntes Glashaus als Wintergärten - bei<br />
bestehenden Gebäuden leicht nachträglich anzubringen.<br />
125
Abb. 25: Temporärer Wärmeschutz an Fenstern. Hier in Form von historischen<br />
Klappläden.<br />
126
Abb. 26: Klimaanpassung der Gebäude. Hier Fassadenbegrünung.<br />
127
Zusammen mit Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen<br />
Schwachpunkte kann die Anwendung der hier aufgeführten erweiterten<br />
Maßnahmen an Einzelgebäuden zu Einsparungsquoten von 50 bis 60 %<br />
führen.<br />
Umstellungen von Heizsystemen<br />
Ein wesentlicher Anlaß für die Umstellung von Heizsystemen im Rahmen<br />
der Altbauerneuerung ist die Anhebung des Bedienungskomforts.<br />
Anderen wichtigen Kriterien, wie Energieeinsparung, Austausch von<br />
Energieträgern, Kostensenkung und Umweltverbesserung wurde bisher<br />
noch zu wenig Bedeutung beigemessen.<br />
Die bisher üblichen Arten der Heizanlagenumstellung von der Einzelofenheizung<br />
zur Etagen- bzw. Sammelheizung führen zwar zu einem<br />
Anstieg des Komforts, bringen jedoch gleichzeitig das Problem hoher<br />
Kosten mit sich. Aus diesem Grunde wurde im Rahmen der kleinen<br />
Modernisierung innerhalb der IBA-Gebiete dem Wunsch der meisten<br />
Mieter, die Ofenheizung beizubehalten, Rechnung getragen. Die Forderung,<br />
ein Heizsystem zu entwickeln, welches im Rahmen begrenzter<br />
Heizkostensteigerungen eine gewisse Komfortanhebung ermöglichte,<br />
bleibt dabei jedoch bestehen.<br />
Innerhalb mehrerer Forschungsprojekte wurde eine Reihe von Kombinationsmöglichkeiten<br />
der vorhandenen Kohleeinzelofenheizung mit<br />
Sammelheizungssystemen erprobt.<br />
Das Konzept Gas-Kernbeheizung<br />
Mit Systemen der Gas-Kernbeheizung fand sich eine Verbesserungsmöglichkeit,<br />
die z. Z. in einigen Modellhäusern der IBA erfolgreich<br />
erprobt und geprüft wird. Als Energieträger wird Gas (<strong>Stadt</strong>- bzw.<br />
später Erdgas) verwendet.<br />
Die vorhandene Kohle-Einzelheizung wird durch ein Gas-Heizsystem<br />
ergänzt. In jeder Wohnung wird an einer zentralen Stelle (Innenwand)<br />
in einem Wohnraum bzw. der Wohnküche eine zusätzliche Heizfläche<br />
installiert (Heizkörper oder Gas-Raumheizer). Mit dieser Heizfläche<br />
wird der Wohnraum (Kernbereich) die gesamte Heizperiode hindurch<br />
kontinuierlich beheizt. Die übrigen Wohnräume erhalten dadurch ebenfalls<br />
eine gewisse Grund wärme, die durch Öffnen und Schließen der<br />
Türen - wie heute mit der Kohleofenheizung praktiziert - reguliert wird.<br />
Eine zusätzliche Beheizung (Nachheizen mittels Kohleöfen) wird an<br />
kälteren Tagen erforderlich. Die Nutzung der Kohle-Einzelöfen wird<br />
dadurch auf etwa drei Monate begrenzt.<br />
128
Bei gleicher Lage in allen Geschossen kann der Kernbereich der<br />
Wohnungen mit einer Gas-Sammelheizung ausgestattet werden.<br />
Eine andere flexiblere Form der Gas-Kernbeheizung erlaubt auch<br />
eine wohnungsweise Einführung. Die vorhandenen Kohle-Einzelöfen<br />
im Kernbereich werden anstelle der Heizkörper durch Gas-Raumheizer<br />
mit Schornstein- oder Außenwandanschluß ersetzt. Diese Geräte sind<br />
heute mit einer sogenannten modulierenden Regelung ausgestattet,<br />
wodurch sie Wirkungsgrade von über 80% erreichen können. Die<br />
meisten der installierten Zentralheizungssysteme werden damit übertroffen<br />
(Leitungs- und Stillstandsverluste entfallen).<br />
Anhebung auf eine mittlere Heizkomfortstufe<br />
Die Komfortverbesserung durch die Gas-Kernbeheizung ist offensichtlich:<br />
Die Benutzung der Ofenheizung wird auf die kalten Tage begrenzt<br />
' (Heizperiode ca. 3 Monate), morgens ist mindestens ein Raum warm<br />
(kein Frösteln beim Frühstück), weniger Schmutz durch selteneren<br />
Kontakt mit Brennmaterialien, geringere Belastung durch Brennstofftransport<br />
in die oberen Geschosse. Die Substitution des Brennstoffs<br />
Kohle durch Gas liegt, je nach Heizgewohnheit und Anordnung der<br />
Heizkörper, bei 50-70%, wodurch eine deutliche Reduktion der örtlichen<br />
Emission bewirkt wird.<br />
Die Heizkosten bleiben in Grenzen, zum einen, weil ein sparsamer<br />
Gasverbrauch durch die individuelle Regulierbarkeit gegeben ist, zum<br />
anderen kann, sobald ein Wohnraum mit Heizgas versorgt ist, ein<br />
günstigerer Gastarif in Anspruch genommen werden.<br />
Die Baukosten sind, insbesondere im Rahmen der Instandsetzung,<br />
sehr gering. Es kann davon ausgegangen werden, daß im Sanierungsgebiet<br />
in jeder Wohnung durchschnittlich mindestens ein Kohleofen erneuert<br />
werden muß (z.B. Ersetzen funktionsuntüchtig gewordener Kochmaschinen<br />
durch einen Kohle-Beistellherd). Wird nun anstelle des<br />
Kohleofens gleich ein Gas-Raumheizer installiert, ergeben sich lediglich<br />
Mehrkosten von ca. 300,- bis 500- DM pro Wohneinheit.<br />
Die angeführten Verbesserungen/Wirkungen verdeutlichen, daß das<br />
System der »Gas-Kernbeheizung« für ofenbeheizte Altbaugebäude mit<br />
überwiegend einkommensschwacher Bevölkerung ein optimal angepaßtes<br />
Heizsystem darstellt. Die Anhebung auf eine mittlere Komfortstufe<br />
bei gleichzeitig deutlicher Reduktion des Schadstoffauswurfs der Ofenheizung<br />
ist mit minimalem Mittelaufwand möglich. Das Konzept ist für<br />
eine breite Anwendung geeignet.<br />
Wird eine weitere Komfortverbesserung, d.h. konkret der Einbau<br />
einer Sammelheizung gewünscht, so sollte, zur Eingrenzung der ört-<br />
129
liehen Schadstoffbelastung in Kreuzberg, ausschließlich der Energieträger<br />
Gas verwendet werden. Darüber hinaus sollte der durch die<br />
Komfortsteigerung steigende Energieverbrauch gleichzeitig durch einen<br />
umfangreichen Einsatz der Maßnahmen des baulichen Wärmeschutzes<br />
kompensiert werden.<br />
130
Werner Schenkel<br />
Materialhaushalt<br />
und Abfallrecycling<br />
Im Rahmen dieses ökologischen Seminars zur Internationalen Bauausstellung<br />
grenze ich das Thema auf die Komplexe Bauwesen, Haus- und<br />
Gewerbemüll ein. Ich werde mir außerdem versagen, Ihnen die Philosophie<br />
und Theorie des Recyclings vorzutragen. Vielmehr will ich einige<br />
Elemente herausarbeiten, die mir wichtig erscheinen, und Fragen des<br />
Materialeinsatzes, der Baukonstruktion, der Grundrißgestaltung und<br />
der Infrastruktur unter den Gesichtspunkten zentraler und dezentraler<br />
Entsorgung beantworten. Ich will mich äußern zu den Themen:<br />
• Verwendung von Sekundärmaterialien im Bauwesen;<br />
• Baukonstruktion und Abfallentstehung;<br />
• Ansätze zu alternativen Formen der Sammlung und Verwertung<br />
häuslicher Abfälle.<br />
Sekundärrohstoffe im Bauwesen<br />
Für die zukünftige Bau- und Sanierungstätigkeit werden Baustoffe<br />
benötigt. Nach den mir zugänglichen Quellen unterstelle ich für eine<br />
4köpfige Familie und ca. 350 m 3 umbauten Raum folgende Mengen<br />
(Dreizimmerwohnung, 72 qm, 1972 gebaut, 4geschossiger Mauerwerksbau,<br />
Fundamente, Geschoßdecken und Balkone in Stahlbeton, Schwimmender<br />
Estrich):<br />
• Beton 31,5 m 3<br />
• Mauerwerk 38,5 m 3<br />
• Betonstahl 1,8 t<br />
• Gips und Estriche 5,0 m<br />
• NE-Metalle 50,0 kg<br />
• Kunststoffe, Beläge 1,5 m 3<br />
• Holz einschließlich Innenausbau 3,5 m 3 .<br />
Stellt man nun die Abfallmengen des Landes Berlin gegenüber, dann<br />
fallen laut Mitteilung des Senators für Bau- und Wohnungswesen bis<br />
. 131
1990 bei einer jährlichen Abrißquote von 6000 Wohnungen im Jahr, ca.<br />
70-100 Jahre alt, 400 m 3 Bruttoinhalt, folgende Mengen an:<br />
• Bauschutt " 50000 m 3<br />
• Gipse aus der Rauchgasentschwefelung ab 1983 25000 t<br />
• Granulat aus der Kohleverstromung 120000 t<br />
• Müllschlacken 80000 t<br />
Für den außenstehenden Betrachter stellt sich die Frage: Warum wird<br />
hier Bedarf und Vorkommen nicht oder nur unzureichend verknüpft?<br />
Gibt es Gründe, die dagegen sprechen? z.B.:<br />
• die Wirtschaftlichkeit (800001 aufbereitete Müllschlacke je 50 DM in<br />
die DDR? Ziegelsplitt und Altholzaufarbeitung sind o.k.);<br />
• die etablierten Rohstofflieferanten (Naturgipse, Zementhersteller);<br />
• die bestehenden Normen (Beispiel der österreichischen Norm für<br />
Zementzusätze aus Braunkohlenflugaschen);<br />
• die humanökologischen Aspekte (Strahlungen, Schwermetallkontamination).<br />
Andererseits hätte eine solche Verknüpfung Vorteile:<br />
• die Schonung der Ressourcen (z.B. könnten aus Kohlefeuerungsflugasche<br />
ca. 20% des Zementbedarfs und aus Entschwefelungsgips<br />
ca. 60% des Baugipsbedarfs gedeckt werden);<br />
• die Bewahrung von Landschaften (in Gutachten der BGR werden als<br />
begrenzender Faktor für die Gewinnung von Sand, Kies, Gips und<br />
Ton die scharfen Bestimmungen für Landschafts- und Naturschutz<br />
sowie Grundwasserschutz angegeben);<br />
• die Einsparung von Deponieflächen (Abfallmengen Schutt in der<br />
Bundesrepublik Deutschland jährlich ca. 70 Mio. Tonnen pro Jahr<br />
(t/a), Flugaschen 15 Mio. t/a, Gipse 2 Mio. t/a);<br />
• Einsparungen von Transportleistungen für den Antransport des Primäranteils<br />
und den Abtransport des Abfalls.<br />
Die IBA ist ein hervorragendes Medium, um die Nutzung von Sekundärrohstoffen<br />
im Bauwesen zu demonstrieren. Sie wäre sehr geeignet,<br />
den unterbrochenen Nutzungskreislauf von Baustoffen wenigstens teilweise<br />
zu schließen und damit Ressourcen zu schonen und die Abfallbeseitigung<br />
zu entlasten. Und sie wäre drittens phantastisch dazu geeignet,<br />
die kommunale Verantwortung für die Rohstoffwirtschaft am Beispiel<br />
des Bauwesens zu demonstrieren.<br />
132
Baukonstruktion und Abfallentstehung<br />
Bei aller Hochachtung vor der guten Arbeit der Architekten und<br />
Bauingenieure gehe ich davon aus, daß ihre Bauten in überschaubaren<br />
Zeiträumen auch wieder abgerissen werden. Sieht man heute solche<br />
Unternehmungen bei Gebäuden aus der Zeit zwischen 1880 und 1910,<br />
dann ist diese Arbeit charakterisiert durch:<br />
• Lärm<br />
• Staub<br />
• Zerstörung von Bauteilen<br />
• Mögliche Nutzung von Ziegeln, Steinen und Holz.<br />
Bei unseren heutigen Gebäuden mit gespannten Decken, betonstahlmonierten<br />
Trägern, betonierten Wänden ist dies nahezu unmöglich. Die<br />
Abbruchtechnik bzw. die Destruktionsüberlegungen sind völlig unzureichend<br />
entwickelt, um die wertvollen Teile wie Rohre, Leitungen u.a.<br />
vorab zu entnehmen und die Massengüter so weit aufzubereiten, daß sie<br />
als Zuschlagstoffe, Hilfsstoffe und Ersatzstoffe wieder Verwendung<br />
finden.<br />
Die IBA ist ein hervorragendes Medium, um auch diesen Gedanken<br />
der geplanten Destruktion in die Diskussion einzuführen, ihn an Beispielen<br />
durchzuarbeiten und damit internationale Maßstäbe zu setzen<br />
für ein Problem, das zwischenzeitlich in mehreren Ländern, besonders<br />
den Niederlanden, aufgegriffen wird.<br />
Ansätze zu alternativen Formen der Sammlung und Verwertung<br />
häuslicher Abfälle<br />
Die heute übliche Form der Abfallbeseitigung ist charakterisiert durch:<br />
• gemischte Sammlung in normierten Gefäßen;<br />
• Transport zu zentralen Behandlungsanlagen;<br />
9 Verbrennung 30%, Kompost 2%, Deponie 68%.<br />
Sie ist nicht rohstoff- und energiesparend. Sie ist nicht umweltentlastend.<br />
Sie ist charakterisiert durch eine zentrale, spezialisierte und<br />
unflexible Technologie. Diese Form ist aber betriebssicher, unabhängig<br />
von der Mitwirkung des einzelnen Einwohners, hygienisch und von den<br />
Betriebskosten her optimierbar. Trotz dieser Zentralisierung werden an<br />
den Sammelpunkten vergleichsweise kleine Abfallmengen mit starker<br />
Schwankung der Zusammensetzung zusammengetragen. Für die Bearbeitung<br />
dieser Mengen sind flexible Verarbeitungsverfahren erforderlich,<br />
wie sie großtechnisch meist nicht erreichbar sind.<br />
133
Welche Alternativen stehen zur Diskussion?<br />
• Wertstoff- und Energiegewinnung statt Beseitigung;<br />
• getrennte Sammlung an den Quellen und Änderung der Standgefäße;<br />
• Auslese und Verarbeitung in dezentralen Höfen;<br />
• Überprüfen der Verbrauchs- und Käufergewohnheiten.<br />
Beim Rückgewinnen von Wertstoffen aus kommunalen Abfällen gibt es<br />
3 Probleme:<br />
• Wie gewinnt man die Wertstoffe?<br />
• Zu welchen Produkten lassen sie sich verarbeiten?<br />
• Welche Gehalte sind im Hausmüll enthalten?<br />
Nach unseren Kenntnissen sind im Hausmüll üblicherweise enthalten:<br />
• 20-25 % Papier und Pappe,<br />
• 8-10% Kunststoff,<br />
• 4- 6% Metalle,<br />
• 8-10% Glas,<br />
• 50-60% Rest.<br />
Dazu kommen die teilweise sehr reichen Abfälle aus dem verpackenden<br />
Gewerbe, dem Handel und der Verwaltung sowie die teilweise sehr<br />
wertstoffreichen Sperrmüllmengen. Bei einem Beispiel von 4000 Einwohnern<br />
wären dies etwa 1000 t/a Hausmüll, 200 t/a Geschäftsmüll und<br />
120 t/a Sperrmüll.<br />
Vom Hausmüll sind 500 t/a kompostierfähig, 250 t/a als Papier, Glas<br />
und Metall und Kunststoff auslesbar, und 250 t/a verbleiben als abzufahrender<br />
Rest. Die Wertstoffe lassen sich gewinnen durch:<br />
• gemischte Sammlung und zentrale mechanische Trennung;<br />
• getrennte Sammlung a. d. Quelle und getrennte Weiterverarbeitung.<br />
Betrachten wir in unserem Falle die getrennte Sammlung für die einzelnen<br />
Werkstoffgruppen näher.<br />
Für Glas und mit Einschränkung auch für Papier haben sich zentral<br />
aufgestellte große Container bewährt. Nachteilig ist der geringe Erfassungsgrad<br />
(ca. 25% der vorhandenen Wertstoffe) und die ständige<br />
Nacharbeit bei den Standorten. Bei Dosen hat sich dieses Verfahren<br />
bisher nicht bewährt. Sie lassen sich besser magnetisch aus dem gemischten<br />
Strom auslesen.<br />
Die systemlose Sammlung von Altpapier und Alttextilien durch karitative<br />
und private Organisationen sei hier nur deshalb erwähnt, weil<br />
deutlich wird, daß die Entsorgungssicherheit nur dann gegeben ist, wenn<br />
der Markt auch die aufgenommenen Altstoffe abnimmt und die Entsorgung<br />
regelmäßig erfolgt.<br />
134
Die getrennte Sammlung von Abfällen im Haushalt stößt einerseits<br />
auf die Schwierigkeit, daß in den Wohnungen nicht ausreichend Lagerund<br />
Stapelflächen zur Verfügung stehen und die üblicherweise benutzten<br />
Gefäße dafür ungeeignet sind. Hier haben nun in den letzten Jahren<br />
eine Reihe von Versuchen angesetzt, um im Rahmen der etablierten<br />
Müllabfuhr die getrennte Sammlung zu realisieren:<br />
• Zweikammermüllsystem (60-80% Erfassungsquote [EQ]);<br />
• Sack im Behälter (30% EQ);<br />
• Getrennte Sammlung von Papier, Glas und Restmüll anstelle der<br />
üblichen Abfuhr (20-80% EQ);<br />
• Auslese von Schadstoffen (z.B. Quecksilber-Batterien).<br />
Der Erfassungsgrad der Wertstoffe liegt bei diesen Verfahren zwischen<br />
20 und 60%, bei einer jüngst in Berlin für Müllabwurfschächte untersuchten<br />
Variante sogar bei 80%. Diese getrennte Sammlung zeichnet<br />
sich durch geringe Investitionskosten, geringe Risiken, gute schrittweise<br />
und flexible Anpassung an den Markt aus. Auch die Reinheit der<br />
gewonnenen Produkte ist gut. Schwierig sind dagegen Kooperationsbereitschaft,<br />
Ausdauer und Sorgfalt der beteiligten Bevölkerung zu erhalten.<br />
Bei den soziologischen Begleituntersuchungen waren zwei Ergebnisse<br />
zu verzeichnen:<br />
• eine engagierte, informierte, wirtschaftlich gut ausgestattete neue<br />
Mittelschicht ist motiviert, aus Umweltschutzgründen getrennt zu<br />
sammeln;<br />
• das Engagement läßt zeitabhängig stark nach.<br />
Diese Ergebnisse haben für die konventionelle Abfuhr Folgen:<br />
• Neben der getrennten Sammlung muß die konventionelle Sammlung<br />
(Gefäßgestaltung, Kfz. und Müllwerker) für die nicht auslesbaren<br />
Restmengen erhalten bleiben und wird relativ teuer;<br />
• die hygienische Entsorgung erfordert in derart geballten Bevölkerungsräumen<br />
Notsysteme;<br />
• die persönliche Motivation entscheidet über den Erfolg der Abfuhr<br />
und nicht mehr der nach der Arbeitsteilung Zuständige.<br />
An Untersuchungen in Konstanz und Schalksmühle sind soziologische<br />
Motivationsuntersuchungen vorgenommen worden. So waren z.B. in<br />
Schalksmühle zwar 45 % der Bevölkerung bereit, sich freiwillig an der<br />
getrennten Papiersammlung zu beteiligen. Tatsächlich waren es dann<br />
nur noch 17%, wobei mit zunehmender Versuchsdauer die Beteiligung<br />
stetig abnahm. Bei dieser Beteiligung gab es keine Bevölkerungsgruppe,<br />
die besonders motiviert war. Es gibt keine Alternative zur Strategie,<br />
über den Umweltschutzgedanken und die mit ihm verbundenen Proble-<br />
135
me die Bevölkerung zur Teilnahme an der Wertstoffsammlung zu motivieren.<br />
»<br />
Würde man noch einen Schritt weitergehen und auch die kompostierbaren<br />
Stoffe lokal verarbeiten wollen, so müßte man, um bei unserem<br />
Beispiel zu bleiben, mit ca. 400 t Kompost pro Jahr rechnen. Bei<br />
zweimal jährlicher Ausbringung benötigt man ca. 900 qm Zwischenlagerflächen<br />
und ca. 4 ha Nutzungsfläche in Form von bepflanzten Dächern,<br />
Gärten, Parks u.a. Allerdings hätte diese direkte Form der<br />
Wiederverwertung eigener Abfälle vielleicht den erzieherischen Wert,<br />
daß Fremdstoffe, die dem Kompost und den Pflanzen schaden, durch<br />
separate Sammlung auch dem Abfall und Abwasser ferngehalten werden.<br />
Alternativ zu dieser Komposttechnik wären Biogasanlagen einzusetzen.<br />
Über Erfahrungen mit Biogasanlagen, die mit Hausmüll betrieben<br />
werden, ist mir nichts bekannt.<br />
Je stärker der Gedanke der Verwertung in der Abfallbehandlung<br />
aufgegriffen wird, desto mehr muß man bei der Planung die Eigenschaften,<br />
insbesondere die Zusammensetzung des Rohmülls berücksichtigen.<br />
Z.B. scheint ein Papiergehalt von 15 Gewichtsprozenten die kritische<br />
Untergrenze zu sein. Die getrennte Sammlung setzt voraus, daß in den<br />
Wohnungen oder im Wohnblock Platz zum Stapeln von Wertstoffen<br />
vorhanden ist, daß diese regelmäßig entsorgt werden bzw. daß zentrale<br />
Sammelcontainer in angemessener Entfernung stehen. Die Einflüsse<br />
von Sammlung und Transport kommen um so stärker zur Geltung, je<br />
komplizierter die nachgeschalteten Verfahren sind und je intensiver die<br />
Abfallverwertung betrieben wird. Berücksichtigt man neben technologischen<br />
und ökonomischen Kriterien der Sammlung und des Transports<br />
auch die systemimmanenten Bedingungen bei der Verwertung und<br />
Vermarktung, so führt dies zu einem sehr komplexen Gesamtsystem.<br />
Noch ein Wort zu den Müllsammelbehältern. Größe und Formgebung<br />
der Sammelbehälter begrenzen die Stückgröße der aufzunehmenden<br />
Abfälle nach oben. Bei den Großbehältern mit bis zu 5 m 3 wird auch ein<br />
erheblicher Anteil der Abfälle wie z.B. Verpackungsmittel miterfaßt,<br />
die früher überwiegend in den Sperrmüll gelangten. Da Sperr- und<br />
Gewerbeabfälle oft den größten Werkstoffanteil aufweisen, ist diese<br />
Verfahrensweise unter dem Aspekt der Verwertung nachteilig. Wichtig<br />
ist in diesem Zusammenhang auch, daß sich durch Umstellung von 35und\50-l-Gefäßen<br />
auf 240-1-Müllgroßbehälter die Müllmengen etwa<br />
verdoppeln, d. h. die Müllmenge hängt vom Behältervolumen ab.<br />
Es deutet einiges darauf hin, daß nach einer Umstellung auf größere<br />
Sammelbehälter die Haushalte nicht mehr in gleichem Maße wie zuvor<br />
bereit sind, an der getrennten Sammlung von Wertstoffen teilzunehmen.<br />
Lassen Sie mich zum Schluß noch eine Alternative aussprechen:<br />
Überprüfung des Verbrauchs- und Käuferverhaltens. Die bisher vorge-<br />
136
tragenen Lösungen setzen voraus, daß der Hausmüll, bestimmt durch<br />
Produktions- und Verbraucherverhalten, anfällt. Es sind auch Maßnahmen<br />
denkbar, die schon bei der Entstehung des Hausmülls, z.B. beim<br />
Einkauf (Milch wieder in Mehrwegflaschen) das Abfallaufkommen beeinflussen.<br />
Diese Alternative setzt aber ein noch intensiveres Mitarbeiten<br />
der Bevölkerung voraus.<br />
Ich habe es in, Ihrem Kreis vermieden, über Aspekte von Abfall und<br />
Subkultur, wie sie Jona Friedmann formuliert hat oder wie sie auf dem<br />
Workshop des Deutschen Werkbundes in Darmstadt abgehandelt wurden,<br />
zu sprechen. Ich habe den Einsatz mittlerer Technologie bei der<br />
Verwertung der Abfälle nicht vertieft. Auch die ökologische Folge<br />
dieses »small is beautiful«-trips habe ich nicht ausgeführt. Auch die<br />
Grenzen des Recyclings, Nutzungskaskaden, Mehr- und Einwegverwendung<br />
habe ich nicht vertieft. Ich will zum Abschluß nur nochmals den<br />
Gedanken aufgreifen, daß die Möglichkeit, Recycling zu realisieren, am<br />
leichtesten dort geht, wo gleichzeitig ein Bedarf an Produkten besteht,<br />
die aus Sekundärmaterial hergestellt werden. In diesem Zusammenhang<br />
hat die IBA eine einmalige Chance.<br />
137
Gabriele Güterbock /Bensu Hubert/Franz Rottkord<br />
Recycling von Haushaltsabfällen<br />
in Berlin-Kreuzberg - ein Versuch<br />
Seit Ende 1983 arbeiten wir drei - eine freie türkische Mitarbeiterin der<br />
IBA-Abteilung <strong>Öko</strong>logie und zwei Absolventen des Fachgebietes Abfallwirtschaft<br />
der TU Berlin - an der Aufgabe, die getrennte Sammlung<br />
von »Wert- und Kompostrohstoffen«, wie das in der Fachsprache heißt,<br />
im IBA-<strong>Stadt</strong>erneuerungsgebiet, d.h. in Berlin-Kreuzberg, einzuführen.<br />
In West-Berlin werden bereits über 130000 Haushalte getrennt<br />
entsorgt. Dies ließ uns hoffen, daß unsere Aufgabe nicht allzu schwierig<br />
sein würde. Die Einführung dieser ökologischen Maßnahmen in Kreuzberg<br />
trifft jedoch auf verschiedene Schwierigkeiten.<br />
Zuerst einmal bestand eine große Hürde in der Absprache mit den<br />
beiden großen Entsorgungsunternehmen, einer privaten Firma und<br />
einem Eigenbetrieb der <strong>Stadt</strong> Berlin. Beide konkurrieren auf dem seit<br />
kurzem »freien« Recyclingmarkt in Berlin um Marktanteile mit ganz<br />
unterschiedlichen Vorzügen und Nachteilen, sowohl für den privaten<br />
Nutzer wie auch für die Volkswirtschaft insgesamt. Es war nicht einfach,<br />
sie zu einer Mitarbeit mit uns an diesem Modellversuch zu bewegen,<br />
denn Kooperation für ein gemeinsames Ziel und Konkurrenz untereinander<br />
schließen sich weitgehend aus.<br />
Die zweite Hürde ist der Erneuerungsprozeß selbst, d.h. die noch<br />
nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen. Dort, wo Häuser instand gesetzt<br />
werden, kommen auf die Mieter große Belastungen physischer und<br />
psychischer Art zu. Wir können nicht erwarten, daß sie zu all dem auch<br />
noch neue Verhaltensweisen in bezug auf die Trennung ihrer Müllbestandteile<br />
erlernen wollen.<br />
Nach vielen Gesprächen mit Blockplanern der IBA und Mieterberatern<br />
fanden wir geeignete Blöcke, in denen die Erneuerungsarbeiten<br />
abgeschlossen sind, oder wo bereits Selbsthilfegruppen existieren. Dort<br />
fangen wir mit unserem Versuch an.<br />
Die dritte Hürde ist der große Anteil ausländischer, zumeist türkischer<br />
Bewohner in dem Gebiet. Die Notwendigkeit, diesem Teil der<br />
Bevölkerung umweltschonende Maßnahmen plausibel zu machen, stößt<br />
auf andere Probleme. Warum sollten Menschen, die nicht einmal das<br />
Kommunal Wahlrecht, also politisches Mitspracherecht, haben, Verant-<br />
138
wortung für ihre Umwelt übernehmen und sie aktiv gestalten? Trotzdem<br />
versuchen wir, sie miteinzubeziehen. Wir können unsere Vermittlung<br />
jedoch nicht allein auf die Trennung von Abfällen beschränken, denn<br />
über Recycling sprechen, heißt für die Bewohner auch, über <strong>Öko</strong>logie<br />
und Kultur sprechen. Wenn das nicht möglich ist, dann bleibt alles<br />
weiterhin verfangen in Symptom-Bekämpfung und wird zunehmend<br />
administrativ, bürokratisch und leer. Wir stellen immer wieder fest -<br />
besonders bei Jüngeren -, daß im Aufwachsen und Leben zwischen den<br />
Kulturen eine Chance besteht, zusammen eine kulturelle Identität zu<br />
entwickeln. Dazu müssen wir autonome und dezentrale Aktivitäten in<br />
Kreuzberg unterstützen.<br />
Ein Versuch in diese Richtung ist die Arbeitsgruppe »Müll und<br />
Recycling«, in der verschiedene Selbsthilfegruppen zusammen mit dem<br />
Verein SO 36 und anderen Initiativen Anregungen zur getrennten<br />
Sammlung und Kompostierung von organischen Müllbestandteilen erarbeiten<br />
und ins Gebiet tragen wollen. Wenn genügend Mieter bereit sind<br />
mitzumachen, kann mit der getrennten Sammlung begonnen werden.<br />
Das wichtigste erste Problem, bevor überhaupt mit der getrennten<br />
Sammlung im <strong>Stadt</strong>erneuerungsgebiet begonnen werden kann, ist eine<br />
gut funktionierende Straßenreinigung und Sperrmüllabfuhr. Das von<br />
der Berliner <strong>Stadt</strong>reinigung betriebene System der Sperrmüllabfuhr auf<br />
Anruf mit 2- bis 3wöchigen Wartezeiten klappt in diesem Gebiet noch<br />
nicht. Durch unser Informationsblatt »Wohin mit dem Müll?« auf<br />
deutsch und türkisch teilen wir den Bewohnern mit, welche Möglichkeiten<br />
bestehen, verschiedene Altstoffe umweltschonend zu beseitigen.<br />
Das Informationsblatt wird gerade verteilt, über die Resonanz können<br />
wir z. Z. noch keine Aussagen machen (Abb. 1).<br />
Über die getrennte Sammlung von Altglas und Altpapier hinaus<br />
wollen wir in Zusammenarbeit mit der Privatfirma an einem zentralen<br />
Punkt einen Recyclingladen einrichten, in dem der Bevölkerung bestimmte<br />
Abfallstoffe abgekauft werden. Die Altstoffe sind zum Beispiel<br />
ganze Flaschen, EDV-Papier, Aluminium und sonstige Metalle, Kunststoffe<br />
und Textilien. Damit können wir auch untersuchen, ob durch die<br />
Vergütung der Altstoffabgabe die Motivation der Bevölkerung, Abfälle<br />
getrennt zu sammeln, erhöht werden kann.<br />
Ein weiterer Einsatz in der Richtung dezentrale Erfassung von Wertstoffen<br />
ist der von der Berliner <strong>Stadt</strong>reinigung (BSR) betriebene Recyclinghof<br />
am Paul-Lincke-Ufer, wo die Bevölkerung unentgeltlich Glas,<br />
Papier, Batterien, Holz, Kunststoffe, Metalle und Altöl abgeben kann.<br />
Kleinchemikalien wie Lacke, Lösungsmittel, Farben, Altchemikalien<br />
und Altmedikamente können auf dem Recyclinghof der BSR an bestimmten<br />
Tagen abgegeben werden. Altmedikamente werden in Apotheken<br />
zurückgenommen.<br />
139
Abb. 1: Wohin mit dem Müll?<br />
140
Um die Kompostierung und die Verwendung des Komposts für die<br />
Hofbegrünung wollen wir uns besonders intensiv kümmern. Die Kompostierung<br />
erfolgt in dreiteiligen Kästen, die von uns in Zusammenarbeit<br />
mit den Mietern gebaut wurden.<br />
Die wissenschaftliche Auswertung des Versuchs umfaßt:<br />
• die Sortierung mehrerer Stichproben der Werkstoff-Fraktionen und<br />
des Restmülls zur Überprüfung von Akzeptanz, Reinheitsgrad und<br />
Erfassungsgrad;<br />
• Kleinanalyse des Kompostes, wie Bestimmung von Wassergehalt *<br />
Glühverlust, Temperatur, pH-Wert und Reifegrad;<br />
• und die Auswertung der Daten über die erfaßten Wertstoff- und<br />
Restmüllmengen sowie Kleinchemikalien und Altmedikamente.<br />
(Die Daten der Restmüllmengen müssen sich aus Kostengründen auf<br />
Stichprobenverwiegungen beschränken.)<br />
Die einjährige Untersuchung, mit dem Ziel der flächendeckenden getrennten<br />
Sammlung, wird zeigen, inwieweit eine Strategie der »behutsamen«<br />
Einführung von Recyclingmaßnahmen in einem dichtbesiedelten<br />
<strong>Stadt</strong>gebiet überhaupt möglich ist.<br />
141
Günter Axt<br />
Wassersparende Maßnahmen im<br />
Haushaltsbereich<br />
Wasser ist eigentlich kein knappes Gut, jedenfalls nicht in Deutschland,<br />
auch nicht in Berlin. Wir beziehen es aus dem Wasserkreislauf der Natur<br />
und geben es in diesen Kreislauf zurück. Das könnte so weitergehen,<br />
solange die Sonne die Erde bescheint, wenn der zivilisierte Mensch es<br />
nicht verstanden hätte, diesen Kreislauf zu stören. Wir tun dies u.a.<br />
dadurch, daß wir große Mengen Grundwasser entnehmen und es - mehr<br />
oder weniger verunreinigt - den Flüssen zuschlagen. Dies geschieht<br />
mitunter, gerade in Berlin, in so großem Ausmaß, daß die Oberfläche<br />
des Grundwassers noch unter die Oberfläche der Flüsse und Seen<br />
absinkt. Dadurch sickert das Grundwasser nicht, wie die Natur es<br />
vorgesehen hat, zu diesen Flüssen und Seen, sondern es gelangt, umgekehrt,<br />
Fluß- und Seewasser in das Grundwasser. Daß dies in Anbetracht<br />
des Zustandes unserer Flüsse und Seen auf die Dauer nicht gut sein<br />
kann, liegt auf der Hand.<br />
Es gibt also gute Gründe, mit Grundwasser sparsam umzugehen.<br />
Abgesehen von der Änderung unserer zum Teil verschwenderischen<br />
Verbrauchsgewohnheiten liegt es nahe, das kostbare Wasser mehrfach<br />
zu nutzen, bevor es zu Abwasser wird. So ist vor allem zur Toilettenspülung<br />
kein Frischwasser notwendig, sondern es kann bereits benutztes<br />
Wasser, z.B. Waschwasser, dazu verwendet werden. Dies bedeutet<br />
keinen Nachteil für den Benutzer.!<br />
Auch die Mitverwendung von Regenwasser ist in diesem Sinne eine<br />
wassersparende Maßnahme, zumal Regenwasser, sofern es auf die<br />
Hausdächer fällt, in der Regel (mit Ausnahmen) nicht dem Grundwasser,<br />
sondern dem Flußwasser zugeführt wird. Dabei ist Regenwasser<br />
trotz seiner erheblichen Verunreinigungen noch immer gut zum Wäschewaschen<br />
geeignet, da es sehr.weich ist und keine härtebindenden<br />
Chemikalien benötigt. Auch der Waschmittelverbrauch ist geringer als<br />
bei kostbarem Trinkwasser.<br />
Die Abb. 1 und 2 veranschaulichen den Einspareffekt, der auf diese<br />
Art erzielbar ist. Die Zahlen bedeuten den durchschnittlichen Tagesverbrauch<br />
eines städtischen Einwohners, aufgeschlüsselt in die wichtigsten<br />
Verwendungszwecke, wie sie durch Kennbilder dargestellt sind.<br />
142
T\ Das Rohwasser wird in der Regel dem Grundwasser entnommen<br />
Folge: ökologisch nachteilige Grundwasserabsenkungen<br />
(§) Aufbereitung in zentralen Wasserwerken auf Trinkwasserqualität<br />
© Leitungssystem, ausgelegt für alle Verbrauche nebeneinander<br />
/•», fü> die meisten Verwendungszwecke wäre Trinkwasserqualität<br />
^ eigentlich nicht notwendig<br />
© Kanalisationssystem, für alle Verbrauche nebeneinander ausgelegt<br />
(£) entsprechend ausgelegtes Klärwerk<br />
© Belastung der Flüsse durch Abwasser und Regenwasser<br />
Abb. 1: Übliche Wasserversorgung von Haushaltungen (Zahlenangaben in Liter<br />
pro Einwohner und Tag).<br />
Ein Vergleich dieser beiden Fließbilder zeigt, daß trotz gleichbleibender<br />
Verbrauchsgewohnheiten mehr als die Hälfte Grundwasser eingespart<br />
werden kann (67 1 statt 150 1). Damit sind eine ganze Reihe von<br />
anderen Einsparungen verbunden, von kleineren Wasserwerken und<br />
kleineren Leitungen bis zu wirkungsvollerer Abwasserreinigung.<br />
Für Einfamilienhäuser gibt es bereits Einrichtungen zur praktischen<br />
Durchführung der genannten Maßnahmen, die relativ einfach und preiswert<br />
zu installieren sind. Abb. 3 zeigt schematisch den Aufbau. Die<br />
wesentlichsten Bestandteile sind die im Bild unten gezeichneten Speicherbehälter<br />
für Regenwasser und für »Grauwasser«.<br />
143
T\ trotz Zugrundelegung gleicher Verbrauchsmengen wird dem Qrund-<br />
^ wasser weniger als die Hälfte entnommen<br />
(§) entsprechend kleinere Wasserwerke<br />
(£) entsprechend kleinere Rohrleitungen<br />
/»' Sammlung und Nutzung des Uach-Regenwassers, datjei Ausgleich<br />
^ des schwankenden Anteils<br />
/P* zum Wäschewaschen eignet sieh (weiches) Regenwasser besser<br />
^ als Trinkwasser<br />
/ä zur Toilettenspülung genügt die Qualität des gebrauchten Wasch-,<br />
^ Dusch- und Badewassers<br />
(G) kleinerer Abwasseranfall ermöglicht kleinere Abwasserkanalisation<br />
@ entsprechend kleinere Klärwerke bzw. intensivere Abwasserreinigung<br />
entsprechend geringere Belastung der Flüsse, besser* Chance zu<br />
Q) dezentraler Verwendung des gereinigten Abwassers, (evtl. Rückgabe<br />
ins Grundwasser)<br />
Abb. 2: Wassereinsparung durch Nutzung des aufgefangenen Regenwassers und<br />
Mehrfachnutzung von Brauchwässern (Zahlenangaben in Liter pro Einwohner<br />
und Tag).<br />
144
Abb. 3: Wasser-Spar-Anlage nach H. Schäfer.<br />
Das vom Dach abfließende Regenwasser wird bei (1) vom Fallrohr<br />
abgezweigt und dabei gleichzeitig von groben Beimengungen (z.B.<br />
Blättern) befreit. Dies geschieht einfach dadurch, daß ein Ringspalt nur<br />
das ganz außen am Fallrohr ablaufende Wasser erfaßt, während Grobteile<br />
innen vorbeigleiten. Bei dieser sehr einfachen Maßnahme wird in<br />
Kauf genommen, daß bei (nur selten vorkommenden) sehr heftigen<br />
Regenfällen auch ein Teil des Wassers nicht durch den Ringspalt gelangt<br />
und somit verlorengeht.<br />
Durch einen kleinen Filter (2) gelangt das abgezweigte Wasser in den<br />
Speicherbehälter. Er ist zweckmäßig so bemessen, daß er auch bei<br />
starken Regenfällen nicht gleich überläuft, und daß er eine Reserve für<br />
regenfreie Tage und Wochen darstellt. Mit einem Volumen von etwa<br />
1 m 3 pro Person sind diese Bedingungen schon recht gut erfüllt. Notfalls<br />
genügt auch die Hälfte.<br />
Aus dem Regenwasserbehälter wird vorwiegend Wasser zum Wäschewaschen,<br />
aber auch (sofern es die hygienischen Bedingungen erlauben)<br />
zum Baden und Duschen und evtl. Hausreinigungen verwendet, nicht<br />
jedoch zum Trinken, Kochen, Geschirrspülen usw., wofür weiterhin<br />
zentral geliefertes Leitungswasser notwendig ist. Sofern der Speicherbehälter<br />
tiefer steht als die Waschmaschine (z.B. im Keller eines Einfamilienhauses)<br />
, wird der Wassertransport durch eine kleine Tauchpumpe (4)<br />
besorgt, die sich durch einen Druckschalter (5) immer dann selbständig<br />
einschaltet, wenn Wasser entnommen wird. Der Energiebedarf dieser<br />
145
Pumpe ist mit etwa 0,02-0,05 kWh/m 3 etwa fünf- bis zehnmal kleiner als<br />
der Anteil an der Pumpenergie der Wasserwerke, wenn die gleiche<br />
Wassermenge aus dem Leitungsnetz entnommen würde.<br />
Das aus der Waschmaschine (und evtl. Badewanne usw.) abfließende<br />
Wasser ist noch kein Abwasser, sondern verwertbares »Grauwasser«, da<br />
es nur wenig Schmutz, dafür aber eine ganze Menge Wärme enthält. Es<br />
wird in einem weiteren Speicherbehälter gesammelt, um schließlich zum<br />
Spülen der Toilette benutzt zu werden. Dabei geht die Wärme des<br />
Grauwassers auf jeden Fall nicht ganz verloren, da sie an den Aufstellungsraum<br />
des Behälters abgegeben wird. Sie kann aber auch noch<br />
besser genutzt werden, wenn durch geeignete Einlaufvorrichtungen das<br />
warme (bzw. heiße) Wasser oben gehalten wird, wo es über eine<br />
Rohrschlange (3) das zum Gebrauch durchlaufende Regenwasser vorwärmt.<br />
Das Toilettenspülwasser wird unten im Behälter entnommen (evtl.<br />
wieder mit Hilfe einer selbstschaltenden Tauchpumpe) und ist daher auf<br />
jeden Fall nicht mehr heiß. Bei der Verwendung von Grauwasser für<br />
diesen »letzten Zweck« haben sich bisher keinerlei Nachteile gegenüber<br />
reinem Leitungswasser gezeigt. Die im Grauwasser vorhandenen<br />
Waschmittel verstärken offenbar sogar den Reinigungseffekt im Toilettenbecken.<br />
Bei der Benutzung solcher Anlagen muß natürlich gewährleistet sein,<br />
daß das Wasser nicht getrunken wird. Schon das Regenwasser enthält<br />
viele Keime (vor allem Bakterien) verschiedener Art, und das Grauwasser<br />
ist erst recht alles andere als hygienisch einwandfrei. Zum Toilettenspülen<br />
ist dies aber auch nicht notwendig. Es muß nur durch geeignete<br />
Installationsmaßnahmen gewährleistet sein, daß dieses Wasser nicht<br />
anderweitig (vor allem eben nicht zum Trinken) entnommen werden<br />
kann.<br />
Auch beim Regenwasser läßt sich eine solche Sicherung durch Installationsmaßnahmen<br />
erreichen, indem z.B. eine feste Verbindungsleitung<br />
vom Sammelbehälter zur Waschmaschine gelegt wird. Auf die Nutzung<br />
des Regenwassers zum Baden und Duschen müßte bei hygienischen<br />
Bedenken u.U. verzichtet werden. Die ganze Anlage ist ja ohnehin als<br />
Zusatzeinrichtung gedacht, die die normale Trinkwasserleitung zwar<br />
erheblich entlasten, aber nicht ersetzen soll.<br />
146
Peter Thomas<br />
Neue Sanitärund<br />
Wasserrecyclingtechniken<br />
in IBA-Projekten<br />
Nach Auskunft der Berliner Wasserwerke beträgt der durchschnittliche<br />
tägliche Wasserverbrauch z. Z. 150 bis 200 Liter pro Person. In Altbauten<br />
liegt er bei der Hälfte bis zu einem Drittel der Verbrauchswerte von<br />
Neubauten bzw. modernisierten Altbauten. Dies bedeutet für ein Sanierungsgebiet,<br />
wie beispielsweise das Gebiet um das Kottbusser Tor, daß<br />
eine konventionelle Sanierung der Sanitäranlagen, insbesondere der<br />
Einbau von Innentoiletten, Bädern und die Modernisierung der Küchen<br />
zu einer Steigerung des Trinkwasserverbrauchs um das Zwei- bis Dreifache<br />
führt. Gleichzeitig erhöht sich aber auch die Menge des Abwassers<br />
um den gleichen Anteil.<br />
Längerfristig wird durch eine konventionelle Sanierung der Sanitäranlagen<br />
in den Berliner Altbaugebieten und die Erweiterung der Neubautätigkeit<br />
im Rahmen der IBA die Erschließung neuer Grundwasserreservoire,<br />
der Bau zusätzlicher Kläranlagen und, damit einhergehend,<br />
der Verlust weiterer Erholungsflächen unausweichlich sein.<br />
Ein zweiter Grund zum Wasser- und Energiesparen ist nicht minder<br />
wichtig. Es geht darum, die von den Mietern zu tragenden Bewirtschaftungskosten<br />
niedrig zu halten.<br />
Moderne Sanitärtechniken bieten eine Reihe von Möglichkeiten, in<br />
beträchtlichem Umfang Trinkwasser, Abwasser und letztlich auch Energie<br />
zu sparen. Durch die konsequente Auswahl von Waschtisch-, Spültisch-<br />
und Brausearmaturen, aber auch durch den Einbau spezieller<br />
WC-Einrichtungen läßt sich der Wasserverbrauch auf unter 100 Liter<br />
pro Person beschränken, ohne daß die Hygiene zu kurz kommt bzw. die<br />
Nutzer ihr Verhalten ändern müßten. Die im folgenden vorgeschlagenen<br />
Standardmaßnahmen lassen sich unmittelbar in fast allen Bauvorhaben<br />
(zum Teil sogar nachträglich) realisieren. Die Experimentalprojekte hingegen<br />
hängen im wesentlichen von den örtlichen Gegebenheiten und der<br />
Bereitschaft der Planer und Nutzer ab, sich auf gewisse Risiken oder<br />
Mehrarbeit einzulassen.<br />
147
Standardmaßnahmen*<br />
Trinkwassereinsparung bei Wasserentnahmearmaturen<br />
Niemand kann sich waschen oder duschen, ohne sich naß zu machen.<br />
Aber ob der Trinkwasserverbrauch dabei hoch oder niedrig ist, das steht<br />
auf einem anderen Blatt. Die Auswahl der Sanitärausstattung, das sind<br />
primär Objekte und Wasserentnahmearmäturen, wird leider immer<br />
noch in der Mehrzahl der Fälle durch den Anschaffungspreis vorgegeben.<br />
In zweiter Linie ist dann das Design ausschlaggebend, während die<br />
hydraulische Funktion einer Entnahmearmatur meist nicht gesondert<br />
berücksichtigt wird.<br />
Die Beurteilung der hydraulischen Eigenschaften von Wasserentnahmearmaturen<br />
können aber auch selbst Experten nur schwer vornehmen,<br />
wenn sie sich ausschließlich auf die Herstellerangaben verlassen. Einige<br />
Armaturenhersteller sind auch wenig mitteilsam, wenn es um die exakten<br />
hydraulischen Eigenschaften der Entnahmearmaturen geht.<br />
Allen unterschiedlichen Darstellungen ist jedoch ein druckabhängiges<br />
Ausflußverhalten gemeinsam. Unter den spezifischen Druckverhältnissen<br />
in einem Altberliner Wohnhaus fließen aus der gleichen Armatur im<br />
Erdgeschoß 16,2 Liter pro Minute, während im 4. Obergeschoß nur 10,9<br />
Liter pro Minute ausfließen. Unter der Voraussetzung, daß die ausfließende<br />
Wassermenge der im 4. Obergeschoß installierten Armatur zufriedenstellend<br />
ihren Zweck erfüllt, kann die Differenz der Volumenströme<br />
aufgrund der unterschiedlichen geodätischen Höhen als Wasserverlust<br />
bezeichnet werden.<br />
Ein nicht unerhebliches Potential zum Wassersparen ergibt sich daher<br />
bereits bei der Auswahl der Entnahmearmaturen. Unter hydraulischen<br />
Gesichtspunkten sollten dabei jene Armaturen ausgewählt werden, die<br />
einerseits bei einem geringen Armaturenausfluß ihren Zweck erfüllen<br />
und andererseits durch ihre möglichst steile Kennlinie charakterisiert<br />
sind. In der Mehrzahl der Fälle wird dies nicht immer gelingen. Einen<br />
Ausweg bieten jedoch Zusatzeinrichtungen wie beispielsweise der<br />
Durchflußbegrenzer.<br />
• Durchflußbegrenzer<br />
Die einfachste und zugleich billigste Möglichkeit der Einsparung von<br />
Die als »Standardmaßnahmen« bezeichneten Techniken wurden für das Bauvorhaben<br />
Oranienstraße 4 geplant und berechnet. Die Sanitärinstallation innerhalb des Gebäudes ist<br />
noch nicht ganz abgeschlossen. Meine Angaben über spezifische Einsparungen an Wasser<br />
und Energie beruhen daher auf rechnerischen Werten. Es ist geplant, im Frühjahr 1984 mit<br />
einem umfangreichen Meßprogramm zu beginnen, das den tatsächlichen Wasser- und<br />
Energieverbrauch dokumentiert und einen Vergleich mit den rechnerischen Werten ermöglicht.<br />
148
Wasser (Trink- und Schmutzwasser) und Energie ist der Durchflußbegrenzer,<br />
der, beispielsweise bei einer Waschtischarmatur, zwischen<br />
Auslauf und Luftsprudler geschraubt wird.<br />
Mit Hilfe dieses Durchflußbegrenzers wird, wie die Bezeichnung<br />
schon vermuten läßt, der Durchfluß der jeweiligen Armatur ab<br />
einem bestimmten Mindestfließdruck druckunabhängig. Dadurch<br />
hat man ohne individuelle Verregelung und unabhängig von der<br />
geodätischen Höhe einen konstanten Durchfluß an der Entnahmestelle.<br />
Konstruktiv wird dies mittels einer vom Fließdruck betätigten<br />
Drossel verwirklicht, die den freien Querschnitt mit zunehmendem<br />
Druck verringert. Ab ca. 1,5 bar Fließdruck ist der Durchfluß nahezu<br />
konstant. Unterhalb dieses Druckes kommt das normale Strömungsverhalten<br />
der Armatur zum Tragen.<br />
Bezogen auf die hydraulischen Verhältnisse in dem Haus Oranienstraße<br />
4, beträgt die Einsparung gegenüber einer serienmäßigen<br />
Zweigriff-Waschbeckenarmatur bei Verwendung eines Durchflußbegrenzers<br />
- eingestellt auf 8 Liter pro Minute - im Erdgeschoß 8,2<br />
Liter pro Minute.<br />
Bei täglich viermaligem Waschen von jeweils einer Minute Dauer<br />
führt die Installation des Durchflußbegrenzers zu einer Einsparung<br />
allein an Wasser und Abwasser von 32,8 Liter pro Person und Tag.<br />
Bei einer Wassergebühr in Berlin von derzeit DM 0,71 und einer<br />
Abwassergebühr von DM 1,27 ergibt sich im Monat eine Einsparung<br />
der Bewirtschaftungskosten bezogen auf eine einzelne Person um<br />
DM 1,94 alleine durch den reduzierten Verbrauch am Waschbecken.<br />
Hinzu kommen noch die Energiekosten für die Warmwasserbereitung<br />
in Höhe von DM 2,80 je Kubikmeter erwärmten Trinkwassers.<br />
Im Monat werden, bedingt durch den geringeren Wasserverbrauch,<br />
zusätzlich Energiekosten in Höhe von DM 2,74 eingespart.<br />
Zusammen ergibt das eine monatliche Einsparung der Bewirtschaftungskosten<br />
von DM 4,68 pro Person.<br />
Auch an der Spüle ist ein überhöhter und daher nicht ausreichend<br />
zu nutzender Armaturenausfluß ebenfalls als Wasser- und Energieverlust<br />
zu deklarieren. Jedoch muß hier berücksichtigt werden, daß<br />
das Spülbecken (Nutzinhalt 8 bis 10 Liter) in einer »angemessenen«<br />
Zeit gefüllt wird. Eine Füllzeit von etwa einer Minute gilt allgemein<br />
als zumutbar. Der Durchflußbegrenzer an der Spüle sollte daher auf<br />
keinen geringeren Durchfluß als 8 Liter pro Minute eingestellt sein.<br />
Die Einsparungsberechnungen sind daher für die Spültischarmatur<br />
auch relativ ungenau. Sie hängen insbesondere von dem individuellen<br />
Benutzungsverhalten der Bewohner ab. Da die verwendeten<br />
Spültischarmaturen baugleich mit den Waschbeckenarmaturen sind<br />
und auch der gleiche Durchflußbegrenzer installiert wurde, reduziert<br />
149
150<br />
sich die Einsparung an der Spüle auf etwa 50 % der für die Waschbekkenarmatur<br />
ermittelten Werte. In Geldeinheiten ausgedrückt, sind<br />
das Einsparungen an Wasser und Energie in Höhe von DM 2,34 pro<br />
Person und Monat.<br />
Das Duschen und Brausen erfolgt unter einem fließenden Wasserstrahl.<br />
Die durchschnittliche Duschdauer beträgt 6 Minuten. Die<br />
Diskussion in der Hausgemeinschaft, ob eventuell Selbstschlußarmaturen<br />
als Brausearmaturen eingebaut werden sollen, die während des<br />
Einseifens den Wasserstrahl jeweils unterbrechen, wurde mit dem<br />
Hinweis auf deutliche Komforteinbußen abschlägig entschieden.<br />
Letztlich wurden normale Brausebatterien mit Handbrausen installiert,<br />
die zusätzlich mit einem Durchflußbegrenzer - eingestellt auf 9<br />
Liter pro Minute -. ausgestattet wurden. Die Brausebatterie hat<br />
zusammen mit der Handbrause bei einem Vordruck von 3,8 bar einen<br />
Armaturenausfluß von 27,5 Liter pro Minute. Pro Person werden<br />
folglich bei jedem Duschgang insgesamt 18,5 mal 6 = 111 Liter<br />
Wasser eingespart. Unter der Voraussetzung, daß jeder Bewohner<br />
täglich einmal duscht, reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten für<br />
einen einzelnen Bewohner um weitere DM 15,77 monatlich.<br />
Rechnet man die Ersparnis durch die Installation von 3 Durchflußbegrenzern<br />
je Wohneinheit zusammen, so ergibt sich eine Summe<br />
von DM 22,79 monatlich, die das Budget jedes einzelnen Bewohners<br />
Monat für Monat entlasten. Diesen monatlichen Sparbeträgen stehen<br />
einmalige Investitionskosten für die 3 Durchflußbegrenzer von<br />
zusammen DM 30 (inkl. MwSt.) gegenüber, so daß sich die Kosten<br />
bereits in 40 Tagen amortisieren.<br />
Tiefspülkästen mit Spül- und Stopp-Taste<br />
Geradezu als Wasserverschwender par excellence sind die Tiefspülkästen<br />
in den bundesrepublikanischen Haushalten seit gut 3<br />
Jahren ins Gerede gekommen.<br />
Nach der DIN 19542 fließen bei jedem Spülvorgang mindestens<br />
neun Liter Wasser in den Abfluß, auch wenn nur eine Zigarettenkippe<br />
in die Kloschüssel geworfen wurde. Es ist daher verständlich,<br />
daß sich immer mehr Menschen Gedanken gemacht haben, wie man<br />
beim Spülkasten Wasser sparen kann. Der älteste und einfachste<br />
Vorschlag ist der Trick mit dem Ziegelstein, wobei die verdrängte<br />
Wassermenge der Einsparung entspricht. Weitergehende »Innovationen«,<br />
wie z. B. die Ideen mit demDraht oder Splint, zielen darauf ab,<br />
einen bereits eingeleiteten Spülvorgang bei Bedarf wieder zu unterbrechen,<br />
beispielsweise beim »kleinen Geschäft«.<br />
Auch wenn dadurch noch so viel Wasser gespart wird und diese<br />
sowie auch diverse andere Konstruktionen weit verbreitet sind, so<br />
waren bis Ende vergangenen Jahres derartige Manipulationen am
Spülkasten grundsätzlich nicht statthaft, und man riskierte - allen<br />
Ernstes - ein Bußgeld, im Extremfall bis zu DM 50000. Im November<br />
1982 hat das baden-württembergische Innenministerium die Unterbrechbarkeit<br />
bei Tiefspülkästen erlaubt, wenn auch zunächst befristet<br />
bis zum Erscheinen der Neuausgabe der DIN 19542. Alle<br />
führenden Hersteller von Tiefspülkästen bieten mittlerweile ihre<br />
Spülkästen mit Unterbrechungsmöglichkeit bundesweit an.<br />
So berechtigt die Forderung nach einer Reduzierung der Spülwassermenge<br />
auch sein mag, so ist jedoch bei der Auswahl eines Klosettkörpers<br />
die Kenntnis über dessen hydraulische Eigenschaften unerläßlich.<br />
Es kann sonst vorkommen, daß mit einer Spülwassermenge von nur 2<br />
bis 3 Litern die gesamte Klosettschüssel nicht ausreichend gespült und<br />
das Sperrwasser im Geruch Verschluß nicht erneuert wird.<br />
Zur Zeit ist aber auch selbst bei der Auswahl der Spülkästen, die<br />
mittlerweile mit »Unterbrecher«, »Spül- und Stopp-Taste«, »Aquastopp-Spartaste«<br />
oder welchen werbewirksamen Namen sich die<br />
Experten auch immer ausgedacht haben mögen, ausgestattet sind,<br />
eine gewisse Vorsicht angebracht. Es gibt darunter einige Modelle,<br />
bei denen der Spülkasten, beispielsweise nach einer Sparspülung von<br />
nur 2 Litern, nicht wieder aufgefüllt wird. Die für das Aus- und<br />
Fortspülen der Fäkalien erforderliche Wassermenge reicht dann oftmals<br />
nicht aus...<br />
Pro Person wird die Toilette im Durchschnitt fünf- bis sechsmal<br />
täglich aufgesucht. Da aber meist nur bei einer Spülung eine Gesamtspülwassermenge<br />
von 9 Litern erforderlich ist, sind täglich vier sog.<br />
Sparspülungen mit jeweils 3 bis 4 Liter (statt 9 Liter) Wasser möglich.<br />
Pro Spülvorgang werden mindestens 5 Liter Wasser gespart; täglich<br />
also 20 Liter pro Person. An Wasser und Abwassergebühren werden<br />
somit weitere DM 1,19 pro Person und Monat gespart.<br />
Der Einbau von Spülkästen mit Spül- und Stopp-Taste ist bei einer<br />
Neuinstallation nicht kostenwirksam, lediglich das nachträgliche<br />
Umrüsten von bestehenden Tiefspülkästen ist mit Kosten in Höhe<br />
von DM 10 (incl. MwSt.) verbunden.<br />
Wassersparende Klosettkombinationen<br />
Neben der Unterbrechbarkeit werden im Ausland schon seit Jahren<br />
Klosettkombinationen (Klosettkörper mit aufgesetztem Spülkasten)<br />
installiert, die weniger als 9 Liter Wasser verbrauchen. Bei diesen<br />
Konstruktionen treten die oben dargestellten Nachteile einer Unterbrechung<br />
des Spülstromes nicht auf.<br />
Die Firma SPHINX bietet seit über drei Jahren Klosettkombinationen<br />
in Deutschland an, die mit nur 6 Liter Gesamtspülwassermenge<br />
auskommen.<br />
Mit nur 3 Liter spült das WC von GUSTAVSBERGS, einem<br />
151
schwedischen Hersteller. Das baugleiche Modell hat jedoch in der<br />
Bundesrepublik nur eine Zulassung für 4 Liter. Zudem darf dieses<br />
Klosett nur über einen Saugheber an die kommunale Kanalisation<br />
angeschlossen werden. Dadurch wird sichergestellt, daß die Fäkalien<br />
immer mit 20 Liter durch den Kanal gespült werden.<br />
Installation von getrennten Falleitungen für Fäkal- und Grauwasser zur<br />
Wärmerückgewinnung<br />
Die Energiekosten für die zentrale Warmwasserbereitung schlagen trotz<br />
der Realisierung der weiter oben beschriebenen Wassersparmaßnahmen<br />
immer noch erheblich zu Buche. Daneben ist es nur schwer einzusehen,<br />
daß beispielsweise das Duschwasser mit fast derselben Temperatur, mit<br />
der es aus der Brausebatterie kommt, aus dem Haus heraus in die<br />
städtische Kanalisation fließt. Unter energetischen Gesichtspunkten ist<br />
es sicher sinnvoll, einen Teil dieser im Abwasser enthaltenen Energie<br />
wieder zurückzugewinnen.<br />
Die erste Voraussetzung zur direkten Wärmerückgewinnung aus dem<br />
Abwasser ist die getrennte Ableitung des Fäkalwassers einerseits und<br />
des sog. Grauwassers andererseits. An die Grauwasser-Falleitung sind<br />
angeschlossen: Badewannen, Brausewannen, Waschbecken, Waschmaschinen<br />
und Spülmaschinen. Die Spülbecken selbst sind wegen des<br />
hohen Fett- und Feststoffanteils zusammen mit den Toiletten an die<br />
Fäkal-Falleitung angeschlossen.<br />
Insgesamt wurden in den Bauvorhaben 3 Grauwasser-Falleitungen<br />
mit der Nennweite 70 mm installiert. Als Werkstoff wurde PE-Rohr<br />
verwendet und zusätzlich mit 30 mm Mineralwolle gedämmt. Die Grauwasser-Falleitungen<br />
wurden im Keller zusammengeführt und enden in<br />
einem 1000 Liter großen Kunststoffe-Wärmespeicher. Bei der Ermittlung<br />
des Speichervolumens sind wir von einer Aufenthaltszeit des Grauwassers<br />
von ca. einem dreiviertel bis ganzen Tag ausgegangen. Das<br />
nachfließende Grauwasser verdrängt eine entsprechende Menge Abwasser<br />
aus dem Speicher, das in die städtische Kanalisation fließt.<br />
In dem Speichef befindet sich eine relativ große Heizspirale, durch die<br />
zunächst kaltes' (ca. 10 Grad) Trinkwasser fließt, das sich aber langsam<br />
auf ca. 25 Grad erwärmt. Dieses vorgewärmte Wasser wird anschließend<br />
in konventionellen gasbefeuerten Standspeichern auf ca. 55 Grad erhitzt.<br />
Die Energieersparnis liegt rein rechnerisch bei rund 30 Prozent. Der<br />
exakte Nachweis über die tatsächliche Energieeinsparung dokumentiert<br />
ein im Frühjahr 1984 von der IBA finanzierten Meßprogramm.<br />
152
Installation des Rohr-in-Rohr-Systems<br />
Die Grundüberlegung, die uns zu diesem, wenn auch nicht mehr ganz<br />
neuen Installationssystem geführt hat, war der Gedanke: wenn man<br />
schon einmal das Grauwasser gespeichert hat, dann sollte es doch<br />
möglich sein, dieses Wasser direkt - oder auch gereinigt - zumindest für<br />
die Toilettenspülung wieder zu verwenden.<br />
Neben der Forderung nach einem korrosionsbeständigen Rohrsystem<br />
stellt sich dabei aber auch die Frage der Installationstechnik an sich.<br />
Bisher werden die Trinkwasserleitungen in der Regel mit verzinktem<br />
Eisenrohr oder in Kupferrohr verlegt. Bei diesen metallischen Werkstoffen<br />
werden die einzelnen Rohrstücke mit Fittings miteinander verbunden<br />
und auch verzweigt.<br />
Kernstück des Rohr-in-Rohr-Systems ist dagegen ein wasserführendes<br />
Polyäthylenrohr, das ähnlich einem Elektrokabel in einem Schutzrohr<br />
verlegt wird. Das Rohr ist außerordentlich flexibel, völlig korrosionsfest<br />
und verrottungssicher. Aber auch bei der Leitungsführung hat man neue<br />
Prinzipien gewählt: wie bei einer Elektroinstallation wird das Rohr von<br />
einer zentralen Stelle (Verteiler) aus, jeweils als einzelne Leitung, ohne<br />
Abzweigung, bis hin zur Zapfstelle geführt. Dadurch ist es möglich,<br />
beispielsweise bei einer mechanischen Beschädigung, das Innenrohr<br />
einfach auszutauschen, ohne daß Fliesen aufgestemmt oder andere<br />
Eingriffe in den Baukörper erfolgen müßten.<br />
Ebenso kann aber auch eine Umstellung der Versorgung einer einzelnen<br />
Zapfstelle - in unserem Fall: der Toilettenspülkasten - mit einer<br />
anderen Wasserqualität ohne zusätzlichen Installationsaufwand nachträglich<br />
realisiert werden. Bisher wurde in den Bauvorhaben zusätzlich<br />
ein Leerrohr von Stockwerksverteiler zu Stockwerks Verteiler verlegt,<br />
durch das später ein Kunststoffrohr für speziell aufbereitetes Toilettenspülwasser<br />
gezogen wird.<br />
Wenn auch gegenwärtig in der Bundesrepublik noch keine Vorschriften,<br />
Richtlinien oder Empfehlungen über Qualitätsanforderungen an<br />
Toilettenspülwasser bestehen, so werden wir dennoch die Versorgung<br />
der Toiletten mit aufbereitetem Grauwasser erst dann vornehmen, wenn<br />
die Reinigungsleistung der noch zu bauenden »Binsenkläranlage« zufriedenstellende<br />
Meßwerte ergibt.<br />
Bei der Erneuerung der Trinkwasserinstallation haben wir uns durch<br />
die Verwendung des Rohr-in-Rohr-Systems die Option offengehalten<br />
für eine Versorgung mit Wasser unterschiedlicher Qualitäten.<br />
153
Experimentelle Projekte<br />
Die bisher im IBA-Gebiet geplanten und bereits realisierten Wasserprojekte<br />
verdanken ihre Existenz weniger den Experten als den Nutzern.<br />
Meist sind es die Bewohner, die bei der Instandsetzung der Sanitäranlagen<br />
bestimmte (ökologische) Standards fordern, wie z.B. wassersparende<br />
und energiesparende Einrichtungen zur Reduzierung der<br />
Bewirtschaftungskosten; manchmal ergibt sich aus der Bausubstanz<br />
ein bestimmtes Anforderungsprofil, wie beispielsweise in der »Backsteinfabrik«,<br />
wo der ehemalige Speisewasserbehälter als Brauchwasserspeicher<br />
oder evtl. sogar als Fischzuchtbecken umfunktioniert werden<br />
soll.<br />
Hier wird die Aufbereitung und Speicherung von Regen- und Grauwasser<br />
in einem bestehenden Hochbehälter zur Versorgung eines Wohnund<br />
Gewerbekomplexes mit Brauchwasser genutzt. Der genietete<br />
Stahltank-mit über 40 m 3 Inhalt (der früher als Speisewasserbehälter für<br />
den Dampfkessel gedient hat) befindet sich im 4. Obergeschoß, 17 m<br />
über dem Hofniveau. In den Geschossen unterhalb des Tanks werden 3<br />
Sanitäreinheiten installiert.<br />
Geplant ist, das Grauwasser in einer separaten Falleitung abzuleiten<br />
und einer Pflanzenkläranlage zuzuführen. Dort wird auch gleichzeitig<br />
das Oberflächenwasser von den Hofflächen und das überschüssige Regenwasser<br />
gereinigt. Eine Pumpe fördert das aufbereitete Wasser in den<br />
Hochbehälter.<br />
Der überwiegende Teil des Brauchwassers, beispielsweise für die<br />
Toilettenspülkästen, fließt den jeweiligen Sanitärobjekten direkt zu; nur<br />
ein geringer Teil soll für das Bewässern des Grasdaches im Sommer<br />
dienen und muß dazu auf dessen Niveau gepumpt werden.<br />
Mittlerweile existiert ein Vorentwurf, der davon ausgeht, das Dach<br />
über den Tank zu öffnen, einen Teil des Behälters für die Kläranlage<br />
abzuteilen und nur das restliche Volumen als Zwischenspeicher zu<br />
verwenden. Sollte dieses Konzept realisiert werden, bestünde die Möglichkeit,<br />
zusätzlich Fische einzusetzen.<br />
Ein weiteres interessantes Projekt zur Reinigung und Sammlung des<br />
Oberflächenwassers zur Grundwasseranreicherung ist für die Oranienstraße<br />
196-204 bzw. den Block 104 geplant.<br />
Heute wird fast das gesamte Niederschlagswasser von den befestigten<br />
Flächen (Dach-, Hof- und Straßenflächen) eines <strong>Stadt</strong>gebietes über das<br />
Kanalisationssystem mehr oder weniger direkt dem Vorfluter zugeleitet.<br />
Dadurch wird aus dem Regenwasser unmittelbar Vorflutwasser. Die<br />
Versiegelung der <strong>Stadt</strong>gebiete hat aber dazu geführt, daß sich heutzutage<br />
selbst nach einem mittleren Regen eine bisher nicht gekannte Hochwasserwelle<br />
am Unterlauf der Flüsse kumuliert. Weiter hat die Versiege-<br />
154
lung der Innenstadtbereiche bewirkt, daß der Grundwasserspiegel immer<br />
tiefer absank, mit all den negativen ökologischen Folgen. Die<br />
globale Grundwasserbilanz für Berlin weist auch weiterhin ein Grundwasserdefizit<br />
von mehreren Millionen Kubikmetern auf.<br />
In dem geplanten Projekt Oranienstraße 196-204 soll der Problemstellung<br />
nun dadurch Rechnung getragen werden, daß diejenigen Dachund<br />
Hof flächen, die nicht der Oranienstraße, sondern dem Park im<br />
Blockinneren zugewandt sind, von der Kanalisation abgekoppelt werden<br />
und das Niederschlagswasser in eine im Blockinneren verlegte<br />
Regenwasserleitung eingeleitet wird.<br />
Da die Luftverschmutzung in Berlin einen Grad erreicht hat, der es<br />
erforderlich macht, das Regenwasser vor Einleitung in einen Grundwasserteich<br />
zu reinigen, soll auf einer erheblich geringeren Fläche, gegenüber<br />
der traditionellen Landbehandlung, ein Verfahren zur Abwasserreinigung<br />
in einem aktivierten Bodenkörper, einer sogenannten »Schilf-<br />
Binsen-Kläranlage«, angewandt werden. Die erfolgreiche Verwendung<br />
höherer Pflanzen zur mechanischen, chemischen und bakteriologischen<br />
Reinigung, selbst industrieller Abwässer, ist in jahrelangen Versuchen<br />
wissenschaftlich nachgewiesen worden, so daß neben der Reinigung des<br />
Regenwassers auch die Reinigung von Grauwasser möglich ist. Das<br />
Abwasser sollte nach Durchlaufen des durchwurzelten Filterkörpers<br />
zusätzlich über eine Virbela-Flowform-Wasserkaskade qualitativ aufgewertet,<br />
in einen tieferliegenden ca. 10 bis 20 qm großen Grundwasserteich<br />
gelangen. (Abb.,1)<br />
Ein Teil des gereinigten, dem Teich zufließenden Wassers kann für<br />
Gieß- und Bewässerungszwecke in den Mietergärten und dem Parkbereich<br />
verwendet werden. Auch kann in den Fällen, bei denen die<br />
Sanitärinstallation innerhalb der Wohnungen mit dem Rohr-in-Rohr-<br />
System realisiert wurde, das gereinigte Abwasser für die Toilettenspülung<br />
wiederverwendet werden.<br />
Ein derartiges Kreislaufsystem, das auf der Mehrfachnutzung von<br />
Regen- und Grauwasser basiert, ist<br />
• sparsam, da keine Rohstoffe und Fremdenergie verwendet werden,<br />
• ökologisch, da die Umwelt nicht mit Abfallstoffen belastet wird,<br />
• human, da die Mieter sich in den wohnungsnahen Gärten und im<br />
Park erholen können.<br />
Zum Schluß sei noch ein Vorhaben erwähnt, welches die Installation<br />
einer Grauwasserkaskade an einer Brandwand, die mit Limnophyten<br />
(Binsen, Schwertlilien usw.) bepflanzt wird, und Rückführung des teilgereiriigten<br />
Wassers in das Wohnhaus zur Wiederverwendung als Spülwasser<br />
für Toiletten vorsieht.<br />
Die oben beschriebene Anlage zur direkten Wärmerückgewinnung<br />
155
Abb. I: Experimentalprojekt zur Reinigung und Sammlung des Oberflachenwassers<br />
im Block 104 zur Anreicherung von Grundwasser.<br />
aus Grauwasser (- mäßig verschmutztes Abwasser aus Bade-, Brausewannen,<br />
Waschbecken, Waschmaschinen und Spülmaschinen), die rund<br />
ein Drittel der Energie für die Warmwasserbereitung zurückgewinnt,<br />
entläßt das abgekühlte Grauwasser aus dem Abwasserspeicher entweder<br />
in die städtische Kanalisation oder durch die Installation einer kleinen<br />
Abwasserpumpe in einen »aktivierten Bodenkörper«.<br />
Nachdem das Grauwasser mehrere bepflanzte Bodenkörper durchlaufen<br />
hat, kann das Wasser wieder in das Haus - Oranienstraße 204 -<br />
zurückgeführt werden.<br />
Für eine Wiederverwendung des Wassers bei der Toilettenspülung<br />
wurde bereits die Installation zweier Toiletten so weit vorbereitet, daß<br />
156
durch die Verwendung des SNIPEX-Rohr-in-Rohr-Systems eine Umstellung<br />
auf eine andere Wasserqualität ohne zusätzlichen Installationsaufwand<br />
zu realisieren ist. Die zu installierende Pumpe müßte lediglich<br />
den Druckverlust in den Rohrleitungen und den Spülkästen überwinden.<br />
157
Zwischenbilanz
Margrit <strong>Kennedy</strong><br />
<strong>Öko</strong>logisch Planen und Bauen<br />
im Rahmen der Internationalen<br />
Bauausstellung<br />
Als Ende der siebziger Jahre die 4. Bauausstellung in Berlin mit dem<br />
Schwerpunkt »die Innenstadt als Wohnort« geplant wurde, tauchte<br />
gleichzeitig mit diesem Hauptthema der Begriff »<strong>Stadt</strong>reparatur« auf.<br />
Nach einer Wiederaufbauphase, in der Planer die Innenstädte zu monofunktionalen<br />
Einkaufsghettos umfunktionierten und damit mehr zerstört<br />
hatten als der 2. Weltkrieg, sollte nun behutsam und integriert<br />
gerettet werden-, was zu retten war. <strong>Stadt</strong>repafatur bedeutet Erhaltung<br />
anstatt Vernichtung von bestehenden Ressourcen, von physisch materiellem<br />
Baubestand wie auch sozialen Strukturen. Es sollte, interpretiert<br />
man die erste Senatsvorlage richtig, im weitesten und auch im engeren<br />
Sinne »ökologisch« richtig geplant und auch gebaut werden. Man wies<br />
nicht nur auf die Bedeutung der Spontanvegetation auf den Freiflächen<br />
der ehemaligen Bahnhofsgelände in und am Rand von Gebieten der<br />
Bauausstellung hin, sondern verlangte auch eine Synthese widersprüchlicher,<br />
technischer und sozialer, öffentlicher und privater, geschichtlicher<br />
und zukünftiger Planungsanforderungen sowie ein neues Umweltbewußtsein,<br />
welches bau-technologische Entwurfsmethoden entscheidend<br />
verändern sollte.<br />
Wie diese richtigen allgemeinen Forderungen im Detail in die Praxis<br />
umgesetzt werden sollen, blieb den Planern und Architekten überlassen,<br />
die angestellt wurden, die Internationale Bauausstellung (IBA) 1984/87<br />
in die Wege zu leiten. Dabei standen die einen vor der Aufgabe, sich in<br />
die komplexen Probleme geographisch begrenzter Bereiche einzuarbeiten,<br />
die anderen, Arbeitsgrundlagen für bestimmte übergreifende Probleme,<br />
die für alle Gebiete von Bedeutung sind, zu erstellen. Zur<br />
letzteren Gruppe zählt in der Forschungsabteilung auch der Bereich<br />
<strong>Öko</strong>logie/Energie. Hier, wie auch in anderen Bereichen, stellte es sich<br />
bald heraus, daß es zwar eine große Anzahl von guten Ideen und<br />
theoretischen Forderungen gab, aber noch wenig realisierte Beispiele, an<br />
denen überprüft werden konnte, inwieweit solche Ansätze für größere<br />
Gebiete - die IBA umfaßt einen <strong>Stadt</strong>bereich mit 150000 Einwohnern -<br />
anwendbar sein würden. Wo es bauökologische Beispiele gab, waren sie<br />
161
entweder in ländlichen Gebieten oder Vorstädten angesiedelt und damit<br />
kaum auf innerstädtische Problembereiche übertragbar.<br />
Was für Einzelthemen wie <strong>Stadt</strong>klima, Grünplanung, Immissionsschutz<br />
und Abfall- und Abwasser-Recycling galt, traf natürlich für eine<br />
ökologische Synthese all dieser Einzelthemen, etwa in einem ökologischen<br />
Siedlungskonzept, erst recht zu. Die erste Aufgabe des Forschungsbereiches<br />
<strong>Öko</strong>logie/Energie war es deshalb, eine möglichst umfassende<br />
Informationsbasis und einen kontinuierlichen Dialog zwischen<br />
<strong>Öko</strong>logiefachleuten, Planern, Architekten und Betroffenen herzustellen.<br />
Das erste <strong>Öko</strong>logiesymposium im Herbst 1980, welches in Zusammenarbeit<br />
mit verschiedenen Experten aus Berlin und Westdeutschland<br />
organisiert wurde, war als Einstieg in die Problematik, als erster Überblick<br />
und Anregung gedacht. Das Hauptkriterium für die Auswahl von<br />
Themen und Referenten war, <strong>Öko</strong>logie möglichst umfassend und anwendungsbezogen<br />
darzustellen. Der Andrang zu dieser Veranstaltung,<br />
die insgesamt knapp 1000 Besucher zählte, zeigte das große Interesse<br />
der Öffentlichkeit an dem Thema und der Möglichkeit, ökologische<br />
Beispiele und Planungen in Berlin realisiert zu sehen. Viele der Beiträge<br />
in diesem Buch sind in diesem Zusammenhang entstanden oder haben<br />
wesentlich zur Erstellung von Grundlagen für ökologische Ansätze und<br />
Projekte in der IBA beigetragen.<br />
Eine einmalige Informations- und Diskussionsveranstaltung dieser<br />
Art, das zeigte sich bald immer deutlicher, reicht jedoch nicht aus, um<br />
ein Umdenken im Kreis der Planenden und der Betroffenen zu schaffen.<br />
Deshalb fanden 1980 und 1981 in der IBA monatliche »<strong>Öko</strong>lloquien«<br />
statt, in denen Fachleute, Projektbearbeiter und Betroffene, sowohl<br />
über den Fortschritt der Arbeit an einzelnen Projekten wie auch über<br />
spezielle Themen diskutierten. Diese Treffen waren für alle Interessenten<br />
offen und wurden von wechselnden Gruppierungen benutzt, um sich<br />
zu informieren oder auch bestimmte Anliegen in die Arbeit der IBA<br />
einzubringen.<br />
Die »<strong>Öko</strong>lloquien« sollten weiterhin den einzelnen Fachleuten zur<br />
Vernetzung ihres Bereiches mit den Interessen anderer Bereiche dienen.<br />
Diese Arbeit war oft schwierig, weil fachliche Konzepte und Fachsprache<br />
dem Verständnis und der interdisziplinären Zusammenarbeit im<br />
Wege stehen. Es war deshalb für das Einbringen ökologischer Gesichtspunkte<br />
in die konkrete Planung auch Übersetzungsarbeit und ein ständiges<br />
Bemühen um Zusammenarbeit erforderlich. Ein Beispiel, wo dies<br />
glückte, ist das Grünkonzept für die Südliche Friedrichstadt, welches<br />
von einem <strong>Stadt</strong>planer, einem Klimatologen und einer Grünplanerin<br />
zusammen erarbeitet wurde. Dieses Gutachten wurde im Verlauf der<br />
Planung zur Hilfestellung für die Betroffenen, die sich damit auch gegen<br />
162
eine zu einseitige Betonung von ästhetischen und geschichtlichen Prioritäten<br />
im Neubaubereich der IBA wandten (siehe Band 2).<br />
Der Stellenwert des ersten Symposiums für die Arbeit der Bäuausstellung<br />
wäre aber zweifelsohne unvollständig wiedergegeben, wenn nur die<br />
Schaffung einer breiten Informationsbasis und Arbeitsgrundlage erwähnt<br />
würde. Das wichtigste Ziel war es, konkrete Experimente anzuregen und<br />
in die Wege zu leiten, um endlich den Schritt zur Überprüfbarkeit in der<br />
Praxis zu vollziehen. Anhand verschiedener Demonstrationsprojekte soll<br />
aufgezeigt werden, wie eine ökologisch sinnvolle Belebung und Verbesserung<br />
von Berliner <strong>Stadt</strong>quartieren geschehen kann.<br />
Als ein solches Pro j ekt sei an erster Stelle die weitgehende Erhaltung der<br />
Anhalter und Potsdamer Personen- und Güterbahnhofsflächen genannt.<br />
Diesem Ziel wird inzwischen, trotz zahlreicher Widerstände, in der<br />
Planung Rechnung getragen. Hier kann die Verbindung von Natur und<br />
Bauen, von schützenswerten Landschaftsteilen und Wohnen ein innerstädtisches<br />
ökologisches Experiment ergeben, welches die Regeneration<br />
von Tier, Pflanze und Mensch in Erlebnis- und Erholungsraum verbindet.<br />
Zwei' städtische Blöcke mit ca. 300 bis 500 Wohneinheiten, der eine<br />
Block 108 im <strong>Stadt</strong>erneuerungsgebiet, der andere am Askanischen Platz in<br />
einem Neubaugebiet, sollten auf die Möglichkeiten der Vernetzung der<br />
oben genannten Einzelmaßnahmen hin untersucht werden. Beides gelang<br />
an den oben genannten Standorten aus den verschiedensten Gründen<br />
nicht, wird aber von denselben Fachleuten an anderer Stelle erprobt. Die<br />
am Block 108 geplanten Maßnahmen sollen in modifizierter Form beim<br />
Umbau der Parkgarage Dresdener Straße zu einer Kindertagesstätte<br />
Anwendung finden. Die Planung, die Frei Otto und Hermann Kendel für<br />
den Standort Askanischer Platz erstellten, soll modifiziert als Baumhaus<br />
am Tiergarten verwirklicht werden (siehe Band 2).<br />
Das »Naturhaus« für Berlin, eine Übersetzung des schwedischen<br />
Einfamilienhauses von Bengt Warne auf Berliner Verhältnisse, wurde<br />
zuerst für ein Grundstück am Fraenkelufer, dann für den Block 104 und<br />
jetzt am Moritzplatz geplant. An den beiden ersten Standorten entstehen,<br />
in dem mit Freiflächen völlig unterversorgten Gebiet, kleine,<br />
wohnungsnahe Parks. Am Moritzplatz könnte das Naturhauskonzept<br />
eine bestimmende Rolle für die Neugestaltung des gesamten <strong>Stadt</strong>platzes<br />
bekommen.<br />
Nur die »ökologischen Maßnahmen im Frauenstadtteilzentrum« haben<br />
ihren Standort in der ehemaligen Schokoladenfabrik nicht wechseln<br />
müssen. Wasser- und Energiesparmaßnahmen, die Begrünung von Höfen,<br />
Fassaden und Dächern, Dachgewächshäuser und Abfallrecycling<br />
waren dort von Anfang an Bestandteil des Konzeptes zur Verwandlung<br />
städtischen Brachlandes in eine menschenwürdige Umgebung durch die<br />
Frauengruppe »die Wüste lebt« (siehe Band 2).<br />
163
Neben diesen ökologisch integrierten Projekten, die alle auf unterschiedliche<br />
Weise einen anderen Umgang mit natürlichen Ressourcen<br />
demonstrieren, wurden vor allem für die Bereiche Grün, Abfall und<br />
Energie auch »flächendeckende« Ansätze erarbeitet.<br />
Untersuchungen der Landschaftsplanerinnen Inge Maass, Katrin Rating<br />
und Rose Fisch führten über die IBA-Gebiete hinaus zu einem für<br />
alle Berliner Bezirke offenen, vom Senat mit 2,5 Mio. DM geförderten,<br />
Hofbegrünungsprogramm.* In Verbindung mit Verkehrsberuhigungsmaßnahnien<br />
und der Neugestaltung von Straßen und Plätzen dient die<br />
Begrünung von Höfen, Fassaden und Dächern der Verbesserung des<br />
Freizeitwertes in den hochverdichteten Innenstadtgebieten.<br />
Als zweite flächendeckende Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit<br />
den Landschaftsplanern der IBA, Selbsthilfegruppen, den zuständigen<br />
Firmen sowie den Berliner <strong>Stadt</strong>reinigungsbetrieben ein Abfall-Recyclingprogramm<br />
entwickelt. Dabei soll, neben der Trennung der Fraktionen<br />
Glas und Papier, auch überprüft werden, inwieweit organische<br />
Abfälle in größeren Höfen und auf Freiflächen kompostiert werden<br />
und damit unmittelbar zur Unterstützung von Begrünungsprojekten<br />
beitragen können. Versuchsweise soll auch die Trennung von Schadstoffen<br />
(Öl, Farben, Medikamente usw.) und die Rückführung zu den<br />
entsprechenden Geschäften oder zu einer Recyclingbörse erprobt werden.<br />
Im komplexen Energiesektor haben wir uns schwerpunktmäßig mit<br />
zwei Problembereichen befaßt, einmal mit der Einführung der Fernwärme<br />
und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />
und Kreuzberg. Die Frage war, ob die Fernwärme zum Vorreiter<br />
der Erneuerung durch umfassende Baumaßnahmen werden sollte. Dies<br />
wurde entschieden abgelehnt, weil damit Heizkostensteigerungen in<br />
einer für die dort ansässige Bevölkerung untragbaren Höhe entstanden<br />
wären. Deshalb mußte einerseits der weitere Ausbau der Fernwärme<br />
verhindert, aber gleichzeitig auch eine andere Lösung für eine Verringerung<br />
der Luftbelastung und Verbesserung der Heizsysteme gefunden<br />
werden. Die Lösung bestand in einer Verbesserung der Einzelofenheizung,<br />
kombiniert mit Wärmedämmaßnahmen und veränderten Nutzungskonzepten.<br />
Diese Kombination war ökonomisch vertretbar und<br />
entsprach dem Konzept der »behutsamen Erneuerung« in Kreuzberg.<br />
Der Ansatz führte im weiteren zu dem Konzept »mittlerer Heizkomfort«,<br />
welcher einen zentralen Gasofen mit einer verbesserten Einzelofenheizung<br />
verbindet und in Verbindung mit anderen Maßnahmen die<br />
Schadstoffimmission um etwa 50% verringert.<br />
* 1984 sollen im Rahmen dieses Programms allein in Kreuzberg über 200 Höfe begrünt<br />
werden.<br />
164
Zusammenfassend kann nach diesen ersten vier Jahren der Arbeit im<br />
Bereich <strong>Öko</strong>logie/Energie gesagt werden, daß die Probleme in den<br />
meisten Fällen weniger technischer als sozialer und psychologischer<br />
Natur sind. Verhaltensnormen, gesetzliche und Finanzierungsvorschriften<br />
und Fachausbildung zementieren die Existenz zentraler Systeme der<br />
Ver- und Entsorgung. Diese haben uns wohl in mancher Hinsicht<br />
unabhängiger, wie auch in vieler Hinsicht abhängiger gemacht. Der<br />
Vorteil der Unabhängigkeit wird aber immer mehr durch zunehmende<br />
Kosten und Umweltverschmutzung aufgewogen. Deshalb muß die IBA<br />
den Freiraum, der ihr zugestanden wurde, innovativ zu planen, soweit<br />
wie möglich nutzen, ökologisch richtig, das heißt u.a. auch dezentral<br />
planen. Planer, Architekten und Bewohner müssen bequem gewordene<br />
Gewohnheiten und Prämissen aufgeben und sich mit neuen Ansätzen<br />
vertraut machen. Die Zusammenarbeit mit Mietern und Betroffenen in<br />
Kreuzberg und in der Südlichen Friedrichstadt zeigt, daß die Betroffenen<br />
ökologischen Ansätzen weitaus positiver gegenüberstehen, als die<br />
meisten Fachleute annehmen. Deshalb ist die wichtigste Voraussetzung<br />
für die Maßnahmen zur ökologischen Regeneration der <strong>Stadt</strong> die Entwicklung<br />
eines Handlungsspielraumes für die Bewohner, welche die<br />
Verantwortung für Pflege und Schutz ihrer unmittelbaren natürlichen<br />
Umwelt übernehmen wollen.<br />
Dieser Spielraum wird jedoch nur entstehen, wo die Bewohner entweder<br />
Eigentümer werden oder eine langfristige Perspektive haben, daß sie<br />
in dem Gebiet, in dem sie wohnen, auch bleiben können. Steigende<br />
Mietpreise und Heiz- und Bewirtschaftungskosten, die nicht der Einkommensentwicklung<br />
oder der sozialen Situation angepaßt sind, sowie<br />
Verdrängung der Bewohner durch planerische und Baumaßnahmen,<br />
sind der sichere Tod eines »ökologischen« Handelns im Sinne von<br />
Partnerschaft mit der Natur. Der permanente Kampf um die Sicherung<br />
dieser wichtigsten Voraussetzungen sowie die Eigentumsverhältnisse<br />
und Finanzierungsrichtlinien für die Sanierung in Kreuzberg haben dazu<br />
geführt, daß wichtige ökologische Maßnahmen bisher bei der Sanierung<br />
unterblieben sind. Ähnliches läßt sich bei der Umsetzung der Neubauprojekte<br />
in der Südlichen Friedrichstadt und im Tiergarten voraussehen,<br />
wenn die beteiligten Planer neben den architektonischen nicht auch die<br />
ökologischen Kriterien stärker in die Planung einbeziehen.<br />
Wenn man abschließend die in der IBA-Arbeit zutage getretenen<br />
Konflikte benennen sollte, so könnte man sie - stark vereinfacht - in<br />
drei Kategorien einteilen, als Konflikte zwischen:<br />
1. <strong>Öko</strong>logie und <strong>Öko</strong>nomie<br />
2. <strong>Öko</strong>logie und Ästhetik und<br />
3. <strong>Öko</strong>logie und Grün<br />
165
1. Der Konflikt zwischen <strong>Öko</strong>logie und <strong>Öko</strong>nomie resultiert aus der<br />
Tatsache, daß die meisten ökologischen Maßnahmen von den Kapitalkosten<br />
her teurer sind als herkömmliche Baumaßnahmen, die IBA<br />
aber über keine zusätzlichen Durchführungsmittel verfügt. Im Rahmen<br />
der »behutsamen <strong>Stadt</strong>erneuerung« des Konzeptes der einen<br />
Hälfte der IBA (auch »IBA-arm« genannt) wird gerade aber versucht,<br />
die Kosten für Erneuerungsmaßnahmen und damit Mietsteigerungen<br />
möglichst gering zu halten, um eine Vertreibung der jetzigen<br />
Bewohner aus dem Sanierungsgebiet aus Kostengründen zu vermeiden.<br />
Im Neubaugebiet (auch »IBA-reich« genannt) müssen die anspruchsvollen<br />
architektonischen Pläne im Rahmen ganz normaler<br />
Richtlinien des sozialen Wohnungsbaues finanziert werden. Da bleibt<br />
für ökologische Mehrkosten wenig Spielraum.<br />
Noch zahlt sich die Einsparung nicht erneuerbarer Ressourcen in<br />
vielen Fällen nicht aus. Damit entfällt der unmittelbare ökonomische<br />
Anreiz, Zeit und Geld zu investieren, um Energie, Wasser und<br />
Rohstoffe so intensiv zu schonen, daß auch für Kinder und Kindeskinder<br />
noch etwas übrigbleibt.<br />
Der Vorrang ökonomischer Gesichtspunkte gegenüber arideren<br />
Werten, die unser Leben lebenswert machen, resultiert jedoch nicht<br />
nur aus menschlicher Kurzsichtigkeit, sondern auch aus einem Konstruktionsfehler<br />
in unserem Geldsystem, wie Helmut Creutz in seinem<br />
Beitrag nachweist. Ebensowenig, wie dieser Konstruktionsfehler im<br />
Rahmen der IBA behoben werden kann, werden wir all jene Verschwendung,<br />
die sich aus dem monströsen Verpackungsaufwand, der<br />
Zunahme des Privatverkehrs und anderen Konsumansprüchen ergibt,<br />
allein durch planerische und bauliche Maßnahmen eindämmen<br />
können. Gehen wir jedoch von der Annahme aus, daß jeder Schritt<br />
in die richtige Richtung, auch bei der Erstellung und Erneuerung von<br />
Wohnraum, ein Beitrag zur Lösung der Gesamtproblematik sein -<br />
oder auch umgekehrt zur Verschärfung der Konflikte beitragen<br />
kann -, so bieten sich, wie der Kriterienkatalog zeigt, eine Reihe von<br />
Möglichkeiten, die wenig kosten und heute schon wirksam eingesetzt<br />
werden können. Diese Möglichkeiten konkreter als bisher zu definieren<br />
und in die Planung einzubringen ist eine Aufgabe der <strong>Öko</strong>beratergruppe<br />
in der IB A (siehe B and 2).<br />
2. Der Gegensatz zwischen <strong>Öko</strong>logie und Ästhetik resultiert nicht nur<br />
aus unterschiedlichen Prioritäten beim Entwurf auf seiten der Architekten,<br />
sondern auch aus einem anderen Verhältnis zur »Aneignung«<br />
von Architektur durch die Nutzer. Architekten, die Architektur in<br />
erster Linie als Baukunst sehen - eine wichtige Zielsetzung im<br />
Rahmen des IBA-Neubaubereiches -, sind weniger geneigt, eine<br />
Übernahme und Veränderung ihres Kunstwerkes durch die Nutzer<br />
166
zuzulassen. Architekten, die Architektur in erster Linie als Ergebnis<br />
eines sozialen Prozesses der Aneignung durch die Bewohner betrachten,<br />
werden dagegen bestrebt sein, genau diesem Aspekt der Veränderung<br />
und der Veränderbarkeit durch entsprechende Freiräume und<br />
Freiflächen Rechnung zu tragen.<br />
Auch wenn viele ökologische Maßnahmen (z.B. Wasser- und<br />
Energiesparen, Recycling und die Auswahl biologisch richtiger Baustoffe)<br />
durchaus mit dem Anspruch, Baukunstwerke zu schaffen,<br />
vereinbar wären, setzt die erforderliche Umstellung im Verhalten der<br />
Nutzer im Umgang mit solchen Systemen auch eine andere Zusammenarbeit<br />
zwischen Nutzer und Architekt und einen anderen Aneignungsprozeß<br />
von Architektur voraus. Vielleicht ist es deshalb so<br />
schwierig, Architekten mit vorwiegend ästhetischen Prioritäten für<br />
ökologische Ansätze zu begeistern. Umgekehrt gibt es bisher nur<br />
wenig ökologisch ausgebildete Architekten, die ästhetisch befriedigende<br />
Lösungen, vor allem im städtischen Raum, geschaffen haben.<br />
Die meisten Energiesparhäuser wirken eher langweilig. Inwieweit die<br />
jetzt im Rahmen der IBA geplanten <strong>Öko</strong>-Projekte beiden Seiten, der<br />
<strong>Öko</strong>logie und der Ästhetik, gerecht werden können, bleibt abzuwarten.<br />
Das Ziel muß natürlich die Integration beider Ansprüche sein.<br />
Wie unterschiedlich die Wege dahin sind, beweisen die ersten in der<br />
IBA geplanten Projekte von Frei Otto/Hermann Kendel, Bengt<br />
Warne/Jo Glässel, der Oekotop und der Gruppe »die Wüste lebt«.<br />
3. Die Beziehung zwischen <strong>Öko</strong>logie und Grün wird nur dort zum<br />
Konflikt, wo immer noch gegen die traditionelle Vorstellung, <strong>Öko</strong>logie<br />
und Grünplanung seien ein Und dasselbe, angekämpft werden<br />
muß. Ein paar Kreise mit der Schablone als Andeutung für Bäume<br />
und Büsche auf übriggebliebenen Restflächen zwischen Gebäuden,<br />
das ist oft alles, was von Architekten in bezug auf das Thema<br />
»<strong>Öko</strong>logie« erwartet und getan wird. Um Wasser- und Energiesparmaßnahmen<br />
sollen sich die zuständigen Fachingenieure kümmern,<br />
um die Abfallbeseitigung die kommunale Müllabfuhr, und um die<br />
richtigen Baustoffe die Baustoffindustrie. Daß all dies nicht mehr<br />
ganz stimmt, wissen die meisten Architekten. Aber die Aneignung<br />
des notwendigen Wissens und die Durchsetzung der erforderlichen<br />
Maßnahmen in die Praxis ist zeitraubend und kostspielig. Weder die<br />
Ausbildung noch die Praxis der Architekten, Landschaftsplaner,<br />
Heizungs- und Wasserfachleute begreift »die Sicherung der biologischen<br />
Lebensgrundlagen« heute als eines der wichtigsten Ziele ihrer<br />
Arbeit.<br />
Die besten Partner bei der Umsetzung ökologischer Ansätze sind nach<br />
den Erfahrungen der letzten vier Jahre die Mieter selbst, die langfristig<br />
167
davon profitieren. Besonders aktiv sind hier die Selbsjhilfegruppen, in<br />
deren Programmen sich die in der IBA erarbeiteten ökologischen Zielsetzungen<br />
deutlich widerspiegeln.<br />
Unter den Selbsthilfegruppen sind wiederum diejenigen am aktivsten<br />
an der Erprobung ökologischer Ansätze beteiligt, die in besetzten<br />
Häusern zeitweilig einen rechtsfreien Experimentierraum besaßen. Hier<br />
wurden Grauwassersysteme aus alten Saftbehältern und ausgebauten<br />
Waschmaschinenregelteilen gebastelt, hier wurde kompostiert, Freiflächen<br />
auf Höfen, Fassaden und Dächern begrünt, Gemüse, Salat und<br />
Kräuter produziert, und alles, was möglich war, weiterverwandelt, vom<br />
Bauschutt bis zu alten Türen, Fenstern und Kleidern.<br />
Wer den Stolz und die Begeisterung erlebt hat, mit dem sich die meist<br />
jugendlichen Besetzer ökologischen und sozialen Projekten widmen,<br />
dem muß unsere gewohnte Planungs- und Baupraxis noch widersinniger<br />
erscheinen, als sie ohnehin schon ist. Die der bisherigen <strong>Stadt</strong>planungsund<br />
Baupraxis zugrunde liegenden Gesetze haben der Erosion der<br />
biologischen Lebensgrundlagen in der <strong>Stadt</strong>, der Vergiftung der Luft,<br />
des Wassers und der Nahrung, der zunehmenden Verteuerung des<br />
Wohnraums und der Zubetonierung unserer Städte nicht Einhalt bieten<br />
können. Trotzdem halten noch immer viele politische Entscheidungsträger<br />
ökologische Ansätze, die Überlebensmöglichkeiten in den Städten<br />
sichern könnten, für einen »utopischen Idealismus«.<br />
<strong>Öko</strong>logisches Bauen ist keine neue technologische Utopie, sondern<br />
baut auf ein anderes soziales und kulturelles Verständnis, welches dem<br />
großtechnischen Wahnsinn im Sinne von Herrschaft des Menschen über<br />
die Natur ein neues Weltbild vom Leben des Menschen mit der Natur<br />
entgegensetzt. Diesen gemeinsamen Prozeß des Umdenkens, des Planem<br />
und Realisierens ein Stück weiterzubringen, ist die Aufgabe der<br />
IBA in den kommenden Jahren.<br />
168
Die Autoren<br />
Axt, Günter, Prof. Dr., Fachbereich Technischer Umweltschutz, Technische<br />
Universität, Berlin.<br />
Creutz, Helmut, Dipl.-Arch., Publizist, Aachen.<br />
Güterbock, Gabriele, Dipl.-Ing., Mitarbeiterin des Instituts für Abfallwirtschaft,<br />
Technische Universität, Berlin.<br />
Hämer, Gustav, Prof. Dr., Planungsdirektor für den Bereich »<strong>Stadt</strong>erneuerung«<br />
bei der Internationalen Bauausstellung (IBA), Berlin.<br />
Hubert, Bensu, freie Mitarbeiterin bei der Internationalen Bauausstellung<br />
(IBA), Bereich »Getrennte Abfallsammlung«, Berlin.<br />
Hundertwasser, Friedensreich, Kunstmaler, Wien.<br />
Krause, Florentin, Dr., wissenschaftlicher Publizist, zur Zeit in Kalifornien.<br />
Krusche, Per, Freier Architekt und <strong>Öko</strong>loge, seit 1975 beratend tätig,<br />
Tittmoning/B äyern.<br />
Lötsch, Bernd, Dr., Universitäts-Dozent, Österreichische Akademie<br />
der Wissenschaften, Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz,<br />
Wien.<br />
Mauer, Willi, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Internationalen Bauausstellung<br />
(IBA), Berlin.<br />
Rottkord, Franz, Dipl.-Ing., Mitarbeiter des Instituts für Abfallwirtschaft,<br />
Technische Universität, Berlin.<br />
Schenkel, Werner, Prof. Leiter des Fachbereichs III: Abfallwirtschaft -<br />
Wasserwirtschaft, Umweltbundesamt, Berlin.<br />
Thomas, Peter, Installateur und Dipl.-Ing., Berater für alternative Wasserversorgungssysteme,<br />
u.a. für die IBA.<br />
Vester, Frederic, Prof. Dr., Studiengruppe für biologie und umweit,<br />
München.<br />
169
fischer Perspektiven<br />
fischer alternativ<br />
K. William Kapp<br />
Erneuerung der Sozialwissenschaften<br />
Ein Versuch zur Integration und Humanisierung<br />
Band 4161<br />
Die Sozialwissenschaften spezialisieren sich immer<br />
mehr. Nur eine neue Grundlegung der Sozialwissenschaften,<br />
die sich an der menschlichen Natur und deren<br />
Bedürfnissen orientiert, vermag die oft unmenschlichen<br />
Folgen einer sich »wertfrei« begreifenden Sozialwissenschaft<br />
zu überwinden.<br />
Klaus Heinrich<br />
Vernunft und Mythos<br />
Ausgewählte Texte<br />
Band 4162<br />
Nur eine Kritik, die den Mythos ernst nimmt, vermag den<br />
Begriff des Mythos für die Sinnkrise in unserer Gesellschaft<br />
fruchtbar zu machen.<br />
»Die Wirklichkeitssubstrate abstrakter Begriffe aufzuzeigen,<br />
logische Forme(l)n auf in ihnen abgelagerte<br />
lnhaltehinzuentziffern,istHeinrich'sRuhm«. DIEZEIT<br />
Horst von Gizycki<br />
Arche Noah '84<br />
Zur Sozialpsychologie gelebter Utopien<br />
Band .4163<br />
Hier wird eine Arche entworfen, die die Menschen nicht<br />
erst nach der Katastrophe rettet, sondern dazu beitragen<br />
soll, die Katastrophe zu vermeiden. In einem Aufriß<br />
einer Sozialpsychologie »gelebter Utopien« sucht der<br />
Autor kritisch nach Prinzipien und Möglichkeiten einer<br />
alternativen Praxis, wie sie sich schon in vielen Gemeinschaftsprojekten<br />
zeigt.<br />
Fischer Taschenbuch Verlag<br />
fillO/la
fischer Perspektiven -<br />
fischer alternativ<br />
Klaus Gretschmann<br />
Wirtschaft im Schatten<br />
von Markt und Staat<br />
Grenzen und Möglichkeiten einer Altemativ-<strong>Öko</strong>nomie<br />
Band 4164<br />
Eine zusammenfassende Darstellung der Prinzipien<br />
einer Altemativ-<strong>Öko</strong>nomie, die einen Ausweg aus der<br />
Wirtschaftskrise eröffnen kann. Wiesiehtder »informelle«<br />
Bereich einer Volkswirtschaft aus, in dem weniger<br />
profitiert, sondern bedarfsorientiert produziert und soziale<br />
Dienstleistungen erbracht werden?<br />
Hansjörg Hemminger<br />
Der Mensch - eine Marionette der Evolution?<br />
Eine Kritik an der Soziobiologie<br />
Band 4165<br />
Eine kritische Auseinandersetzung eines Biologen mit<br />
der Soziobiologie, die die Gesetze der biologischen<br />
Entwicklung auf gesellschaftliche Prozesse überträgt<br />
und so dem »Sozialdarwinismus« Tür und Tor öffnet.<br />
Ein Versuch, eines engagierten Wissenschaftlers, den<br />
Menschen von Natur aus als Kulturwesen zu begreifen.<br />
Wolf Schäfer (Hrsg.)<br />
Neue Soziale Bewegungen<br />
Konservativer Aufbruch in buntem Gewand?<br />
Band 4166<br />
Eine kontroverse Auseinandersetzung über das Theorieverständnis<br />
der <strong>Öko</strong>logie- und Alternativbewegung.<br />
Eine Standortbestimmung über diese Bewegung von<br />
Betroffenen und Außenstehenden.<br />
Diese Texte befassen sich mit umstrittenen Themen wie<br />
»Glaube an das Volk«, »neue Mütterlichkeit« und<br />
»Formen des Widerstandes«.<br />
Fischer Taschenbuch Verlag<br />
fi 110/lb
fischer Perspektiven<br />
fischer alternativ<br />
Günter Altner (Hg.)<br />
Die Welt als offenes System<br />
Eine Kontroverse um das Werk von llya Prigogine<br />
Band 4168<br />
Die bisherige wissenschaftliche Entwicklung kann für<br />
den weiteren zivilisatorischen Fortschritt nicht ohne<br />
Folgen bleiben. Die modernen Industriegesellschaften<br />
werden immer komplexer, welche Perspektiven<br />
positiver oder negativer Art zeigen sich dabei?<br />
Ferdinand W.Menne<br />
Eigensinn und Selbsthilfe<br />
Über das Recht auf einen kleinen Alltag<br />
Band 4169<br />
Die Alternativen können nur überleben, wenn sie sich<br />
das Recht auf den kleinen Alltag erkämpfen. Wer den<br />
»kleinen Leuten« lebensnotwendige Sicherheiten entzieht,<br />
handelt nicht nach dem Subsidiaritätsprinzip. Nur<br />
eine aktive Förderung der Alternativen und Stärkung<br />
von Eigensinn, Eigenwillen und Eigenmacht der<br />
Kleinen vermag dies zu erreichen.<br />
Bettina Jansen/Brigitte von der Twer<br />
Für einen anderen Umgang mit der Natur<br />
Wider männliche Beherrschung und<br />
Zerstörung der Natur<br />
Band 4171<br />
Eine Analyse der Umweltzerstörung durch eine sich nur<br />
männlich begreifende Naturwissenschaft und deren<br />
Neugestaltung, indem weibliche Erfahrung zu einem<br />
neuen wissenschaftlichen Kriterium gemacht wird. Nur<br />
so läßt'sich eine geschlechtsspezifische Aneignung<br />
von Umwelt überwinden.<br />
Fischer Taschenbuch Verlag<br />
fi 110/lc
Die Veränderung der Zukunft<br />
Anders leben - überleben<br />
Herausgegeben von H.-J. Bahr/R. Gronemeyer. Band 4002<br />
Die Grenzen des Wachstums sind genügend aufgezeigt worden.<br />
Katastrophenfixierung und Krisentheorie führen nicht weiter.<br />
Deshalb votieren in diesem >Brennpunkte
Die Veränderung der Zukunft<br />
Helmut Swoboda<br />
Der Kampf gegen die Zukunft<br />
Band 4004<br />
Helmut Swoboda hat sich mit seinem Buch über Utopien einen<br />
Namen gemacht. Auch im vorliegenden Buch geht der Autor<br />
von der Utopie einer kreativen Gesellschaft aus, in der sich<br />
jeder entfalten kann. Dabei malt Swoboda nicht ein Schlaraffenland<br />
an die Wand, er geht vielmehr in schriftstellerischer<br />
Detailarbeit an die Analyse unseres Alltags. Dabei kommt der<br />
Autor zum Schluß, daß wir uns durch eine »realistische«<br />
Lebensweise den Weg in die Zukunft selber verbauen. Auf der<br />
einen Seite halten wir an starren Strukturen fest, um andererseits<br />
den Fortschritt aus kurzfristigen Überlegungen immer<br />
weiter voranzutreiben. Bestehendes, das wir einst in bester<br />
Absicht geschaffen haben, verliert so seinen Sinn, wodurch<br />
auch die Zukunft immer sinnloser wird.<br />
Wege aus der Wohlstandsfalle<br />
Der NAWU-Report:<br />
Strategien gegen Arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung<br />
Herausgegeben von H. Chr. Binswanger/Werner Geissberger/<br />
Theo Ginsburg. Band 4030<br />
Die Ratlosigkeit der offiziellen Wirtschaftspolitik erfordert mutige<br />
und realisierbare Konzepte, die in Neuland vorstoßen.<br />
Solange die Alternative auf umweltschädigendes Wachstum<br />
oder Arbeitslosigkeit beschränkt wird, öffnet sich kein Weg aus<br />
der Wohlstandsfalle. Eine Strategie wie man<br />
Lebensqualität und Vollbeschäftigung<br />
erreichen kann, hat die Schweizer<br />
Gruppe für »Neue Analysen Wirtschaft<br />
Umwelt« (NAWU) entworfen. Dabei<br />
zeigt es sich immer mehr, daß<br />
unser Lebensstil überhaupt zur<br />
Diskussion steht. Wir müssen<br />
unsere Vorstellungen über die<br />
industrielle Massenproduktion,<br />
das Geld, die Eigentumsformen<br />
und unsere Art miteinander zu<br />
leben von Grund auf neu<br />
überdenken.<br />
Fischer Taschenbuch Verlag<br />
fi 113/2b
Zur ökologischen Lage der Nation<br />
Der Fischer<br />
<strong>Öko</strong>-Almanach 84/85<br />
Herausgegeben von Gerd Michelsen<br />
und dem Oko-Institut, Freiburg/Br.<br />
fischer alternativ Band 4093<br />
Zum dritten Mal ziehen an die 90 Wissenschaftler, Publizisten<br />
und politisch Engagierte aus der Bundesrepublik<br />
Deutschland in diesem völlig neu überarbeiteten <strong>Öko</strong>-Almanach<br />
eine <strong>Öko</strong>-Bilanz. Wer sich über Arten und Möglichkeiten<br />
der schädlichen Wirkungen großtechnologischer<br />
Produktion informieren will, findet in diesem Almanach<br />
Daten, Fakten und weiterführende Hinweise: Angefangen<br />
bei der Gesundheitssituation des Einzelnen und den Gefahren<br />
beim Hausgebrauch von Chemikalien, über die regionalen,<br />
nationalen sowie internationalen Gefährdungen<br />
durch Rüstung und Industrieproduktion bis hin zur Frage<br />
der Wirtschaftlichkeit von Atomstrom, sozialen Fragen der<br />
neuen Technologien und der Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
durch eine ökologisch orientierte Politik.<br />
In weiterführenden Beiträgen wird<br />
der Rahmen für die neue ökosoziale<br />
Frage abgesteckt. Ein<br />
Anhang mit vielen Adressen und<br />
einem umfangreichen Register<br />
beschließen diesen, für jeden<br />
ökologisch Interessierten<br />
unentbehrlichen Leitfaden.<br />
fi 114/2<br />
Fischer Taschenbuch Verlag
Schon in den siebziger Jahren hatte der<br />
Deutsche Städtetag zur Rettung der Städte<br />
aufgerufen. 19 79 wurde in Berlin die Internationale<br />
Bauausstellung (IBA) gegründet,<br />
die zum Zweck hat, Altstädte anders zu<br />
sanieren als bisher. 1984 zieht die IBA<br />
Zwischenbilanz und zeigt bis Ende 19 84 in<br />
über 20 Ausstellungen Ergebnisse ihrer Arbeit.<br />
In diesem - ersten - Band werden<br />
Grundlagen und Materialien für eine <strong>Öko</strong><br />
<strong>Stadt</strong> anschaulich vermittelt.<br />
Originalausgabe<br />
ISB N 3-596-24096-4