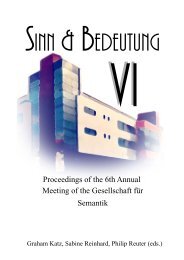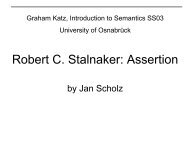Kognitionslinguistische und lernpsychologische ... - Cognitive Science
Kognitionslinguistische und lernpsychologische ... - Cognitive Science
Kognitionslinguistische und lernpsychologische ... - Cognitive Science
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bei den sehr gut bekannten Wörtern waren sowohl bei den Muttersprachlern als auch bei den<br />
Lernern nur noch etwa 10 Prozent der Assoziationen klanglicher Natur gewesen. In Hinblick<br />
auf die Anzahl von paradigmatischen <strong>und</strong> syntagmatischen Assoziationen gab es indes noch<br />
immer Unterschiede. Bei den Lernern konnten mehr syntagmatische bei den Muttersprachlern<br />
mehr paradigmatische Reaktionen beobachtet werden (Abb. 2.11). 153<br />
Dies sollte jetzt jedoch nicht zu einem systematischen Unterschied stilisiert werden.<br />
Noch viel weniger sollte es als Argument für eine funktionelle Inferiorität des L2-Lexikons<br />
missbraucht werden. Sowohl bei den syntagmatischen als auch bei den paradigmatischen<br />
handelt es sich um semantische Beziehungen. Södermann argumentiert, dass auch eine<br />
syntagmatische Antwort auf ein Stimuluswort ein erhebliches Maß an lexikalischem Wissen<br />
voraussetze <strong>und</strong> weit mehr bedeute als ein Wort lediglich zu kennen. 154 Außerdem sollte man<br />
bedenken, dass viele der sehr gut bekannten Wörter, selbst bei den Muttersprachlern<br />
syntagmatische Assoziationen auslösten.<br />
Einen wichtigen Gr<strong>und</strong> für die größere Häufigkeit solcher Assoziationen bei<br />
Nichtmuttersprachlern kann man entdecken, wenn man anschaut, welcher Art vielfach die<br />
paradigmatische Beziehung zwischen dem Stimulus- <strong>und</strong> dem Reaktionswort war. Oftmals<br />
wurde nämlich ein Synonym assoziiert. Bedenkt man nun, dass Nichtmuttersprachler über<br />
einen viel kleineren Wortschatz verfügen, so ist die geringere Anzahl von paradigmatisch<br />
verknüpften Reaktionswörtern nicht verw<strong>und</strong>erlich.<br />
Beim Betrachten des mentalen L2-Lexikons sollte man dessen Entwicklung nicht – wie<br />
es in der Forschung leider immer wieder getan wurde – an einer Zunahme der<br />
paradigmatischen Antworten im Verhältnis zu den syntagmatischen messen (syntagmatic-<br />
paradigmatic-shift), sondern vielmehr an der Zunahme der semantisch bedeutungsvollen<br />
(syntagmatischen UND paradigmatischen) im Verhältnis zu den semantisch<br />
bedeutungslosen. 155 Außerdem sollte man nicht der Versuchung unterliegen, das mentale<br />
Lexikon so zu betrachten, als wäre es ein einziges Wort. Es besteht aus vielen lexikalischen<br />
Einheiten, die getrennt voneinander die Entwicklung von unbekannt zu sehr gut bekannt<br />
durchlaufen. 156 Auf welche Weise sich ein einzelner Eintrag dabei verändert, soll – einem<br />
Modell von Jiang folgend – nun noch etwas detaillierter erörtert werden.<br />
153 Vgl. Wolter (2001), S. 57-61.<br />
154 Vgl. Södermann (1993), nach Wolter (2001), S. 62.<br />
155 Vgl. Wolter (2001), S. 63.<br />
156 Man sollte sich das mentale Lexikon eines (mehr oder weniger) zweisprachigen Menschen deshalb auch nicht<br />
– wie es in der früheren Forschung bisweilen diskutiert wurde – als nur untergeordnet, nur kombiniert oder nur<br />
koordiniert vorstellen. Vgl. Hulstijn (1997), S. 175.<br />
64