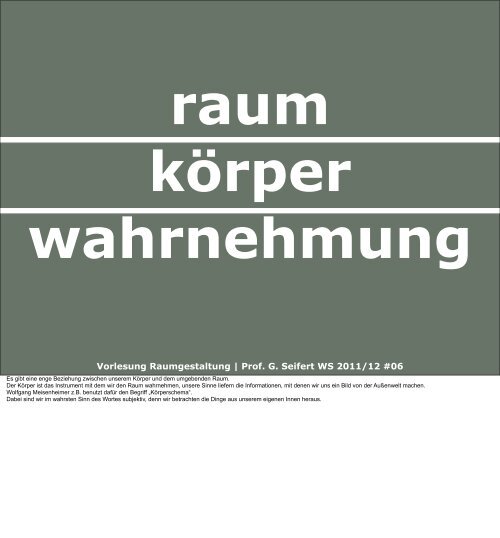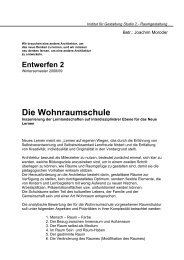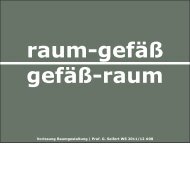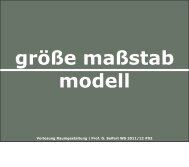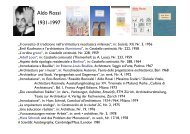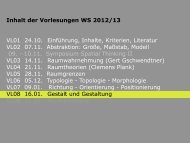Vorlesung Raumgestaltung | Prof. G. Seifert WS 2011/12 #06
Vorlesung Raumgestaltung | Prof. G. Seifert WS 2011/12 #06
Vorlesung Raumgestaltung | Prof. G. Seifert WS 2011/12 #06
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
aum<br />
körper<br />
wahrnehmung<br />
<strong>Vorlesung</strong> <strong>Raumgestaltung</strong> | <strong>Prof</strong>. G. <strong>Seifert</strong> <strong>WS</strong> <strong>2011</strong>/<strong>12</strong> <strong>#06</strong><br />
Es gibt eine enge Beziehung zwischen unserem Körper und dem umgebenden Raum.<br />
Der Körper ist das Instrument mit dem wir den Raum wahrnehmen, unsere Sinne liefern die Informationen, mit denen wir uns ein Bild von der Außenwelt machen.<br />
Wolfgang Meisenheimer z.B. benutzt dafür den Begriff „Körperschema“.<br />
Dabei sind wir im wahrsten Sinn des Wortes subjektiv, denn wir betrachten die Dinge aus unserem eigenen Innen heraus.
Literaturhinweis:<br />
Wolfgang Meisenheimer:<br />
Das Denken des Leibes und<br />
der architektonische<br />
Raum, 2000<br />
(mit Kurzbeschreibung<br />
theoretischer Ansätze<br />
und Positionen in Bezug auf<br />
Körper und Raum)<br />
Die gestischen Wirkungen der Architektur<br />
Gebaute Dinge. Architektonischer Raum.<br />
Körper. Leib. Körperschema.<br />
Wahrnehmung. Gefühl. Erkenntnis.<br />
Ausdruck. Geste. Gebärde.<br />
Architektonische Orte. Gebaute Atmosphären.<br />
Meisenheimer beschreibt die vielfältigen Verbindungen, die zwischen Körper und Raum bestehen<br />
er sagt, dass Raumwahrnehmung primär über Korrespondenzen von Leib und Architektur erfolgt,<br />
dass der Körper das Angebot des Raums sozusagen noch vor der bewussten Erkenntnis realisiert<br />
über das Gestische, die Setzung, die Grenzziehung, das Erzeugen von Spannung und Atmosphären<br />
über Erwartungshaltungen und deren Erfüllung<br />
Die Korrespondenzen von Leib und Architektur<br />
Urphänomene<br />
Die Geste der Aufrichtung. Die Errichtung der Vertikalen.<br />
Die Geste hier! und dort! Das Setzen der Orte.<br />
Das Trennen von innen und außen. Grenzen ziehen.<br />
Die Gesten für Enge und Weite. Spannung erzeugen.<br />
Phänomenologische Skizzen<br />
Leib und Architektur<br />
Die Konstruktion von Atmosphären. Körpertechniken.<br />
Staunen und Stutzen. Angemessene Abstände.<br />
Schwellen. Pulsation. Schwingung. Rhythmus.<br />
Die pathetische Aufrichtung. Ausblicke. Durchblicke.<br />
Die suggestive Mitte. Die Schräge. Landschaften im Innenraum.<br />
Bilder der menschlichen Gestalt. Organische Architektur.<br />
Der kontrollierte Leib. Arbeitsräume. Mein Zimmer. Idyll.<br />
Technische Adapter. Cyberspace.<br />
Neue Empfindlichkeit. Experimentelle Plastik.<br />
Sinnenstäuschungen. Das Fremde. Das Verdorbene. Der Ekel.<br />
Zapping-Landschaften. Rausch. Ekstase. Phobien.<br />
Die wechselnde Disposition des Leibes.<br />
Ein interessanter Teil des Buches ist die sehr kurze Beschreibung der bekannten theoretischen Positionen allerdings nur in Bezug auf sein Thema Körper und Raum.
Wahrnehmung und Gestalt<br />
Gestalt in der Psychologie<br />
Allgemeine Gestaltprinzipien<br />
Figur und Grund<br />
Spezielle Gestaltgesetze<br />
Architektonische Gestalten<br />
was wir primär wahrnehmen sind Figuren und Gestalten<br />
Andere Wahrnehmungssinne wie Taktilität, Geruch, Akustik, bis hin zu differenzierten atmosphärischen Qualitäten kommen erst später ins Spiel<br />
obwohl sie entwicklungsgeschichtlich älter sind und bei der Entwicklung des Kleinkinds zuerst durchlaufen werden<br />
(siehe auch Jean Piaget und die Gestaltpsychologie)
„Dalmatiner“<br />
Gestalten sind tragende Ordnungen, die ein Leitmotiv für die Wahrnehmung bilden.<br />
Gestaltphänomene sind auch in der Psychologie und Philosophie erforscht worden<br />
wenn man versucht Information aus dem Bild herauszulesen<br />
ist man auf bestimmte Wahrnehmungen, wie: Form, Figur, Wiedererkennbarkeit, etc.<br />
angewiesen
Rubin‘sche Vase<br />
Zunächst einige Beispiele aus der Wahrnehmungspsychologie:<br />
Typisches Figur-Grund-Phänomen, Kipp-Effekt
Würfel-Kippfigur<br />
je nachdem welche Vordergrundebene man „sieht“<br />
M.C. Escher, holländischer Grafiker (1898-1972)<br />
optische Täuschung durch 2d versus 3d<br />
Das Verhältnis von Bild und Raum wird herausgefordert
Würfel, vom Auge ergänzt<br />
Das wahrgenommene ist mehr als die Summe seiner Teile<br />
Die Psychologie geht davon aus dass Gestalten ursprüngliche Phänomene sind, die sich nicht ganz exakt erklären lassen
gestalt<br />
psychologie<br />
Die Gestaltpsychologie entwickelte sich in den 1920er Jahren zu einer eigenständigen Theorie und beeinflusste die<br />
Forschung in verwandten Disziplinen wie auch Kunst und Design.<br />
Die Gestaltpsychologie widmet sich dem Bereich der menschlichen Wahrnehmung.<br />
Sie untersucht die zugrunde liegenden kognitiven Mechanismen, die es uns erst ermöglichen, Phänomene wahrzunehmen<br />
und einzuordnen.
Christian von Ehrenfels, österr. Philosoph (1856-1932)<br />
Christian von Ehrenfels<br />
(1856-1932)<br />
Die Gestaltpsychologie leitet sich aus der Arbeit des Philosophen Christian v. Ehrenfels um 1890 her, der die Wahrnehmungsqualitäten zunächst im Sehraum und im Hörraum untersuchte.<br />
Seine Erkenntnis war, dass die Wahrnehmung Qualitäten enthalte, die sich aus einfachen Sinnesqualitäten und deren Anordnung ergeben.<br />
Die Gestaltpsychologie geht der Frage nach, warum wir etwas als eine Einheit – eine Gestalt – wahrnehmen und anderes<br />
nicht.
Hörraum<br />
„So sei die Melodie eine solche Gestaltqualität, denn die Töne als Elemente der Melodie könnten durch Töne anderer Instrumente ersetzt werden, und es wäre dennoch dieselbe Melodie, wenn nur die<br />
Anordnungsbeziehung zwischen den Tönen erhalten bleibt.“ (Zitat Ehrenfels)<br />
Das nannte er "zeitliche Gestalten" im Unterschied zu "unzeitlichen Gestalten“, das betrifft z.B. die Architektur
Palladio Il Redentore, Venedig, 1592<br />
“Unzeitliche Gestalten”<br />
wie das "Bild" einer Fassade, die "Figur" eines Grundrisses, die "Silhouette" oder die "Plastik" der Baumassen etc.
Silhouet<br />
te
Grundriss”figuren”<br />
Einprägsame formelhafte Gliederung
Stadtsilhouetten (die eigentlich aus voneinander getrennten Einheiten bestehen)<br />
Ehrenfels definiert Gestalten als Bewußtseinsqualitäten eigener Art:<br />
"Unter Gestalt-Qualitäten verstehen wir solche Vorstellungsinhalte, welche an das Vorhandensein von Vorstellungskomplexen im Bewusstsein gebunden sind,<br />
die ihrerseits aus voneinander trennbaren (d.h. ohne einander vorstellbaren) Elementen bestehen.“<br />
Mit anderen Worten: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
Und trotzdem:<br />
wie eine Stadt aussieht ist das eine - wie sie funktioniert das andere<br />
Lucius Burckhard<br />
beschreibt 1975 in seinem bekannten Buch: Design ist unsichtbar<br />
wie eine Stadt eigentlich erst mittels ihrer „unsichtbaren“ Systeme funktioniert<br />
wie Infrastruktur: Verkehr, Versorgung
Lucius Burckhard<br />
beschreibt 1975 in seinem bekannten Buch: Design ist unsichtbar<br />
wie eine Stadt eigentlich erst mittels ihrer „unsichtbaren“ Systeme funktioniert<br />
wie Infrastruktur: Verkehr, Versorgung
wie eine Stadt eigentlich erst mittels ihrer „unsichtbaren“ Systeme funktioniert<br />
wie Infrastruktur: Verkehr, Versorgung
Guy Debord, Situationist (1931-1994), Plan von Paris<br />
Guy Debord, Situationist (1931-1994), Plan von Paris<br />
Wenn Burkhard über die Gesamtheit der Systeme spricht, so geht es bei Debord um Teilsysteme, um Fragmente<br />
weil der Mensch nicht in der Lage ist, alles auf einmal zu erfassen und in einer Gesamtschau wahrzunehmen<br />
Debord spricht hauptsächlich darüber, wie sich Stadt-(Raum-)Wahrnehmung aus Situationen ergibt.<br />
Daher ist die Wahrnehmung eines komplexen Gefüges wie einer Stadt zwangsläufig fragmentarisch und erfolgt nach ganz anderen Prioritäten
Gegenmodell: das Panoptikum, die barocke Stadt mit zentralem Blickpunkt<br />
Als Einheit geplant
Beschreibt die 3 Stufen der<br />
Wahrnehmung<br />
form<br />
figur<br />
gestalt
Die Gestaltpsychologie sucht nach den Hintergründen für die Gestaltwahrnehmung<br />
u.a. mittels sehr einfacher Formen mit z.T. kleinen Abweichungen<br />
ab wann ist eine Form eine Figur oder eine Gestalt<br />
Die menschliche Wahrnehmung tendiert dazu, Regelmässigkeit aufzuspüren, notfalls auch das, was fehlt, zu ergänzen
Allgemeine Regeln der Gestalt:<br />
1. Gestalten sind Ganzheiten, die gegenüber der Summe<br />
ihrer Teile eine andere, neue Qualität haben<br />
2. Gestalten sind Einheiten, die sich von einer Umgebung/<br />
einem Grund als etwas Andersartiges abheben (siehe<br />
oben)<br />
3. Gestalten sind transponierbar, d.h. man erkennt sie<br />
wieder, auch wenn sie in veränderten Techniken,<br />
Materialien, Farben, Größen etc. dargestellt werden<br />
Regeln der Gestalt:<br />
1.Gestalten sind Ganzheiten, die gegenüber der Summe ihrer Teile eine andere, neue<br />
Qualität haben<br />
2. Gestalten sind Einheiten, die sich von einer Umgebung/ einem Grund als etwas<br />
Andersartiges abheben (siehe oben)<br />
3. Gestalten sind transponierbar, d.h. man erkennt sie wieder, auch wenn sie in veränderten<br />
Techniken, Materialien, Farben, Größen etc. dargestellt werden
Starke Abhebung vom Grund bei Silhouette<br />
Gestalt kann auch Bedrohung bedeuten<br />
an kleinen Merkmalen entscheidet sich Bedeutung<br />
Gestalten sind ursprüngliche visuelle Zeichen, wie icons
Gesetz der Ähnlichkeit<br />
Der gemeinsame Begriff ist Säule<br />
Gestalt ist transponierbar in andere Ausdrucksformen<br />
wir erinnern die Übertragbarkeit der musikalische Gestalt, der Melodie
Der Medienwissenschaftler und Kunstpsychologe Rudolf Arnheim<br />
spricht bei einer leicht erfassbaren und wiedererkennbaren Form von einer “Figur”.<br />
Nach seiner Definition werden umschlossene Formen als Figur gesehen, wenn keine anderen Faktoren eingreifen.<br />
Regelmässige Formen sind vorhersehbar und können in der Vorstellung leicht ergänzt werden.
es hängt vom Kontext ab, welche Figur als Masse und welche als Umraum gelesen<br />
wird
Unregelmäßige Formen wecken Assoziationen und werden der eigenen Erfahrung entsprechend gedeutet<br />
ob eine Formgestalt an etwas erinnert, hängt von Erfahrung und Prägung ab
Figur auf Grund<br />
Gianbattista Nolli, Plan von Rom, 1748<br />
Die fast gleichmäßige Verteilung von Masse und Leerraum ist ein gutes Beispiel für das Figur-Grund-Prinzip<br />
Auch die weißen Flächen können als zusammenhängender Raum gelesen werden
Peter Cook und Colin Fournier, Kunsthaus Graz (2003)<br />
beim „friendly alien“ wird die Assoziation durch den Namen unterstützt<br />
erinnert die Gestaltform an etwas?<br />
komplexe, vielfältige Assoziationen möglich<br />
das mechanistische der frühen Archigram-Entwürfe ist einer freien organischen, amöbenhaften Gestaltform gewichen
spezielle gestaltprinzipien:<br />
figur auf grund<br />
prägnanz<br />
gleichheit, ähnlichkeit<br />
geschlossenheit<br />
nähe<br />
symmetrie<br />
erfahrung<br />
irradiation<br />
kontrast<br />
Die Wahrnehmung von Figur-Grund-Motiven und Gestalt-Formen folgt dabei einer Reihe von Gesetzmäßigkeiten, von denen 11 hier genannt werden:<br />
Die Gesetzmäßigkeiten treten einzeln oder zusammen auf.<br />
Das Prinzip der qualitativen Erfassung von Gesetzmässigkeiten einer herausgehobenen Gestalt bezeichnet man als Prägnanz.<br />
Prägnante Gestalten weisen oft einfache, geschlossene Form- und Figurmerkmale auf.
Figur-Grund<br />
figur auf grund<br />
Der Begriff der Gestalt konstituiert sich aus der Form als äußerer Begrenzung und Figur als die Abgehobenheit vom Grund.
Wassily Kandinsky, Trente 1937<br />
Kontrast<br />
Figur auf Grund
M.C. Escher (Maurits Cornelis)<br />
Plane Filling II<br />
Figur-Grund als Kippbild
Bologna, Piazza Maggiore<br />
hier ist der Bereich des Platzes als Figur auf Grund ausgebildet, wie ein Teppich
Boris Podrecca<br />
Piazza Tartini in Piran, Slowenien
prägnanz<br />
Mosaik aus eine römischen Villa in Orbe, Schweiz, ca. 200 n.Chr.<br />
Als Prägnanz bezeichnet man die qualitative Erfassung von Gesetzmässigkeiten.<br />
Prägnante Gestalten weisen oft einfache, geschlossene Form- und Figurmerkmale auf.<br />
So tritt das komplexere Muster oben gegenüber den Einfachen (Rechteck) darunter in den Hintergrund.<br />
Aus unterschiedlichen Distanzen werden unterschiedliche Gestaltmerkmale erfassbar
Säule auf Landstraße<br />
Ein Beispiel für das Gesetz der Prägnanz. Es werden bevorzugt Gestalten wahrgenommen, die sich von anderen, durch ein bestimmtes Merkmal abheben.<br />
Besonders prägnant sind die archetypischen Gestalten wie, Säule, Kuppel, regelmäßige Körper<br />
Ihr Alleinstellungsmerkmal läßt sie zur Landmark, zum Attraktor werden.
Hochspannungsmast<br />
ein Beispiel, dass Prägnanz der Gestalt auch strukturell sein kann.
Johann Otto von Spreckelsen, La Grande Arche, Paris (1984-89)<br />
Johann Otto von Spreckelsen, La Grande Arche, Paris (1984-89) -<br />
Tag
shrine of the book von Frederick Kiesler und Armand Bartos, Jerusalem<br />
sein einziges realisiertes Projekt<br />
Prägnanz, Figur auf Grund<br />
Silhouette, Gefäßform
Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), Haus der Flurwächter (um 1778)<br />
Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), Haus der Flurwächter (um 1778)<br />
Prägnanz<br />
Es gibt wohl kaum eine perfektere, reduziertere, gleichzeitig aber auch unbewohnbarere Form als die Kugel.
Kaaba in Mekka<br />
Prägnanz, Figur auf Grund
Prägnanz durch Bildhaftigkeit, wörtlich genommen<br />
oder durch reine Fassadengestaltung, die nur den fahrenden Verkehr adressiert<br />
In “learning from las vegas” beschäftigten sich Robert Venturi und Denise Scott-Brown hauptsächlich damit<br />
wie wir zu einem Bild der Stadt in einer mobilitätsorientierten Welt kommen können<br />
Die Stadt ist nicht mehr formale Geschlossenheit, sondern ist aufgelöst und besteht aus Einzelobjekten<br />
sprawl, strip, road-town
Robert Venturi<br />
Learning from Las Vegas, 1972<br />
Macht schon darauf aufmerksam, dass unsere Wahrnehmung der Stadtgestalt mehr auf Konsumreize ausgerichtet ist<br />
eher die schönen guten Waren als auf das Wahre, Schöne, Gute der Klassik
Diller-Scofidio, Blur Building, Expo Suisse (2002)<br />
Diller-Scofidio, Blur Building, Expo Suisse (2002)<br />
das Gegenteil von Prägnanz<br />
Der Wunsch, Architektur ohne Interpretation und Selektion entstehen zu lassen.
Nähe / Gruppierung<br />
Nähe:<br />
Die Elemente mit dem geringsten Abstand voneinander werden zu Gruppen zusammengefasst.
Minoru Yamasaki, WTC-Twin Towers, New-York (1973-2001)<br />
Minoru Yamasaki, World-Trade-Center (Twin Towers), New-York (1973-2001)<br />
Ein Beispiel für eine Kombination aus dem Gesetz der Nähe und dem Gesetz der Gleichheit/Ähnlichkeit:<br />
Einander ähnliche Elemente werden eher als zusammengehörig erlebt als einander unähnliche.<br />
Materialähnlichkeit, Formenähnlichkeit
Petronas Towers, Kuala Lumpur, Cesar Pelli, 1992-98<br />
Nähe:<br />
Die Elemente mit dem geringsten Abstand voneinander werden zu Gruppen zusammengefasst.
Leon Battista Alberti (1404-1472), Biblioteca Laurenziana<br />
Leon Battista Alberti (1404-1472), Biblioteca Laurenziana<br />
Ein Beispiel für das Gesetz der Nähe:<br />
Elemente mit geringen Abständen, wie die Säulen hier zueinander werden als zusammengehörig wahrgenommen.
Symmetrie<br />
Symmetrie:<br />
Achsen- und punktsymmetrische Formen haben hohe Prägnanz.<br />
Eine der prägnantesten Gestalten ist die auf eine vertikale Achse bezogene Symmetrie.
Aus: Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des lecons données à L‘Ecole Ploytechnique (1802-09)<br />
Aus: Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des lecons données à L‘Ecole Ploytechnique (1802-09)<br />
In klassischen Bauwerken oft angewendet
Gleichheit/Ähnlichkeit<br />
Gleichheit:<br />
Sind unter einer Anzahl verschiedenartiger Figuren zwei oder mehr gleichartig, werden sie als Gruppe wahrgenommen.<br />
Hier können im Gegensatz zur
Markt in Nordafrika<br />
Ein Beispiel für das Gesetz der Kontinuität:<br />
Reize, die eine Fortsetzung vorangegangener Reize zu sein scheinen, werden als zusammengehörig angesehen.<br />
serielle Situationen und Strukturen
Ludwig Hilberseimer (1885-1967), Stadtplanung<br />
Ludwig Hilberseimer (1885-1967), Stadtplanung<br />
Ein Beispiel für das Gesetz der Kontinuität:<br />
Reize, die eine Fortsetzung vorangegangener Reize zu sein scheinen, werden als zusammengehörig angesehen.<br />
serielle Situationen und Strukturen
Die Gleichheit der Abbildung ist bei Andy Warhol nur scheinbar<br />
tatsächlich gibt es minimale Unterschiede durch die Siebdrucktechnik
aus Leni Riefenstahl: Triumph des Willens, 1934<br />
Peking, Olympische Eröffnungsfeier 2008<br />
Gesamtbild aus Gleichheit, Serialität
Fraktale - Koch tree<br />
Auch bei den fraktalen gilt das Gesetz der Ähnlichkeit, hier: Selbstähnlichkeit
„Es gibt Zusammenhänge, bei denen<br />
nicht, was im Ganzen geschieht, sich<br />
daraus herleitet, wie die einzelnen Stücke<br />
sind und sich zusammensetzen, sondern<br />
umgekehrt, wo – im prägnanten Fall –<br />
sich das, was an einem Teil dieses<br />
Ganzen geschieht, bestimmt von inneren<br />
Strukturgesetzen dieses seines Ganzen.<br />
… Gestalttheorie ist dieses, nichts mehr<br />
und nichts weniger.“<br />
(Über Gestalttheorie. Vortrag vor der Kant-Gesellschaft, Berlin am 17. Dezember<br />
1924. Verlag der Philosophischen Akademie: Erlangen 1925)<br />
Apfelmännchen, Fraktal<br />
Apfelmännchen, Fraktal<br />
Die Gestalt des Apfelmännchens entsteht aus einem mathematischen Prozess, der keine Intention besitzt, eine bestimmte Form abzubilden.<br />
Dennoch informiert die Gesamtform jedes einzelne Teilchen (Fraktal) über seine Lage und Ausrichtung.<br />
Die Benennung „Apfelmännchen“ kommt aus einer formalen, gestaltpsychologischen Assoziation.
Sierpinski-Dreieck<br />
Sierpinski-Dreieck (nach: Waclaw Sierpinski, poln.Mathematiker, 1882-1969)<br />
Dieser Gestaltungsalgorithmus erzeugt endlose Wiederholungen derselben Form. Auch hier bilden sich unbewußt für uns benennbare und nachvollziehbare Muster.<br />
Zur Darstellung des Sierpinski-Dreiecks wird als Ausgangsdreieck meist ein gleichseitiges Dreieck gewählt; das ist nicht zwingend, jedes beliebige Dreieck kann in ein Sierpinski-Dreieck zerlegt werden.<br />
Für Neugierige:<br />
Der "klassische" Algorithmus, der zur grafischen Demonstration des Fraktalbegriffs verwendet wird, ist folgender:<br />
1. Zeichne ein Dreieck ("Initiator")<br />
2. Verbinde die Mittelpunkte der Seiten ("Generator") (dadurch wird das ursprüngliche Dreieck in vier deckungsgleiche Teildreiecke zerlegt)<br />
3. Entferne das mittlere der vier Teildreiecke (die anderen drei Teildreiecke bleiben übrig)<br />
4. Wende Schritte 2 und 3 auf die drei übriggebliebenen Teildreiecke an. usw.
Sydney Opera House, Joern Utzon, 1959-73<br />
Ähnlichkeit, nicht Gleichheit der Form
Sydney Opera House, Joern Utzon, 1959-73<br />
Dachbelag aus Fliesen<br />
Durchdeklinierung der Gesamtform bis ins Detail<br />
Prägnanz und die Erfassung der Gesetzmäßigkeiten<br />
Linien dominant, Rautenmuster sekundär
same same, but different....<br />
MVRDV, Siedlung in Ypenburg (2004)<br />
Gesetz der Ähnlichkeit:<br />
Alle Häuser haben exakt die gleiche Form, jedoch sind sie aus unterschiedlichem Material.
gleiches/ähnliches von Frank Gehry<br />
Medienhafen Köln
Kazuo Sejima<br />
Museumsprojekt in New York
Frank O. Gehry, Museum Bilbao (1991-97)<br />
Frank O. Gehry, Museum Bilbao (1991-97)<br />
Prägnanz, Materialähnlichkeit
Geschlossenheit<br />
Geschlossenheit:<br />
Figuren, die durch geschlossene Linien wie z.B. Quadrate oder Kreise gebildet werden, treten stärker hervor als offene.
Siedlungen gehorchen im allgemeinen dem Gesetz der Geschlossenheit und der Ähnlichkeit<br />
wobei über die gestalterische Homogenität hinaus auch die gesellschaftliche Konformität abgebildet wird
Archigram (1960-74), Walking Cities<br />
Archigram (1960-74), Walking Cities<br />
Das Gesetz der Geschlossenheit: Unterschiedlich geformte Einzelteile ergeben zusammen ein Ganzes.<br />
Jede Maschine funktioniert so
Mobiltelefon – Explosionszeichnung<br />
Gestaltung - Konstruktives Zusammensetzen einzelner Teile von einem äußeren Zweck bestimmt.<br />
Die äußere Hülle repräsentiert weder den inneren Aufbau des Telefons, noch wird der Prozess des Zusammenfügens abgebildet.<br />
Das Telefon ist bereits vor seiner Konstruktion von einem typologischen Vorbild geprägt.
Erfahrung<br />
Erfahrung:<br />
Da die Erfahrung auf kritische Formmerkmale einer bestimmten Menge von Formen und Figuren zurückgreift,<br />
treten diese selbst dann hervor, wenn sie nur unvollständig oder verzerrt wiedergegeben werden.<br />
Geometrische exakte Formen führen teilweise zu falschen optischen Eindrücken.<br />
Verschiedenen dieser optischen Täuschungen muss bei der Gestaltung Rechnung getragen werden,<br />
z.B. aus der Typographie die Ober- und Unterlängen<br />
bei der Säule die Verschmälerung nach oben<br />
beim Tempel die stürzenden Vertikalen
Irradiation<br />
Irradiation oder Überstrahlung:<br />
Helle Formen auf dunklem Grund erscheinen größer als dunkle Formen auf hellem Grund.<br />
Die Aberrationsstreuung verschiebt die Begrenzung von Fläche und Grund. (Aberration=Abweichung)<br />
Dies gilt auch für Schrift!
Haus von SANAA<br />
Architekten
Irradiation<br />
fadin to whiteout
Kontrast<br />
Kontrast- und Ausgleichstäuschungen:<br />
Eine Form verändert ihre scheinbare Größe entgegengesetzt der Größe der sie umgebenden Elemente.<br />
Figuren, die in der Höhe gleichartig, aber geometrisch verschieden sind, müssen optisch angeglichen werden.
Kontrast- und Ausgleichstäuschungen:<br />
Eine Form verändert ihre scheinbare Größe entgegengesetzt der Größe der sie umgebenden Elemente.<br />
Figuren, die in der Höhe gleichartig, aber geometrisch verschieden sind, müssen optisch angeglichen werden.
Charles und Ray Eames, Giant House of<br />
Cards
http://people.csail.mit.edu/fredo/ArtAndScienceOfDepiction/6_Gestalt/6_Gestalt.pdf<br />
http://people.csail.mit.edu/fredo/ArtAndScienceOfDepiction/6_Gestalt/6_Gestalt.pdf<br />
Fredo Durand, MIT Lab for Computer Science