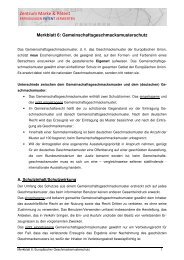Arbeitnehmererfinderrechte und - TGZ Würzburg
Arbeitnehmererfinderrechte und - TGZ Würzburg
Arbeitnehmererfinderrechte und - TGZ Würzburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zentrum Marke & Patent<br />
ERFINDUNGEN PATENT VERWERTEN<br />
Merkblatt 4: Schutz der Arbeitnehmererfindungen<br />
Während das Arbeitsergebnis gr<strong>und</strong>sätzlich dem Arbeitgeber gehört, stehen Patente <strong>und</strong><br />
Gebrauchsmuster in der Regel dem (Arbeitnehmer-) Erfinder zu. Um diesen Konflikt im Falle einer<br />
Erfindung eines Arbeitnehmers am Arbeitsplatz zu lösen <strong>und</strong> dabei ausreichend Schutz zu<br />
gewähren, schafft das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG) einen Ausgleich zwischen Arbeit-<br />
geber- <strong>und</strong> Arbeitnehmerinteressen.<br />
A. Inhalt<br />
Gegenstand dieses Gesetzes sind technische Erfindungen (§2 ArbNErfG), d. h. patent- oder<br />
gebrauchsmusterfähige Erfindungen sowie technische Verbesserungsvorschläge (§3<br />
ArbNErfG), d. h. nicht patent- oder gebrauchsmusterfähige Vorschläge für sonstige technische<br />
Neuerungen.<br />
Nicht dem ArbNErfG unterfallende Leistungen des Arbeitnehmers:<br />
• Urheberrechtsschutzfähige Leistungen (beachte §§ 43, 69 b Urheberrechtsgesetz);<br />
• Markenschutzfähige Leistungen;<br />
• Geschmacksmusterfähige Leistungen (beachte § 7 II Geschmacksmustergesetz);<br />
• Halbleiterschutzfähige Leistungen (beachte § 2 II Halbleiterschutzgesetz).<br />
(Die Zuordnung dieser Leistungen kann vertraglich geregelt werden.)<br />
B. Voraussetzungen<br />
1. Erfindung<br />
a) Diensterfindung (§4 I, II ArbNErfG)<br />
Eine Diensterfindung liegt vor, wenn sie während des rechtlichen Bestandes eines<br />
Arbeitsverhältnisses gemacht worden ist, d. h. entweder aus der dem Arbeitnehmer im Be-<br />
trieb oder in öffentlicher Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden ist (sog. Obliegen-<br />
heitserfindung) oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öf-<br />
fentlichen Verwaltung (sog. Erfahrungserfindung) beruht.<br />
b) Freie Erfindung (§4 I, III ArbNErfG)<br />
• Alle sonstigen Erfindungen sind freie Erfindungen. Eine freie Erfindung liegt insbesondere<br />
dann vor, wenn diese mit der betrieblichen Tätigkeit des Arbeitnehmers nicht im<br />
Zusammenhang steht.<br />
Merkblatt 4: <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong> <strong>und</strong> -pflichten 1
Zentrum Marke & Patent<br />
ERFINDUNGEN PATENT VERWERTEN<br />
• Zu den freien Erfindungen gehören auch die sog. Anregungserfindungen. Das sind solche,<br />
für die die betriebliche Tätigkeit nur eine Anregung gegeben hat, ohne dass dabei der<br />
betriebliche Stand der Technik ursächlich gewesen wäre.<br />
2. Technischer Verbesserungsvorschlag<br />
Ein technischer Verbesserungsvorschlag ist ein Vorschlag für technische Neuerungen, die zwar<br />
nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, aber durch Know-how dem Arbeitgeber eine ähnli-<br />
che Vorzugsposition gewähren wie ein gewerbliches Schutzrecht.<br />
C. Überblick: Ablauf bei Vorliegen einer Diensterfindung<br />
Fertigstellung der Diensterfindung<br />
Merkblatt 4: <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong> <strong>und</strong> -pflichten 2<br />
|<br />
Erfindungsmeldung durch Arbeitnehmer (§ 5 ArbNErfG)<br />
|<br />
Eingangsbestätigung, ggf. Aufforderung zur Ergänzung durch Arbeitgeber (§ 5 I 3, III ArbNErfG)<br />
|<br />
Beginn der viermonatigen Freigabefrist mit Eingang einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung<br />
(§ 6 II ArbNErfG)<br />
|<br />
Unverzügliche Schutzrechtsanmeldung im Inland durch Arbeitgeber (§ 13 ArbNErfG)<br />
|<br />
Entscheidung über Freigabe vor Ablauf der Freigabefrist<br />
| | |<br />
Inanspruchnahme durch Inanspruchnahmefiktion Freigabe vor Fristablauf<br />
Erklärung gegenüber dem durch fruchtlosen Frist- (§6 II, 8 S.1 ArbNErfG)<br />
Arbeitnehmer (§6 I ArbNErfG) ablauf (§6 II ArbNErfG)<br />
| | |<br />
Rechte an der Diensterfindung gehen auf Arbeitnehmer kann über die<br />
den Arbeitgeber über (§7 I ArbNErfG) Diensterfindung frei verfügen<br />
| | (§8 S.2 ArbNErfG)<br />
Vergütungspflicht des Arbeitgebers (§9 I ArbNErfG)
Zentrum Marke & Patent<br />
ERFINDUNGEN PATENT VERWERTEN<br />
D. Meldepflicht des Arbeitnehmers<br />
Bei Erfindungen, sowohl bei Diensterfindungen (§5 ArbnErfG) als auch bei freien Erfindungen (§18<br />
ArbNErfG), trifft den Arbeitnehmer eine Melde- bzw. Mitteilungspflicht. Technische<br />
Verbesserungsvorschläge sind dagegen freiwillig <strong>und</strong> somit nicht meldepflichtig. Da Arbeitnehmer<br />
aber in der Regel nur schwer einschätzen können, ob eine patent- oder gebrauchsmusterfähige<br />
Erfindung vorliegt oder nicht, ist gr<strong>und</strong>sätzlich eine Mitteilung gegenüber dem Arbeitgeber zu<br />
empfehlen.<br />
1. Diensterfindung<br />
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seine Dienstverpflichtung unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes<br />
Zögern, nach Fertigstellung dem Arbeitgeber in Textform mitzuteilen. Fertig gestellt ist die Erfin-<br />
dung, sobald ein Durchschnittsfachmann mit den Angaben des Erfinders arbeiten kann. In der<br />
Meldung, die als solche zu bezeichnen ist, hat der Arbeitnehmererfinder die technische Problem-<br />
stellung, ihre Lösung <strong>und</strong> das Zustandekommen zu beschreiben.<br />
Der Arbeitgeber hat den Eingang unverzüglich in Textform zu bestätigen. Falls die Meldung<br />
weiterer Ergänzung bedarf, kann der Arbeitgeber dies innerhalb von zwei Monaten gegenüber dem<br />
Arbeitnehmer erklären. Macht er davon keinen Gebrauch, gilt die Erfindungsmeldung nach Ablauf<br />
der zwei Monate als ordnungsgemäß. Falls erforderlich, hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei<br />
einer Ergänzung zu unterstützen.<br />
Wichtiger Hinweis:<br />
Die Verletzung der Meldepflicht durch den Arbeitnehmer kann ein wichtiger Gr<strong>und</strong> zur außeror-<br />
dentlichen („fristlosen“) Kündigung sein <strong>und</strong>/oder Schadensersatzpflichten nach sich ziehen.<br />
2. Freie Erfindung<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich hat bei freien Erfindungen der Arbeitnehmer das Recht zur Anmeldung. Dennoch<br />
obliegen ihm sowohl eine Mitteilungs- als auch eine Anbietungspflicht, um möglichen Streitigkeiten<br />
vorzubeugen.<br />
Freie Erfindungen hat der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber somit ebenfalls in Textform<br />
anzuzeigen. Dabei muss er soviel über die Erfindung <strong>und</strong> ihre Entstehung mitteilen, dass der<br />
Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung tatsächlich frei ist. Wenn der Arbeitgeber nicht<br />
innerhalb von drei Monaten bestreitet, dass die Erfindung frei ist, kann er sie nicht mehr als<br />
Diensterfindung in Anspruch nehmen.<br />
Für den Fall, dass der Arbeitnehmer eine freie Erfindung, die in den Arbeitsbereich des Betriebes<br />
des Arbeitgebers fällt, anderweitig verwerten will, muss er zunächst dem Arbeitgeber ein nichtaus-<br />
Merkblatt 4: <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong> <strong>und</strong> -pflichten 3
Zentrum Marke & Patent<br />
ERFINDUNGEN PATENT VERWERTEN<br />
schließliches Benutzungsrecht zu angemessenen Konditionen anbieten. Nimmt der Arbeitgeber<br />
das Angebot nicht innerhalb von drei Monaten an, so erlischt sein Vorrecht.<br />
E. Anmeldepflicht des Arbeitgebers<br />
Nach der Meldung durch den Arbeitnehmer ist der Arbeitgeber verpflichtet <strong>und</strong> allein berechtigt,<br />
die Diensterfindung im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts unverzüglich anzumelden (§13<br />
ArbNErfG).<br />
F. Vergütungspflicht des Arbeitgebers<br />
Den Arbeitgeber treffen sowohl bei Erfindungen als auch bei qualifizierten technischen Verbesse-<br />
rungsvorschlägen Vergütungspflichten.<br />
1. Erfindung<br />
a) Diensterfindung<br />
Mit der erklärten Inanspruchnahme bzw. mit der Inanspruchnahmefiktion nach fruchtlosem<br />
Verstreichen der viermonatigen Freigabefrist gehen die gesamten vermögensrechtlichen Erfin-<br />
dungsrechte auf den Arbeitgeber über (§7 I ArbNErfG) <strong>und</strong> erlauben diesem, nach eigenem<br />
Willen darüber zu verfügen. Im Ausgleich dazu erhält der Arbeitnehmer einen<br />
Vergütungsanspruch (§9 I ArbNErfG). Dieser Anspruch ist unabhängig davon, ob die Erfindung<br />
tatsächlich benutzt wird.<br />
b) Freie Erfindung<br />
Nach §19 I ArbNErfG steht dem Arbeitgeber ein Vorrecht an solchen freien Erfindungen eines<br />
Arbeitnehmers zu, die in den Arbeitsbereich seines Betriebes fallen. Der Arbeitnehmer ist<br />
deshalb neben der bestehenden Mitteilungspflicht auch verpflichtet, diese Erfindungen seinem<br />
Arbeitgeber zu angemessenen Bedingungen zur Benutzung anzubieten. Der Arbeitgeber hat<br />
das Angebot innerhalb von drei Monaten anzunehmen, anderenfalls entfällt sein Vorrecht. Die<br />
Vergütung des Arbeitnehmers ergibt sich in diesem Fall aus den vereinbarten Bedingungen.<br />
Natürlich steht es dem Arbeitnehmer frei, seinem Arbeitgeber auch solche freien Erfindungen<br />
anzubieten, die nicht in den Arbeitsbereich des Betriebes fallen.<br />
2. Technischer Verbesserungsvorschlag<br />
Dabei ist zu unterscheiden zwischen qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen <strong>und</strong><br />
einfachen technischen Verbesserungsvorschlägen.<br />
Merkblatt 4: <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong> <strong>und</strong> -pflichten 4
Zentrum Marke & Patent<br />
ERFINDUNGEN PATENT VERWERTEN<br />
a) Qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag<br />
Dieser gibt dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung durch Know-how wie ein gewerbli-<br />
ches Schutzrecht <strong>und</strong> ist zu vergüten, sobald der Arbeitgeber ihn verwertet.<br />
b) Einfacher technischer Verbesserungsvorschlag<br />
Im Gegensatz zu einem gewerblichen Schutzrecht gibt dieser Vorschlag dem Arbeitgeber keine<br />
ähnliche Vorzugsstellung durch Know-how. Für ihn besteht daher gr<strong>und</strong>sätzlich kein Vergü-<br />
tungsanspruch. Möglicherweise ist ein solcher aber dennoch in Tarifverträgen, Betriebs- oder<br />
Individualvereinbarungen geregelt oder wird individuell prämiert.<br />
G. Höhe der Vergütung<br />
1. Diensterfindung <strong>und</strong> qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag<br />
Solange das Schutzrecht noch nicht erteilt ist, wird gewöhnlich nur eine vorläufige Vergütung ver-<br />
einbart (dies entspricht meist einem bestimmten Prozentsatz der endgültigen Vergütung). Sobald<br />
das Schutzrecht benutzt wird, ist eine endgültige Vergütung zu bezahlen. Findet dagegen keine<br />
Benutzung statt, ist die endgültige Vergütung spätestens mit Ablauf von drei Monaten nach Ertei-<br />
lung des Schutzrechtes festzusetzen.<br />
Über die Bemessung der Vergütung hat das B<strong>und</strong>esministerium Richtlinien veröffentlicht. Die<br />
Höhe der Vergütung ergibt sich danach aus dem Produkt von Erfindungswert <strong>und</strong> Anteilfaktor. Für<br />
die Ermittlung des Erfindungswertes gibt es drei alternative Methoden, die jedoch alle zum glei-<br />
chen Ergebnis kommen müssen. Bei der Lizenzanalogie wird der Lizenzsatz, der für vergleichbare<br />
Fälle bei freien Erfindungen üblich ist, herangezogen. Nach der Nutzungsmethode wird der Wert<br />
nach der betrieblichen Nutzung bemessen, der dem Betrieb aus der Benutzung der Erfindung zu-<br />
fällt. Möglich ist schließlich auch die Schätzung des Erfindungswertes.<br />
Dagegen ergibt sich der Anteilsfaktor aus dem Verhältnis von Aufgabenstellung, Lösung der Auf-<br />
gabe <strong>und</strong> der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb.<br />
Für den qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag, der wie ein technisches Schutzrecht<br />
behandelt wird, gilt das zur Diensterfindung Gesagte.<br />
Wichtiger Hinweis:<br />
Besteht zwischen Arbeitnehmer <strong>und</strong> Arbeitgeber Streit über die Höhe der Vergütung, so ist die<br />
Vergütung durch den Arbeitgeber einseitig festzusetzen <strong>und</strong> in dieser Höhe auszubezahlen. Sollte<br />
der Arbeitnehmer mit der Festsetzung nicht zufrieden sein, kann er ihr innerhalb von zwei Monaten<br />
widersprechen, da sie ansonsten verbindlich wird. Eine einmal gezahlte Vergütung kann<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nicht mehr zurückverlangt werden! Wenn sich die Umstände ändern, kann lediglich<br />
Merkblatt 4: <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong> <strong>und</strong> -pflichten 5
Zentrum Marke & Patent<br />
ERFINDUNGEN PATENT VERWERTEN<br />
vom Arbeitgeber wie aber auch vom Arbeitnehmer eine Anpassung daran bzw. eine Neuregelung<br />
verlangt werden.<br />
2. Freie Erfindung<br />
Wird eine freie Erfindung durch den Arbeitgeber in Anspruch genommen, so schuldet dieser eine<br />
angemessene Vergütung, die sich nach den vereinbarten Bedingungen richtet.<br />
3. Einfacher technischer Verbesserungsvorschlag:<br />
Einfache technische Verbesserungsvorschläge fallen nicht in den Regelungsbereich des Arbeit-<br />
nehmererfindungsgesetzes. Werden sie dennoch nach Tarifvertrag, durch Betriebsvereinbarung,<br />
Individualvertrag oder freiwillig prämiert, ergibt sich die Höhe aus diesen einschlägigen Vorschrif-<br />
ten selbst.<br />
H. Verjährung<br />
Vergütungsansprüche unterliegen einer Verjährungsfrist von drei Jahren. Die Frist beginnt gr<strong>und</strong>-<br />
sätzlich mit Erfüllung der Meldepflicht. Während laufender Verhandlungen kann der Ablauf der<br />
Verjährung gehemmt sein.<br />
I. Schutzverfahren<br />
1. Schiedsverfahren<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich ist im Falle einer Streitigkeit über Arbeitnehmererfindungen, die während der Dauer<br />
eines Arbeitsverhältnisses entsteht, zunächst ein Schiedsverfahren durchzuführen, §§ 28 ff. Arb-<br />
NErfG. Dieses Verfahren ist kostenfrei, vertraulich <strong>und</strong> ohne Anwaltszwang. Auf den Antrag einer<br />
der beiden Streitparteien hin macht die Schiedsstelle einen Einigungsvorschlag, der allerdings<br />
nicht bindend ist. Wird jedoch innerhalb eines Monats nach Zustellung kein Widerspruch eingelegt,<br />
gilt der Vorschlag als angenommen.<br />
2. Klageverfahren<br />
Für den Fall, dass die Beteiligten den Vorschlag der Schiedsstelle nicht annehmen, können Sie bei<br />
den ordentlichen Gerichten Klage einreichen <strong>und</strong> dort den Sachverhalt entscheiden lassen, § 37<br />
ArbNErfG. Hierbei sind – da § 39 ArbNErfG auf § 143 Patentgesetz verweist - die Landgerichte<br />
(LG) unabhängig vom Streitwert zuständig. In Bayern handelt es sich dabei nach § 25 Gerichtliche<br />
Zuständigkeitsverordnung Justiz um das LG Nürnberg-Fürth für die OLG-Bezirke Nürnberg <strong>und</strong><br />
Bamberg sowie das LG München I für den OLG-Bezirk München. Die örtliche Zuständigkeit richtet<br />
sich gemäß den §§ 12, 13 ZPO gr<strong>und</strong>sätzlich nach dem Wohnsitz des Beklagten.<br />
Merkblatt 4: <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong> <strong>und</strong> -pflichten 6
Zentrum Marke & Patent<br />
ERFINDUNGEN PATENT VERWERTEN<br />
J. Besonderheiten bei Hochschulerfindungen (§ 42 ArbNErfG)<br />
Mit dem Inkrafttreten des Änderungsgesetzes über Arbeitnehmererfindungen am 7. Februar 2002<br />
wurde das sog. Hochschullehrerprivileg abgeschafft, nach dem zuvor alle Erfindungen von Hoch-<br />
schulwissenschaftlern (Professoren, Dozenten, wissenschaftliche Assistenten <strong>und</strong> alle Mitarbeiter,<br />
die in einem Arbeitsverhältnis mit der Hochschule stehen) gr<strong>und</strong>sätzlich frei waren.<br />
Hochschulwissenschaftler sind demnach verpflichtet, ihre Diensterfindungen mit Fertigstellung<br />
dem Dienstherrn zu melden, sofern sie nicht aufgr<strong>und</strong> der Lehr- <strong>und</strong> Forschungsfreiheit die<br />
Veröffentlichung der Diensterfindung ablehnen. Eine Diensterfindung kann von der Hochschule in<br />
Anspruch genommen, im eigenen Namen schutzrechtlich gesichert <strong>und</strong> auf eigene Rechnung<br />
verwertet werden. Im Falle der Inanspruchnahme der Diensterfindung bleibt dem Hochschulerfin-<br />
der aber ein Nutzungsrecht im Rahmen seiner Lehr- <strong>und</strong> Forschungstätigkeit. Wird die Erfindung<br />
durch den Dienstherrn verwertet, erhält der Erfinder 30 % der gesamten durch die Verwertung er-<br />
zielten Bruttoeinnahmen.<br />
Für den Fall, dass der Hochschulwissenschaftler von seiner negativen Publikationsfreiheit<br />
Gebrauch macht, kann er die Veröffentlichung seiner Diensterfindung ablehnen <strong>und</strong> ist dann nicht<br />
zur Anzeige der Erfindung beim Dienstherrn verpflichtet. Will er seine Erfindung zu einem späteren<br />
Zeitpunkt doch veröffentlichen, muss er sie zuvor seinem Dienstherrn unverzüglich melden.<br />
K. Rechtslage bei Erfindungen, die vor dem 01.10.2009 gemeldet wurden<br />
Am 1. Oktober 2009 ist das Gesetz zur Vereinfachung <strong>und</strong> Modernisierung des Patentrechts in<br />
Kraft getreten, welches u. a. eine gr<strong>und</strong>legende Reform des <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong>s<br />
beinhaltete.<br />
Mit dem Zugang einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung beginnt auch nach dem ArbNErfG a.<br />
F. eine 4-monatige Frist, nur mit dem Unterschied, dass der Arbeitgeber innerhalb dieser Frist die<br />
Inanspruchnahme der Erfindung erklären muss. Lässt er die Inanspruchnahmefrist verstreichen,<br />
wird die Erfindung nach alter Rechtslage automatisch frei <strong>und</strong> steht damit dem Arbeitnehmer zu.<br />
Der Arbeitgeber kann also den Übergang aller Rechte an der Erfindung nur bewirken, indem er die<br />
Diensterfindung innerhalb der 4-Monats-Frist unbeschränkt in Anspruch nimmt.<br />
Außerdem hat der Arbeitgeber nach alter Rechtslage die Möglichkeit, eine Diensterfindung<br />
beschränkt in Anspruch zu nehmen. Bei der beschränkten Inanspruchnahme ist der Arbeitnehmer<br />
nur an der Verwertung gehindert, soweit die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber reicht. Der<br />
Anspruch auf Vergütung entsteht dabei erst bei Benutzung der Diensterfindung.<br />
Nach dem ArbNErfG a. F. haben alle Erklärungen im Zusammenhang mit einer Erfindung in<br />
Schriftform zu erfolgen. Dies bedeutet, dass für sämtliche Erklärungen, wie bspw.<br />
Merkblatt 4: <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong> <strong>und</strong> -pflichten 7
Zentrum Marke & Patent<br />
ERFINDUNGEN PATENT VERWERTEN<br />
Erfindungsmeldung <strong>und</strong> Inanspruchnahmeerklärung, z. B. eine E-Mail- oder eine Fax-Nachricht<br />
nicht ausreichend ist.<br />
Hintergr<strong>und</strong>: Aufgr<strong>und</strong> mangelnder Kenntnis kam es in der Praxis nicht selten vor, dass<br />
Arbeitnehmer ihre Erfindung dem Arbeitgeber einfach mündlich mitteilten <strong>und</strong> der Arbeitgeber<br />
daraufhin ein Patent im Namen des Unternehmens anmeldete. Zwar lag in diesem Fall keine<br />
ordnungsgemäße Erfindungsmeldung durch den Arbeitnehmer vor, aber nach einer Entscheidung<br />
des B<strong>und</strong>esgerichtshofs (BGH-Urteil vom 04.04.2006, Az.: X ZR 155/03 „Haftetikett“) beginnt<br />
dennoch mit der Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht die vom Arbeitgeber einzuhaltende 4-<br />
monatige Inanspruchnahmefrist zu laufen. Ließ der Arbeitgeber nun (unbewusst) die Frist<br />
verstreichen, konnte dies fatale Folgen für das Unternehmen haben. Da die Erfindung ohne<br />
ordnungsgemäße Inanspruchnahme automatisch frei wurde, konnte dem Arbeitnehmer ein<br />
Anspruch auf Übertragung des Patents zustehen <strong>und</strong> der Arbeitgeber haftete unter Umständen<br />
sogar noch für die Nutzung der Erfindung. Gegebenenfalls hatte das Unternehmen dann sämtliche<br />
getätigte Entwicklungskosten in den Sand gesetzt, wenn dem Arbeitgeber im schlimmsten Fall<br />
dann keinerlei Nutzungsrechte am Patent mehr zustanden. Kernpunkt der Reform war deshalb<br />
unter anderem zur Vermeidung solcher Konstellationen die Änderung des automatischen<br />
Freiwerdens der Erfindung bei Verstreichen der Inanspruchnahmefrist in eine sogenannte<br />
Inanspruchnahmefiktion zugunsten des Arbeitgebers. Lässt der Arbeitgeber also nach neuer<br />
Rechtslage die Frist verstreichen, gehen die Rechte an der Diensterfindung automatisch auf ihn<br />
über. Außerdem wurde die Schriftform durch die Textform ersetzt <strong>und</strong> die Möglichkeit der<br />
beschränkten Inanspruchnahme abgeschafft, da in der Praxis davon so gut wie nie Gebrauch<br />
gemacht wurde.<br />
Stand: Mai 2012<br />
Herausgeber <strong>und</strong> Ansprechpartner:<br />
Zentrum Marke <strong>und</strong> Patent<br />
c/o Technologie- <strong>und</strong> Gründerzentrum <strong>Würzburg</strong><br />
Sedanstraße 27 · 97082 <strong>Würzburg</strong><br />
Tel: 0931 4194-350 · Fax: 0931 4194-205<br />
info@tgz-wuerzburg.de · www.tgz-wuerzburg.de<br />
Hinweis: Dieses Merkblatt soll nur erste Informationen geben <strong>und</strong> erhebt daher keinen Anspruch auf Voll-<br />
ständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Rich-<br />
tigkeit nicht übernommen werden.<br />
Merkblatt 4: <strong>Arbeitnehmererfinderrechte</strong> <strong>und</strong> -pflichten 8