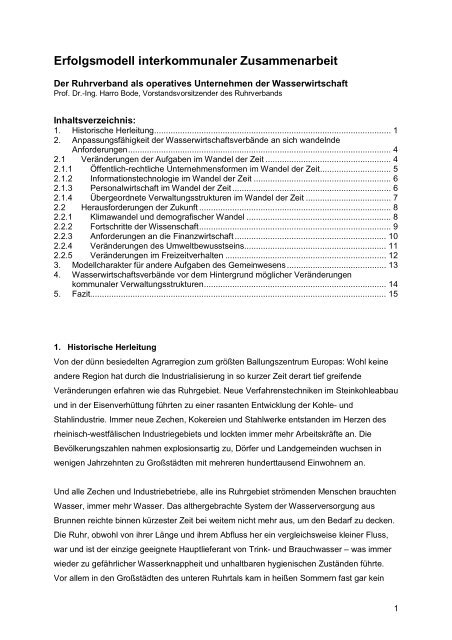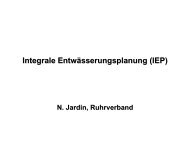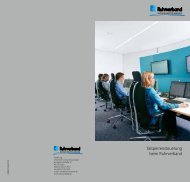Erfolgsmodell interkommunaler Zusammenarbeit - Ruhrverband
Erfolgsmodell interkommunaler Zusammenarbeit - Ruhrverband
Erfolgsmodell interkommunaler Zusammenarbeit - Ruhrverband
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Erfolgsmodell</strong> <strong>interkommunaler</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
Der <strong>Ruhrverband</strong> als operatives Unternehmen der Wasserwirtschaft<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Vorstandsvorsitzender des <strong>Ruhrverband</strong>s<br />
Inhaltsverzeichnis:<br />
1. Historische Herleitung.................................................................................................... 1<br />
2. Anpassungsfähigkeit der Wasserwirtschaftsverbände an sich wandelnde<br />
Anforderungen............................................................................................................... 4<br />
2.1 Veränderungen der Aufgaben im Wandel der Zeit ..................................................... 4<br />
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Unternehmensformen im Wandel der Zeit.............................. 5<br />
2.1.2 Informationstechnologie im Wandel der Zeit .......................................................... 6<br />
2.1.3 Personalwirtschaft im Wandel der Zeit ................................................................... 6<br />
2.1.4 Übergeordnete Verwaltungsstrukturen im Wandel der Zeit .................................... 7<br />
2.2 Herausforderungen der Zukunft ................................................................................. 8<br />
2.2.1 Klimawandel und demografischer Wandel ............................................................. 8<br />
2.2.2 Fortschritte der Wissenschaft................................................................................. 9<br />
2.2.3 Anforderungen an die Finanzwirtschaft ................................................................ 10<br />
2.2.4 Veränderungen des Umweltbewusstseins............................................................ 11<br />
2.2.5 Veränderungen im Freizeitverhalten .................................................................... 12<br />
3. Modellcharakter für andere Aufgaben des Gemeinwesens .......................................... 13<br />
4. Wasserwirtschaftsverbände vor dem Hintergrund möglicher Veränderungen<br />
kommunaler Verwaltungsstrukturen............................................................................. 14<br />
5. Fazit............................................................................................................................. 15<br />
1. Historische Herleitung<br />
Von der dünn besiedelten Agrarregion zum größten Ballungszentrum Europas: Wohl keine<br />
andere Region hat durch die Industrialisierung in so kurzer Zeit derart tief greifende<br />
Veränderungen erfahren wie das Ruhrgebiet. Neue Verfahrenstechniken im Steinkohleabbau<br />
und in der Eisenverhüttung führten zu einer rasanten Entwicklung der Kohle- und<br />
Stahlindustrie. Immer neue Zechen, Kokereien und Stahlwerke entstanden im Herzen des<br />
rheinisch-westfälischen Industriegebiets und lockten immer mehr Arbeitskräfte an. Die<br />
Bevölkerungszahlen nahmen explosionsartig zu, Dörfer und Landgemeinden wuchsen in<br />
wenigen Jahrzehnten zu Großstädten mit mehreren hunderttausend Einwohnern an.<br />
Und alle Zechen und Industriebetriebe, alle ins Ruhrgebiet strömenden Menschen brauchten<br />
Wasser, immer mehr Wasser. Das althergebrachte System der Wasserversorgung aus<br />
Brunnen reichte binnen kürzester Zeit bei weitem nicht mehr aus, um den Bedarf zu decken.<br />
Die Ruhr, obwohl von ihrer Länge und ihrem Abfluss her ein vergleichsweise kleiner Fluss,<br />
war und ist der einzige geeignete Hauptlieferant von Trink- und Brauchwasser – was immer<br />
wieder zu gefährlicher Wasserknappheit und unhaltbaren hygienischen Zuständen führte.<br />
Vor allem in den Großstädten des unteren Ruhrtals kam in heißen Sommern fast gar kein<br />
1
Wasser mehr an, weil die Wasserwerke in den oberhalb gelegenen Flussabschnitten bereits<br />
große Mengen entnommen und überwiegend in andere Flussgebiete exportiert hatten. Zu<br />
den Leidtragenden dieses schädlichen Entzugs gehörten unter anderem die<br />
Triebwerksbesitzer an der unteren Ruhr, denen der „Treibstoff“ ihrer Turbinen mehr und<br />
mehr genommen wurde.<br />
Schon früh, wenn auch in einem schwierigen Entwicklungsprozess, setzte sich daher die<br />
Erkenntnis durch, dass es zur dauerhaften Sicherung eines ausreichenden Wasserabflusses<br />
und hygienischer Bedingungen für die Trink- und Brauchwassergewinnung gemeinsamer<br />
Anstrengungen aller Nutzergruppen bedurfte. Ein erster Schritt auf diesem Weg war der<br />
Zusammenschluss der Wasserwerks- und Triebwerksbetreiber zum privatrechtlich<br />
organisierten Ruhrtalsperrenverein, der 1899 mit dem Ziel gegründet wurde, den Bau von<br />
Talsperren durch finanzielle Unterstützung kleinerer Talsperrengenossenschaften zu fördern.<br />
Trotzdem kam es in den Folgejahren immer wieder zu gefährlichen Versorgungsengpässen<br />
und 1911 schließlich zum Kollaps des Systems: Wochenlange Hitze und Trockenheit,<br />
gepaart mit einem hohen Entnahmegrad durch die Wasserwerke und der damals üblichen<br />
Ableitung ungeklärter Haushalts- und Industrieabwässer in den Fluss, ließen die Ruhr in<br />
ihrem Unterlauf zu einer öligen schwarzbraunen Brühe werden. In Mülheim brach eine<br />
Typhusepidemie aus, bei der 1.500 Menschen erkrankten, und schließlich brachte der<br />
Wassermangel sogar die Industrieproduktion an der unteren Ruhr zum Erliegen.<br />
Bild 1: Die Ruhr bei Essen-Kettwig im Trockenjahr 1911<br />
2
Es war diese Extremsituation, die den Durchbruch brachte: 1913 begründete ein<br />
preußisches Sondergesetz den <strong>Ruhrverband</strong> als öffentlich-rechtlichen Wasserverband mit<br />
der Aufgabe, Kläranlagen zur Reinhaltung der Ruhr zu betreiben, und verlieh zugleich auch<br />
dem bisher privatrechlich organisierten Ruhrtalsperrenverein einen öffentlich-rechtlichen<br />
Status. Mitglieder der Verbände wurden per Gesetz alle Nutzer der Ruhr, also die ganz oder<br />
teilweise im Verbandsgebiet liegenden Kommunen und Kreise sowie Industrie- und<br />
Gewerbebetriebe, die in großen Mengen Abwasser ableiten, Unternehmen der öffentlichen<br />
Wasserversorgung und Triebwerksbetreiber. Eine mutige und für die damalige Zeit absolut<br />
zukunftsweisende Entscheidung, die es <strong>Ruhrverband</strong> und Ruhrtalsperrenverein erlaubte, das<br />
gesamte Flussgebiet der Ruhr unabhängig von administrativen Grenzen, politischen<br />
Gemengelagen und wirtschaftlichen Einzelinteressen als Einheit zu bewirtschaften. Und<br />
auch wenn bis zur Fertigstellung der Biggetalsperre im Jahr 1965 noch einige kleinere<br />
Versorgungsengpässe in heißen Sommern auftraten – der Konflikt zwischen Ober- und<br />
Unterliegern um die Nutzung und die Qualität des Ruhrwassers gehörte endgültig der<br />
Vergangenheit an.<br />
Bild 2: Ganzheitliche Wasserwirtschaft an der Ruhr<br />
3
2. Anpassungsfähigkeit der Wasserwirtschaftsverbände an sich wandelnde<br />
Anforderungen<br />
2.1 Veränderungen der Aufgaben im Wandel der Zeit<br />
Die Kernaufgaben des <strong>Ruhrverband</strong>s – Wassermengen- und Wassergütewirtschaft in einem<br />
flussgebietsbezogenen, regionalen Ansatz – entstanden aus der beschriebenen historischen<br />
Notsituation heraus. Ging es zunächst im Wesentlichen darum, die Versorgung mit Trink-<br />
und Brauchwasser sicherzustellen, was auch heute noch höchste Priorität genießt, so<br />
ergaben sich – sozusagen als Sekundärnutzen – weitere wasserwirtschaftliche Aufgaben,<br />
die durch den <strong>Ruhrverband</strong> sichergestellt oder unterstützt werden. Hierzu gehören der<br />
Hochwasserschutz durch die Talsperrenbewirtschaftung, die Energiegewinnung aus<br />
Wasserkraft und die Fischerei. In früheren Jahren wurden Gewässer in erster Linie<br />
nutzungsbezogen betrachtet und die Anforderungen an die Wasserwirtschaft hierauf<br />
ausgerichtet. Heute begreift man Wasserwirtschaft auch als Umweltschutz und sieht<br />
Gewässer verstärkt als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage und wichtiges<br />
Element der Ökosysteme an.<br />
Bild 3: Die Ruhr: ein wichtiges Stück Natur mitten im Industrierevier.<br />
Zusätzlich tragen der Strukturwandel im Ruhrgebiet, der demografische Wandel, das<br />
veränderte Verbrauchsverhalten der Bevölkerung, der Landwirtschaft und der Industrie, der<br />
4
Klimawandel und nicht zuletzt die Freizeit- und Erholungsfunktion der Gewässer und des<br />
Gewässerumfeldes dazu bei, dass wasserwirtschaftliche Aufgaben einem stetigen Wandel<br />
unterzogen sind. Der zunehmende Freizeitdruck macht auch den Wandel der Ansprüche und<br />
Werte unserer Gesellschaft deutlich. Wasserwirtschaftliche Daseinsvorsorge und<br />
Infrastruktur werden heute mehr als früher als nahezu selbstverständliche<br />
Grundvoraussetzung des gesellschaftlichen Lebens angesehen. Der ganzheitlichen Ansatz<br />
des Flussgebietsmanagements, wie ihn die Wasserwirtschaftsverbände in Nordrhein-<br />
Westfalen seit etwa 100 Jahren praktizieren, hat in der Vergangenheit in optimaler Weise die<br />
geeigneten Antworten gefunden. An den Beispielen öffentlich-rechtliche<br />
Unternehmensformen, Informationstechnologie, Personal und übergeordnete<br />
Verwaltungsstrukturen im Wandel der Zeit wird dies im Einzelnen verdeutlicht.<br />
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Unternehmensformen im Wandel der Zeit<br />
In Zeiten der Liberalisierung der Märkte stellt sich immer wieder die Frage, ob öffentlich-<br />
rechtliche Unternehmen die geeignete Organisationsform für die Daseinsvorsorge darstellen.<br />
Wasserwirtschaftliche Systeme sind, wie zum Teil auch andere Infrastrukturen der<br />
Daseinsvorsorge, natürliche Monopole. Wollte man echten Wettbewerb schaffen, so müsste<br />
sehr kostspielige Infrastruktur wie Talsperren, Kläranlagen, Kanalnetze usw. mehrfach<br />
vorgehalten werden, was technisch wie wirtschaftlich unsinnig ist. Wasserwirtschaftliche<br />
Systeme werden daher meist in öffentlich-rechtlicher Form auf Non-Profit-Basis, d. h. auf der<br />
Grundlage des Kostendeckungsprinzips, betrieben. Werden dennoch ohne Sicherstellung<br />
von hinreichendem Wettbewerb Privatisierungen solcher Monopole vorgenommen, ist das<br />
regelmäßig mit höheren volkswirtschaftlichen Kosten verbunden. So besteht auch nach<br />
Privatisierung wegen des fehlenden Wettbewerbsdrucks kein Anreiz zu Kosteneinsparungen.<br />
Vielmehr gehen in die Preiskalkulation nun zusätzliche Kostenkomponenten, systembedingt<br />
höhere steuerliche Aufwendungen sowie Gewinnmargen ein. Regelmäßig müssen nach<br />
gewisser Zeit zusätzlich staatliche Regulierungsstellen installiert werden, um überhöhte<br />
Monopolpreise wieder einzufangen. Per Saldo wird der Marktwirtschaft damit ein<br />
Bärendienst erwiesen.<br />
Dennoch müssen auch öffentlich-rechtliche Monopole sich fragen lassen, ob das<br />
Kostendeckungsprinzip einen ausreichenden Schutz vor unnötigen oder überhöhten Kosten<br />
gewährleistet. Dies dürfte zumindest bei den genossenschaftlich organisierten, öffentlich-<br />
rechtlichen NRW-Wasserverbänden der Fall sein, da hier diejenigen, die die Kosten tragen,<br />
auch die Budgethoheit haben, so dass sie über die Beschließung der Wirtschaftspläne eine<br />
wirksame Kostenkontrolle ausüben können. Zunehmend Bedeutung für eine gezielte<br />
Kostensteuerung im öffentlich-rechtlichen Bereich gewinnt das sogenannte Benchmarking.<br />
5
2.1.2 Informationstechnologie im Wandel der Zeit<br />
Neue Technologien im Bereich der Datenverarbeitung haben die Arbeitswelt in den letzten<br />
Jahrzehnten in vielfältiger Weise verändert. Ein Beispiel ist die Verwendung von ERP-<br />
Systemen, die die Geschäftsprozesse eines Unternehmens möglichst vollständig abbilden<br />
und datentechnisch verarbeiten sollen. Mit der Umstellung von der Kameralistik zum<br />
kaufmännischen Rechnungswesen entschied sich der <strong>Ruhrverband</strong> bereits 1995 für die<br />
Einführung eines ERP-Systems, das sich unter dem Stichwort „Neues Steuerungsmodell“<br />
inzwischen auch bei den Kommunen als Standard durchgesetzt hat.<br />
Die sich damals bereits abzeichnende starke Marktdurchdringung von SAP und die<br />
Funktionalität der Software führten zu der Überlegung, den Umstieg auf der Grundlage von<br />
SAP R/3 durchzuführen. Aufgrund der erheblichen Kosten dieser Software und ihrer hohen<br />
Anforderungen an den Rechenzentrumsbetrieb ließ sich diese Lösung wirtschaftlich nur mit<br />
mehreren Partnern sinnvoll umsetzen. Mit Emschergenossenschaft und Lippeverband<br />
entschied man sich daher im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für eine<br />
gemeinsame Projektdurchführung und für die gemeinsame Nutzung eines Rechenzentrums,<br />
das beim <strong>Ruhrverband</strong> eingerichtet wurde. Durch die abgestimmte Fachkonzeption,<br />
Projektorganisation und Projektberatung konnte die „SAP-Kooperation Wasserwirtschaft“<br />
bereits in der Gründungsphase erhebliche Kosten einsparen.<br />
Der Kooperationsansatz war so überzeugend, dass sich in den Folgejahren der<br />
Wasserverband Eifel-Rur, der Niersverband, die Landestalsperrenverwaltung des Freistaats<br />
Sachsen, der Wupperverband und der Aggerverband anschlossen. Dauerhafte Vorteile für<br />
alle Partner erzielt die SAP-Kooperation durch Synergien in den Schwerpunkten Lizenz-,<br />
Betriebs- und Projektkooperation.<br />
2.1.3 Personalwirtschaft im Wandel der Zeit<br />
Neben sich verändernden Aufgaben entwickeln sich kontinuierlich neue Arbeitsabläufe in<br />
allen Unternehmensbereichen, von der Steuerung der Anlagen über die Bürowirtschaft bis<br />
hin zu neuen Verfahren im biologischen und chemischem Laboratorium. Insbesondere die<br />
Entwicklung der Informationstechnologie trägt, wie am Beispiel der SAP-Kooperation<br />
aufgezeigt, zu effizienteren Betriebsabläufen bei. Die Personalwirtschaft eines<br />
Unternehmens muss hierauf flexible Antworten finden. Rationalisierungen,<br />
Automatisierungen und Prozessoptimierungen führen regelmäßig zu Veränderungen, die im<br />
Personalbereich in qualitativer und quantitativer Hinsicht sozialverträglich (natürliche<br />
Fluktuation, Umsetzungen) durchgeführt werden, aber auch einer aktiven und zielgerichteten<br />
6
Personalentwicklung bedürfen. Gleichzeitig nutzt der <strong>Ruhrverband</strong> Möglichkeiten von<br />
Kooperationen. Dazu zählen die Kooperation mit zahlreichen Wasserverbänden im Bereich<br />
der Datenverarbeitung sowie die Laborkooperation mit der Emschergenossenschaft und dem<br />
Lippeverband. Obwohl die Aufgabenvielfalt gestiegen ist, reduzierte der <strong>Ruhrverband</strong> in den<br />
letzten fünf Jahren die Zahl seiner Beschäftigungsumfänge um rund 10 Prozent. Es gelang<br />
also durch Restrukturierungen die Arbeitseffizienz zu steigern und auf veränderte<br />
Aufgabenstellungen gezielt zu reagieren.<br />
Derartige Änderungen können nur vollzogen werden, wenn das Tarifrecht der notwendigen<br />
Flexibilität beim Einsatz der Beschäftigten nicht entgegensteht. Ferner sollte das Tarifrecht<br />
Leistungsanreize ermöglichen, um das Potenzial der Beschäftigten bestmöglich ausschöpfen<br />
zu können. Der Spartentarifvertrag der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der<br />
Wasserwirtschaftsverbände in NRW (TV-WW/NW) bietet diese Möglichkeiten. Der TV-<br />
WW/NW ist 1998 hervorgegangen aus dem Tarifrecht des öffentlichen Dienstes<br />
(BAT/BMTG). Er wurde aus Gründen der Vereinfachung und Vereinheitlichung von den<br />
Tarifvertragsparteien entwickelt und berücksichtigt die besonderen personalwirtschaftlichen<br />
Bedürfnisse der Wasserwirtschaft. Er war Vorreiter bei der Gleichstellung von gewerblichen<br />
und angestellten Beschäftigten und ist derzeit Vorreiter hinsichtlich leistungsanreizbasierter<br />
Vergütung im öffentlichen Sektor.<br />
2.1.4 Übergeordnete Verwaltungsstrukturen im Wandel der Zeit<br />
In Nordrhein-Westfalen blickt man mit Stolz auf die über hundertjährige Geschichte der<br />
großen Wasserwirtschaftsverbände, weil sie ihre Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit<br />
bisher mit großem Erfolg erfüllt haben. Als Selbstverwaltungskörperschaften verfügen sie<br />
über geeignete Strukturen, um sich veränderten äußeren Randbedingungen anpassen zu<br />
können. Vom preußischen Staat im Jahr 1913 gegründet, zieht sich die Geschichte des<br />
<strong>Ruhrverband</strong>s als ein Kontinuum durch die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, das so<br />
genannte Dritte Reich und die alliierte Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg, durch die<br />
Phase des Wiederaufbaus und die Bonner Nachkriegsrepublik bis zum wiedervereinigten<br />
Deutschland, das längst seinen festen Standort in der zusammenwachsenden EU gefunden<br />
hat. Dabei haben sich gerade die ausgesprochene Staatsferne der genossenschaftlichen<br />
Selbstverwaltungsstruktur mit ihrem hohen Maß an Autonomie und die Überwindung<br />
kleinräumiger administrativer Grenzen als Garanten für ein anpassungsfähiges Bestehen<br />
selbst dramatischer Veränderungen in Staat und Gesellschaft erwiesen.<br />
Auch im Zuge der fortschreitenden europäischen Integration, die das tradierte Verständnis<br />
vom souveränen Nationalstaat grundlegend in Frage stellt und mit gravierenden<br />
7
Umbauerfordernissen innerhalb der staatlichen Verwaltungen einhergeht, erweisen sich die<br />
nordrhein-westfälischen Wasserwirtschaftsverbände dank der hohen Konnexität zwischen<br />
ihrer inneren Struktur und den ihnen übertragenen Aufgaben als überaus zeitgemäße und in<br />
ihrem Bestand unverändert legitimierte Einrichtungen. Der <strong>Ruhrverband</strong> und die übrigen<br />
Wasserverbände in NRW zeichnen sich in diesem Kontext nicht zuletzt dadurch aus, dass<br />
sie das relativ junge Postulat der europäischen Wasserrahmenrichtlinie,<br />
Gewässerbewirtschaftung in Flussgebietseinheiten zu organisieren, bereits vor Jahrzehnten<br />
vorweg genommen haben. Sie werden deshalb auch den kommenden Herausforderungen<br />
inmitten sich fortlaufend entwickelnder Verwaltungsstrukturen in Europa, in der<br />
Bundesrepublik und in Nordrhein-Westfalen gewachsen sein.<br />
2.2 Herausforderungen der Zukunft<br />
Die wasserwirtschaftlichen Systeme, die die Entstehung der Metropolregion Ruhr erst<br />
möglich machten, waren viele Jahre ausgerichtet an fortschreitender Industrialisierung,<br />
wirtschaftlichem Wachstum und Bevölkerungszunahme. Mit der im letzten Drittel des 20.<br />
Jahrhunderts begonnenen Abkehr von der Schwerindustrie setzte allerdings eine<br />
Entwicklung ein, die auch die wasserwirtschaftlichen Systeme vor neue Anforderungen<br />
stellte und in Zukunft stellen wird. Während sich nämlich die Industrialisierung der Region in<br />
einem vergleichsweise kurzen Zeitraum von wenigen Jahrzehnten vollzog, gilt es im 21.<br />
Jahrhundert auf Veränderungen zu reagieren, die sich schleichend über einen Zeitraum von<br />
voraussichtlich 50 bis 100 Jahren einstellen werden.<br />
2.2.1 Klimawandel und demografischer Wandel<br />
Nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Forschung ist davon auszugehen, dass die<br />
Jahresdurchschnittstemperatur in der Region bis zum Jahr 2100 um rund drei Grad steigen<br />
wird. Niederschläge werden vermehrt im Winter fallen, während die Sommer tendenziell eher<br />
trockener werden. Mit einem häufigeren Auftreten von Extremniederschlägen und längeren<br />
Dürreperioden ist zu rechnen.<br />
Der <strong>Ruhrverband</strong> hat sich daher frühzeitig mit der Frage beschäftigt, ob seine<br />
wasserwirtschaftlichen Anlagen die Anforderungen der Metropolregion auch unter den nach<br />
heutigem Wissensstand zu erwartenden klimatischen Bedingungen im Jahr 2100 erfüllen<br />
können. Mit Hilfe von Hochschulinstituten gelang es, durch umfangreiche<br />
Simulationsberechungen nachzuweisen, dass die Wasserspeichersysteme des<br />
<strong>Ruhrverband</strong>s auch unter den zu erwartenden klimatischen Bedingungen des Jahres 2100<br />
noch in der Lage sein werden, das Ruhrgebiet dauerhaft mit Trinkwasser zu versorgen.<br />
Entscheidend ist hierbei, dass die in der Fläche verteilten Speichersysteme wie schon in der<br />
8
Vergangenheit nicht als Einzelspeicher betrieben, sondern als Verbundsystem gesteuert<br />
werden. Mit dieser räumlich übergreifenden Steuerweise gelingt es, die bestmögliche<br />
Effizienz bei der Nutzung der Ressource Wasser sicherzustellen.<br />
Bild 4: Die Talsperrenleitzentrale in Essen ist das Herzstück des Verbundsystems, in dem<br />
der <strong>Ruhrverband</strong> seine Talsperren betreibt.<br />
Auch die Auswirkungen des demografischen Wandels, also die Abnahme der<br />
Gesamtbevölkerungszahl, der höhere Altersdurchschnitt der Bevölkerung und regionale<br />
Wanderbewegungen lassen sich mit diesem System flexibel handhaben.<br />
2.2.2 Fortschritte der Wissenschaft<br />
Aufgrund der Kernaufgaben des <strong>Ruhrverband</strong>s ist die Entwicklung und das<br />
Innovationspotenzial der Ingenieur- und Naturwissenschaften von hoher Bedeutung für den<br />
zukünftigen Praxisbetrieb. In der aktuellen Diskussion sind hier insbesondere Fortschritte in<br />
den Analyse- und Nachweisverfahren in der Umweltforschung, aber auch im Bereich der<br />
Ökotoxikologie und Hygiene zu nennen. Darüber hinaus hat die Ökosystemforschung einen<br />
deutlich höheren Stellenwert und beeinflusst Stoffbewertungen und Anforderungen an die<br />
Wasserbeschaffenheit und das Wasserdargebot. Hieraus entwickeln sich neue Verfahren für<br />
technische Systeme und Anlagen, aber auch Systeme der Informations- und<br />
Datenerfassung, des Monitorings, der Auswerteverfahren und der Kommunikation.<br />
9
Bild 5: Umbau der Kläranlage Schwerte, um Versuche zum Abbau von<br />
Mikroverunreinigungen zu realisieren.<br />
Für die Wasserwirtschaftsverbände als Anlagenbetreiber gilt es, frühzeitig die Folgen für den<br />
praktischen Betrieb zu erkennen und Handlungsoptionen zu entwickeln. Daher müssen sie<br />
operative Erfordernisse in die wissenschaftliche Diskussion einbringen, um den<br />
Anwendungsbezug wissenschaftlicher Arbeiten zu unterstützen und Fehlentwicklungen<br />
vorzubeugen. Fortschritte im wissenschaftlichen Bereich sind somit Antrieb und Ansporn,<br />
gleichzeitig aber auch Herausforderung zum kritischen Dialog im Hinblick auf ihre praktische<br />
Bedeutung, technische Umsetzbarkeit und Folgen für die Nutzer von Wasser und<br />
Gewässern sowie für die Gesellschaft insgesamt. Diesem Diskurs standzuhalten, erfordert<br />
eine tiefe fachliche Spezialisierung, die nur durch größere operative Einheiten wie z.B. die<br />
Wasserwirtschaftsverbände geleistet werden kann.<br />
2.2.3 Anforderungen an die Finanzwirtschaft<br />
Der <strong>Ruhrverband</strong> investiert in sehr langlebige Infrastruktur. So beläuft sich die mittlere<br />
kaufmännische Nutzungsdauer bei seinen 72 Kläranlagen auf nahezu 30 Jahre, bei seinen<br />
550 Regenbecken auf rd. 50 Jahre und bei seinen acht Talsperren sogar auf rd. 75 Jahre.<br />
Neben einer möglichst nutzungsdauerkongruenten Finanzierung (bis maximal 50 Jahre<br />
möglich) strebt der <strong>Ruhrverband</strong> eine stabile langfristige Zinsentwicklung nahe einer<br />
Zielmarke von aktuell vier Prozent an. Der <strong>Ruhrverband</strong> hat daher ein finanzielles<br />
10
Sicherungsmanagement für sein Portfolio von 600 Darlehen entwickelt, um<br />
zinskostenbedingte Beitragsschwankungen für die Mitglieder zu vermeiden.<br />
Mit dem Instrument „Finanzielles Sicherungsmanagement (FSM)“ hat der <strong>Ruhrverband</strong><br />
bereits jetzt erreicht, dass beispielsweise im Jahr 2012 knapp 80 Prozent seines dann<br />
bestehenden Darlehensvolumens deutlich unter der Zielmarke von vier Prozent<br />
zinsgesichert sind. Auch für den langfristigen Bereich, beispielsweise für das Jahr 2030,<br />
konnte eine hochgradige Sicherheit mit einem zinsgesicherten Anteil von rund 70 Prozent<br />
des Darlehensvolumens und einer Zinsmarke nahe drei Prozent erreicht werden.<br />
2.2.4 Veränderungen des Umweltbewusstseins<br />
Die Anforderungen an das Flussgebietsmanagement sind nicht mehr rein nutzungsbezogen,<br />
sondern zunehmend auch ausgerichtet auf die Sicherstellung der natürlichen<br />
Lebensgrundlagen.<br />
Bild 6: Ökosystem Ruhr<br />
Das bessere Verständnis ökosystemarer Zusammenhänge und nicht zuletzt die gewachsene<br />
Akzeptanz und die Erkenntnis zur Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklungen führten zu<br />
Anforderungen an die Wasserwirtschaft, die auch auf europäischer Ebene eine Orientierung<br />
11
auf ökologische Ziele erfahren haben. So ist in den Gewässern nicht nur eine Fokussierung<br />
auf die chemischen Inhaltsstoffe und chemisch-physikalischen Größen gegeben. Vielmehr<br />
wird der so genannte „gute ökologische Zustand“ gefordert, der systematisch an<br />
Indikatororganismen der Flora und Fauna bestimmt und gemessen wird. Hierbei wird<br />
deutlich, dass nicht nur die Wasserinhaltsstoffe von Bedeutung sind, sondern auch die<br />
Gewässerstruktur als Beschaffenheit von Gewässersohle, Ufer und Umfeld und damit die<br />
Habitatbedingungen von typischen Gewässerorganismen sowie die Einbindung von<br />
Gewässern in aquatische und terrestrische Ökosysteme.Der mehr ganzheitliche Ansatz in<br />
der Wasserwirtschaft und die verstärkte Berücksichtigung von Zusammenhängen mit<br />
anderen Bereichen verlangen eine offenere Sichtweise und eine Einbeziehung anderer<br />
Fachbereiche in einen stark interdisziplinär geprägten Ansatz.<br />
2.2.5 Veränderungen im Freizeitverhalten<br />
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Freizeitverhalten der Menschen in Deutschland<br />
nachhaltig geändert. Längere Urlaube werden häufiger in weiter entfernten Regionen<br />
verbracht, während regional ein Trend zu Kurz- und Wochenendtrips festzustellen ist.<br />
Deutlich gestiegen ist die Nachfrage nach Angeboten, die höheren Komfort und stärkeren<br />
Eventcharakter bieten.<br />
Bild 7: Für die Menschen an der Ruhr ist der Fluss mit seinen Talsperren und Seen<br />
auch ein wichtiges Freizeit- und Naherholungsrevier.<br />
12
Für den <strong>Ruhrverband</strong> als Betreiber von Talsperren und Stauseen bedeutet dies, Konzepte<br />
mitzugestalten, die diese Anforderungen in Einklang bringen mit den primären<br />
wasserwirtschaftlichen Zielstellungen seiner Anlagen. Durch seine großen sauerländischen<br />
Talsperren und den Stauseen an der mittleren und unteren Ruhr bietet der <strong>Ruhrverband</strong> die<br />
Möglichkeit, im Hinblick auf Tages- und Wochenendtourismus den Ballungsraum Ruhrgebiet<br />
mit dem Naherholungsgebiet an der oberen Ruhr zu verbinden.<br />
3. Modellcharakter für andere Aufgaben des Gemeinwesens<br />
Die Wahrnehmung von Aufgaben der Wasserwirtschaft durch einen sondergesetzlichen<br />
Verband in der regionalen Zuständigkeit eines natürlichen Flusseinzugsgebiets scheint<br />
ausweislich der Leistungen und der Effizienz der Aufgabenerledigung Modellcharakter zu<br />
haben für andere Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Aus hiesiger<br />
Sicht erscheinen vor allem folgende Merkmale der Aufgabenerledigung entscheidend:<br />
Räumlicher Handlungsrahmen<br />
Die räumliche Zuständigkeit ist deckungsgleich mit dem Gebiet, in dem sich Handlungen<br />
und Maßnahmen unmittelbar auswirken und die somit ein gezieltes und in sich<br />
geschlossenes Steuerungspotenzial aufweisen. Statt kleinräumiger isolierter Lösungen<br />
gemäß lokalem „Kirchturmdenken“ trägt die Solidargemeinschaft einen ganzheitlichen<br />
Lösungsansatz.<br />
Gemeinschaftliche Entscheidungsfindung, Kontrolle und Finanzierung<br />
Die Selbstverwaltung durch die Nutzer, Vorteilhabenden oder Verursacher und eine<br />
daran ausgerichtete Kostenträgerschaft stehen für eine hohe Identifikation mit dem<br />
Verband. Die demokratischen Strukturen der Entscheidungsfindung tragen entscheidend<br />
bei zu breiter Akzeptanz und Unterstützung.<br />
Fachliche Ausrichtung und Kompetenz<br />
Durch die Konzentration auf die wasserwirtschaftlichen Aufgaben ist eine hohe<br />
Spezialisierung möglich. Dies hat nicht nur eine streng fachliche Ausrichtung und<br />
fundierte Aufgabenerledigung zur Folge, sondern erzeugt auch Anerkennung in der<br />
Fachwelt, in der Öffentlichkeit und bei Entscheidungsträgern.<br />
Öffentlich-rechtlicher Rahmen mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung<br />
Die Orientierung am Gemeinwohl und nicht am Gewinnstreben ist kennzeichnend für die<br />
öffentlich-rechtliche Ausrichtung des <strong>Ruhrverband</strong>s. Dies bedeutet allerdings nicht, dass<br />
13
typische Verwaltungsstrukturen übernommen werden. Vielmehr bestimmt<br />
unternehmerisches Handeln die Entscheidungen und Prozesse. Moderne Werkzeuge der<br />
Unternehmensführung und eine strenge Orientierung an der Wirtschaftlichkeit in einer<br />
mittel- und langfristigen und damit nachhaltigen Perspektive sind klare<br />
Unternehmensvorgaben. Dies betrifft sowohl Investitionsentscheidungen und betriebliche<br />
Aufwendungen als auch Finanzwesen und Personalentwicklung. Kostentransparenz und<br />
-Verantwortung gegenüber den Mitgliedern des Verbands haben einen hohen<br />
Stellenwert. Mitgliedsbeiträge sind deshalb mehr als nur Preise für ein Produkt oder eine<br />
Leistung; sie sind auch Ausdruck einer Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen<br />
und regionaler Infrastruktur in einem verantwortlichen, solidarischen Ansatz mit<br />
nachvollziehbaren Kostenstrukturen.<br />
Langfristige Sicherung von Daseinsvorsorge und Infrastruktur<br />
Der öffentlich-rechtliche Auftrag und Rahmen ist ausgerichtet auf eine langfristige<br />
Aufgabenwahrnehmung in der Region. Dies hat erhebliche Auswirkungen in vielen<br />
Bereichen des Betriebsalltags, so zum Beispiel bei Investitionsentscheidungen,<br />
Instandhaltungsstrategien oder Standortentscheidungen. Die hohe Bedeutung der<br />
Aufgaben für Daseinsvorsorge, Infrastruktur und Umweltschutz in einem regional<br />
organisierten, öffentlich-rechtlichen Handlungsfeld macht diese besondere<br />
Verantwortung deutlich.<br />
4. Wasserwirtschaftsverbände vor dem Hintergrund möglicher Veränderungen<br />
kommunaler Verwaltungsstrukturen<br />
Die mitgliedschaftlich geprägte Struktur des <strong>Ruhrverband</strong>s sichert den Kommunen im<br />
Verbandsgebiet ein starkes Mitspracherecht, unabhängig von allen Veränderungen in der<br />
Organisationsstruktur der jeweiligen Kommune. Derartige Veränderungen, die es in der<br />
Vergangenheit – zum Beispiel in der Organisationsform der jeweiligen Stadtentwässerung –<br />
häufig gegeben hat, schlagen auf den <strong>Ruhrverband</strong> und die gesetzlich begründete<br />
Mitgliedschaft im Verband nicht durch. Die Umwandlung von einem städtischen Regie- oder<br />
Eigenbetrieb in eine Kapitalgesellschaft oder in eine Anstalt öffentlichen Rechts lässt das<br />
Verhältnis der betroffenen Kommune zum <strong>Ruhrverband</strong> unberührt. Mitglied im <strong>Ruhrverband</strong><br />
ist nach dem Gesetz immer nur die Kommune, die als Gebietskörperschaft ganz oder<br />
teilweise im Verbandsgebiet gelegen ist. An diesem Verhältnis des <strong>Ruhrverband</strong>s zu seinen<br />
kommunalen Mitgliedern würde nicht einmal eine größere Gebietsreform etwas ändern<br />
können. Wasserwirtschaftlich wäre der Weg zu einer Ruhrstadt jedenfalls nicht verstellt. Im<br />
Gegenteil.<br />
14
5. Fazit<br />
Die Entstehungsgeschichte des Ruhrgebiets als eines ursprünglich von Kohle und Stahl<br />
geprägten Industrie- und Ballungsraums ist ohne die Übertragung wasserwirtschaftlicher<br />
Aufgaben auf überörtlich gebildete Wasserverbände Anfang des letzten Jahrhunderts kaum<br />
vorstellbar. Es bedurfte vor etwa 100 Jahren einer mutigen Entscheidung zur Gründung des<br />
<strong>Ruhrverband</strong>s und Veränderung der Aufgabenträgerschaft. Sie war geprägt durch die akute<br />
Notsituation, aber auch getragen von einem solidarischen Ansatz in öffentlicher<br />
Verantwortung. Die damals erfolgte Weichenstellung hat sich als zukunftsfähig erwiesen.<br />
Die Unternehmensform einer sich selbstverwaltenden Körperschaft war und ist allen<br />
Veränderungen in Staat und Gesellschaft gewachsen. Auch in Zukunft ist der <strong>Ruhrverband</strong><br />
als Träger der regionalen Wasserwirtschaft an der Ruhr unverzichtbar, um wie bisher die<br />
Versorgung mit Wasser in ausreichender Menge und hoher Qualität für fünf Millionen<br />
Menschen dauerhaft sicher zu stellen.<br />
Bild 8: Nur der Erhalt intakter Gewässer kann langfristig die Wasserversorgung im<br />
Ruhrgebiet sicherstellen.<br />
Die bewährte Form der interkommunalen <strong>Zusammenarbeit</strong> unter Einbeziehung der<br />
Nutzergruppen könnte Vorbild sein für andere Bereiche. Kommunale und andere<br />
Verwaltungsgrenzen sind immer dann hinderlich, wenn:<br />
15
Auswirkungen von Entscheidungen und Maßnahmen auch außerhalb der Grenzen<br />
spürbar werden.<br />
mit einer gemeinschaftlichen Lösung möglicherweise bessere und insbesondere<br />
wirtschaftlichere Lösungen machbar wären.<br />
Hierbei muss nicht die kommunale Selbstverwaltung und Eigenständigkeit untergraben oder<br />
aufgegeben werden. Vielmehr bleibt bei dieser Lösung die Einflussnahme innerhalb der<br />
Solidargemeinschaft erhalten und zusätzliche Synergien und Potenziale werden<br />
erschlossen, die dem Einzelnen wiederum Freiräume in den übrigen Handlungsfeldern<br />
schaffen.<br />
Es bieten sich eine Reihe von kommunalen Handlungsfeldern an, die durchaus nach dem<br />
Vorbild der Wasserverbände in NRW organisiert werden könnten. Zum Beispiel der gesamte<br />
Bereich des öffentlichen Verkehrs einschließlich Straßenbau, Bildungseinrichtungen und -<br />
konzepte, Industrieentwicklung und -förderung, Kultur- und Tourismusangebote…<br />
Eine Idee, die es wert ist, aufgegriffen und weiterentwickelt zu werden.<br />
16