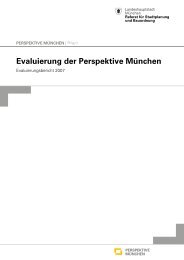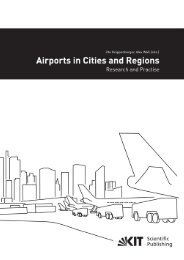Initiativkreis Europäische Metropolregion München
Initiativkreis Europäische Metropolregion München
Initiativkreis Europäische Metropolregion München
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Expertise zum Aufbau eines <strong>Initiativkreis</strong>es <strong>Europäische</strong> <strong>Metropolregion</strong> <strong>München</strong><br />
Mülldeponien, abmildern helfen. In den 1960er Jahren entwickelt vor allem nördlich der Elbe um<br />
Hamburg herum ein Gürtel wirtschaftsstarker Gemeinden. Aus dem Belastungseffekt entsteht<br />
eher ein Austauschsystem. Die Kooperationsfelder liegen nun im Bereich des Aufbaus einer<br />
gemeinsamen Infrastruktur wie zum Beispiel die S- und U-Bahn für Stadt und Umland.<br />
1990 scheitern Bemühungen um einen Nordstaat. Auch second-best Lösungen, wie der im<br />
Scharpf-Gutachten vorgeschlagene Regionalverband können sich nicht durchsetzten. Die<br />
Kommunen und Kreise im Umland lehnen jegliche formale Institutionalisierung auf regionaler<br />
Ebene ab. Zu einer ersten Stufe der Intensivierung der Zusammenarbeit kommt es schließlich<br />
unter der Initiative der Länder mit der Ausweitung der Kooperation auf die Kommunen und der<br />
Ergänzung der staatlichen Landesplanung um den Ansatz der Regionalentwicklung. 1991<br />
beschlossen die Regierungschefs von Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, ein<br />
Regionales Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Trotz massiver Einzelkonflikte zwischen Stadt<br />
und Umland während dieser Zeit gelang es, in interministeriellen Arbeitsgruppen bis zum Jahr<br />
1994 ein Leitbild und ein Orientierungsrahmen zu verfassen und 1996 ein erstes REK zu<br />
präsentieren (Blatter 2004). Dieses wurde prämiert mit dem 1. Preis im Wettbewerb „Regionen<br />
der Zukunft“. Begleitend wurde 1996 die trilaterale Landesplanung eingeführt.<br />
In dem überarbeiteten REK 2000 werden die raumordnerischen Themen der Zusammenarbeit<br />
von Stadt und Umland um strukturpolitische Fragen wie regionale Wirtschaftsentwicklung,<br />
Bildung und Wissenschaft ergänzt. Seit 2001 gibt es ein gemeinsames Regionalmarketing mit<br />
einem Logo und einer Geschäftsstelle der <strong>Metropolregion</strong> (Knieling 2006).<br />
Die Strukturen der <strong>Metropolregion</strong> werden von verschiedenen Akteuren vor allem aus der<br />
Verwaltung und Politik zunehmend als nicht mehr zeitgemäß betrachtet. Die Organisationen<br />
erscheinen als schwerfällig und nicht schlagkräftig genug (Güss, Schwieger 2006). Die<br />
Reorganisation der <strong>Metropolregion</strong> von 2005/2006 mit einem neuen Staatsvertrag und einem<br />
Verwaltungsabkommen bedeutet eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit in der<br />
<strong>Metropolregion</strong>, in der die Kreise, Städte und Gemeinden nun formal Mitträger sind. Die<br />
Prinzipien des Konsens und der freiwilligen Mitwirkung der regionalen Aufgabenträger bleiben<br />
aber unverändert (Freie und Hansestadt Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein<br />
2005b).<br />
Bedeutung des Labels <strong>Metropolregion</strong><br />
Insgesamt lässt sich eine Kontinuität in der Zusammenarbeit feststellen. Die Bemühungen um<br />
Kooperationen unter dem Label <strong>Metropolregion</strong> entwickeln sich in einzelnen Schritten. Anfang<br />
der 1990er Jahre ist das Zusammenarbeiten auf dem metropolitanen Maßstab als eine Antwort<br />
auf das Scheitern des Nordstaats zu verstehen. Dabei gewinnen auch andere Themenfelder in<br />
der Kooperation zunehmend an Bedeutung. Mit der Einführung eines gemeinsamen<br />
Regionalmarketings 2001 wird das Label <strong>Metropolregion</strong> auch mit einer Marke offensiv<br />
kommuniziert. Seit 2002 gibt es zum Beispiel einen regelmäßigen Newsletter der<br />
<strong>Metropolregion</strong>. Die Bedeutung des Labels <strong>Metropolregion</strong> kann einerseits verstanden werden<br />
als Antwort auf ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit der Positionierung im<br />
internationalen Standortwettbewerb. Anderseits könnte man es aber auch verstehen als<br />
Katalysator in einem regionalen Lernprozess, in dem sich dieses Bewusstsein anlässlich dieses<br />
Labels immer stärker herausbildet. So wären dann auch die Reorganisation der <strong>Metropolregion</strong><br />
und die Fokussierung und Neuausrichtung der Themenfelder in den Jahren 2005/06 zu<br />
erklären.<br />
110