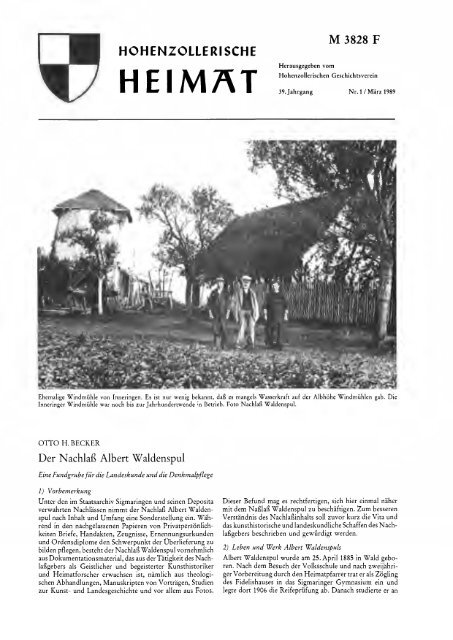Ausgabe 1989 - Hohenzollerischer Geschichtsverein
Ausgabe 1989 - Hohenzollerischer Geschichtsverein
Ausgabe 1989 - Hohenzollerischer Geschichtsverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HÖH ENZOLLERISCHE<br />
HEIMAT<br />
Herausgegeben vom<br />
M 3828 F<br />
Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
39. Jahrgang Nr. 1 / März <strong>1989</strong><br />
Ehemalige Windmühle von Inneringen. Es ist nur wenig bekannt, daß es mangels Wasserkraft auf der Albhöhe Windmühlen gab. Die<br />
Inneringer Windmühle war noch bis zur Jahrhundertwende 'n Betrieb. Foto Nachlaß Waldenspul.<br />
OTTO H. BECKER<br />
Der Nachlaß Albert Waldenspul<br />
Eine Fundgrube für die Landeskunde und die Denkmalpflege<br />
1) Vorbemerkung<br />
Unter den im Staatsarchiv Sigmaringen und seinen Deposita<br />
verwahrten Nachlässen nimmt der Nachlaß Albert Waldenspul<br />
nach Inhalt und Umfang eine Sonderstellung ein. Während<br />
in den nachgelassenen Papieren von Privatpersönlichkeiten<br />
Briefe, Handakten, Zeugnisse, Ernennungsurkunden<br />
und Ordensdiplome den Schwerpunkt der Überlieferung zu<br />
bilden pflegen, besteht der Nachlaß Waldenspul vornehmlich<br />
aus Dokumentationsmaterial, das aus der Tätigkeit des Nachlaßgebers<br />
als Geistlicher und begeisterter Kunsthistoriker<br />
und Heimatforscher erwachsen ist, nämlich aus theologischen<br />
Abhandlungen, Manuskripten von Vorträgen, Studien<br />
zur Kunst- und Landesgeschichte und vor allem aus Fotos.<br />
Dieser Befund mag es rechtfertigen, sich hier einmal näher<br />
mit dem Naßlaß Waldenspul zu beschäftigen. Zum besseren<br />
Verständnis des Nachlaßinhalts soll zuvor kurz die Vita und<br />
das kunsthistorische und landeskundliche Schaffen des Nachlaßgebers<br />
beschrieben und gewürdigt werden.<br />
2) Leben und Werk Albert Waldenspuls<br />
Albert Waldenspul wurde am 25. April 1885 in Wald geboren.<br />
Nach dem Besuch der Volksschule und nach zweijähriger<br />
Vorbereitung durch den Heimatpfarrer trat er als Zögling<br />
des Fidelishauses in das Sigmaringer Gymnasium ein und<br />
legte dort 1906 die Reifeprüfung ab. Danach studierte er an
der Universität Freiburg i.Br. Theologie und nebenbei auch<br />
Kunstgeschichte.<br />
Nach dem Empfang der Priesterweihe am 6. Juli 1910 in<br />
St. Peter im Schwarzwald war er zunächst zwei Jahre lang als<br />
Vikar in Hechingen tätig. Sein weiterer beruflicher Lebensweg<br />
führte ihn 1912 nach Veringendorf, wo er zunächst noch<br />
als Vikar, ab 1914 als Pfarrverweser wirkte. Als Pfarrer wurde<br />
Waldenspul 1920 nach Gruol und 1936 nach Imnau berufen.<br />
Von 1943 bis zu seiner Pensionierung 1961 wirkte Waldenspul<br />
als Pfarrer in Melchingen. Dort lebte er auch bis zu<br />
seinem Tod am 22. Februar 1979.<br />
Die Gemeinde Melchingen verlieh ihrem langjährigen und<br />
hoch verdienten Seelsorger anläßlich seines Goldenen Priesterjubiläums<br />
1960 das Ehrenbürgerrecht. Pfarrer Waldenspul<br />
war es auch noch vergönnt, kurz nach seinem<br />
90. Geburtstagdas Eiserne Priesterjubiläum begehenzu dürfen.<br />
Neben seinen seelsorgerischen Aufgaben, die er nie vernachlässigte,<br />
widmete sich Pfarrer Waldenspul zeitlebens mit<br />
Passion der Erforschung der Geschichte und der Kunstgeschichte<br />
seiner hohenzollerischen Heimat. Bereits als Vikar in<br />
Veringendorf trat er dem Verein für Geschichte und Altertumskunde<br />
in Hohenzollern, aus dem 1934 der Verein für<br />
Geschichte, Kultur- und Landeskunde Hohenzollerns in<br />
Sigmaringen und 1965 schließlich der Hohenzollerische<br />
<strong>Geschichtsverein</strong> hervorging, als Mitglied bei. Die Erstlingsfrucht<br />
seiner heimatkundlichen Forschungen war die Herausgabe<br />
des Seelbuchs des Klosters Wald von 1505, das in den<br />
Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde<br />
in Hohenzollern 52 (1918/19) veröffentlicht wurde.<br />
1934 wurde Waldenspul in den wissenschaftlichen Ausschuß<br />
des Vereins für Geschichte, Kultur- und Landeskunde<br />
Hohenzollerns in Sigmaringen berufen. Anläßlich seiner<br />
50jährigen Mitgliedschaft ernannte der <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Pfarrer Albert Waldenspul zum Ehrenmitglied.<br />
Von zentraler Bedeutung für das wissenschaftliche Schaffen<br />
Waldenspuls war seine Mitarbeit im Institut von Prof. Weise<br />
in Tübingen, die er gleichfalls während seiner Vikarszeit in<br />
Veringendorf aufnahm. Prof. Weise hatte sich vor allem die<br />
Erforschung der gotischen Plastik in Schwaben zum Ziel<br />
gesetzt. Albert Waldenspul begann, mit seiner Plattenkamera<br />
die Zeugnisse der gotischen Plastik im Laucherttal und dann<br />
in den benachbarten Orten auf der Alb festzuhalten. Aus<br />
dieser Dokumentations- und Forschertätigkeit sind die<br />
Anfänge zu seiner umfangreichen Fotosammlung, die unten<br />
noch näher beschrieben und charakterisiert werden soll, und<br />
die Monographie »Die gotische Holzplastik des Laucherttales<br />
in Hohenzollern«, die als Heft 2 der Forschungen zur<br />
Kunstgeschichte Schwabens und des Oberrheins, Tübingen<br />
1923, publiziert wurde, erwachsen.<br />
Den Erstlingswerken sind in den folgenden Jahrzehnten eine<br />
Fülle von Beiträgen in Sammelwerken, wissenschaftlichen<br />
Zeitschriften und Zeitungen gefolgt, über 70 an der Zahl. Als<br />
wohl wichtigste Arbeiten darunter sollen hier genannt werden:<br />
die kunstgeschichtlichen Beschreibungen der Orte des<br />
ehemaligen Oberamts Haigerloch in den von W. Genzmer<br />
herausgegebenen »Kunstdenkmäler Hohenzollerns, Bd. 1:<br />
Kreis Hechingen«, Hechingen 1939, und seine Aufsätze in<br />
der Festschrift »200 Jahre Pfarrkirche St. Stephan in Melchingen<br />
1769-1969«, [Melchingen] 1969. Noch als 88jähriger<br />
veröffentlichte Albert Waldenspul in der Hohenz. Heimat 23<br />
(1973) den Aufsatz »Kunde von der Burren-Burg bei Wald<br />
(Hohenzollern)«.<br />
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Kunst<br />
kam schließlich auch den einzelnen Kirchenbaumaßnahmen<br />
zugute, die Albert Waldenspul als Geistlicher zu übernehmen<br />
2<br />
hatte, so den Neubau der Veringendorfer Filialkirche in<br />
Hochberg, die Renovierung der Pfarrkirche und der Friedhofskapelle<br />
in Gruol und schließlich auch die gelungene<br />
Restaurierung der spätbarocken Pfarrkirche zu Melchingen.<br />
Populär wurde Pfarrer Waldenspul jedoch vor allem durch<br />
seine zahlreichen Lichtbildervorträge über Themen zur<br />
Geschichte und Hohenzollerns, in welchen er es mit volkstümlichen<br />
Worten verstand, den Zuhörern die Schönheit der<br />
heimischen Kunst und der Geschichte näherzubringen.<br />
Die Tätigkeit Waldenspuls als Seelsorger, Kunsthistoriker<br />
und Heimatforscher fand allgemein Anerkennung. Persönlichen<br />
Ehrungen und beruflichen Erfolgen stand er jedoch stets<br />
distanziert gegenüber. Er wollte vielmehr ein einfacher Landpfarrer<br />
sein und bleiben. So lehnte er das Angebot von Prof.<br />
Weise, bei ihm zu promovieren, ebenso ab wie die angebotene<br />
Anstellung als geistlicher Studienrat im höheren Schuldienst<br />
und die Berufung zum Fürstl. Fürstenbergischen Hofkaplan<br />
in Heiligenberg.<br />
3) Übernahme und Erschließung der Nachlaßteile<br />
a) Die Zeitungsausschnittesammlung<br />
Auf Ansuchen des damaligen Staatsarchivdirektors Dr. Gregor<br />
Richter überließ Pfarrer Waldenspul 1975 dem Staatsarchiv<br />
Sigmaringen seine Zeitungsausschnittesammlung zur<br />
Verwahrung. Die Ablieferung, die als Bestand N (Nachlässe)<br />
53 gelagert wurde, bestand aus 60 Heften mit eingeklebten<br />
Zeitungsausschnitten aus den Jahren 1913 bis 1975 und vier<br />
Heften Register, jeweils eines für die vier von dem Nachlaßgeber<br />
gebildeten Betreffserien »Beiträge zur heimatlichen<br />
Kunstgeschichte und Kunstfragen«, »Nachrichten betr. Personen<br />
in oder aus Hohenzollern und Umgebung« und »Beiträge<br />
von Pfarrer Waldenspul zur Geschichte von Hohenzollern<br />
und Umgebung«. Die Akzession umfaßte 0,60 lfd. m<br />
Schriftgut.<br />
Bei der anschließenden Inventarisierung behielt der Bearbeiter,<br />
Amtsrat J. Adam, die Ordnung des Nachlaßgebers bei<br />
und numerierte die Hefte mit fortlaufenden arabischen Zahlen<br />
durch, wobei die sogen. Register den jeweils zugehörigen<br />
Heften vorangestellt wurden. Um den Zugriff zu den einzelnen<br />
Beiträgen rasch zu erleichtern, erstellte der Bearbeiter<br />
einen differenzierten Orts-, Personen- und Sachindex.<br />
b) Die Fotosammlung und sonstige persönliche Papiere Waldenspuls<br />
Die weiteren Bemühungen des Staatsarchivs Sigmaringen,<br />
Pfarrer Waldenspul zur Abgabe von weiteren Teilen seines<br />
Nachlasses zu bewegen, blieben erfolglos. In seinem Testament<br />
vom 26. September 1978 ordnete er jedoch an: »Meine<br />
Fotoplatten, die Fotos sowie die Lichtbilder aus meinen<br />
kunstgeschichtlichen Arbeiten soll der Hohenzollerische<br />
<strong>Geschichtsverein</strong> für sein Archiv erhalten.«<br />
Im Mai 1979 wurden die besagten Unterlagen und weitere<br />
Materialien aus dem Nachlaß Waldenspuls, wie sich später<br />
herausstellte, von einem Beauftragten des Staatsarchivs Sigmaringen<br />
in Melchingen abgeholt und dem Archiv des<br />
Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s einverleibt, das satzungsgemäß<br />
im Depositum Fürstl. Hohenz. Haus- und<br />
Domänenarchiv des Staatsarchivs verwahrt wird. Durch dieses<br />
Verfahren wurde der Nachlaß Waldenspul zerrissen und<br />
zwei verschiedenen Eigentümern zugewiesen, ein Mißstand,<br />
der durch die gemeinsame Verwaltung der beiden Archive<br />
freilich abgemildert wird. Für die Lagerung dieser Akzession<br />
wurden insgesamt ca. 1,40 lfd. m Regalmeter benötigt, wobei<br />
die einzelnen Holzkästen und Pappkartons mit den Fotos<br />
und Fotoplatten in den Gefachen gestapelt werden konnten.<br />
Bei der 1983 von dem Verf. und seinen Mitarbeitern in
Fnedhof von Inneringen ca. 1920. Im Vordergrund die große Hüle, die später als Löschwasserteich und zeitweilig als Schwimmbad verwendet<br />
wurde. Foto Nachlaß Waldenspul.<br />
Angriff genommenen Inventarisierung dieser Archivalienabgabe<br />
wurden zunächst drei Nachlaßteile gebildet: I. Diapositive,<br />
II. Persönliche Papiere und sonstiges Sammlungsgut und<br />
III. Fotos.<br />
Die vorgefundene Ordnung und der Erschließungsgrad des<br />
I. Teils der Akzession erwiesen sich als geradezu vorbildlich.<br />
Pfarrer Waldenspul hatte die insgesamt ca. 1120 Dias<br />
(schwarz-weiß) wohl zum Zwecke seiner zahlreichen Lichtbildervorträge<br />
thematisch in 44 mit fortlaufenden römischen<br />
Zahlen und mit Betreffen versehenen Holzkästen bzw. Pappkartons<br />
verwahrt. Den Kästen lagen jeweils Verzeichnisse der<br />
darin befindlichen Dias bei.<br />
Eine Neuordnung war somit unnötig. Bei der Abfassung des<br />
Repertoriums, das Frau G. Huber übernahm, genügte es, die<br />
Nummern und die Sachbetreffe der einzelnen Kästen zu<br />
übernehmen und die Dias durchzunumerieren. Abschließend<br />
wurde ein Ortsindex erstellt.<br />
Nach einem vom Verf. erarbeiteten Ordnungsschema mit den<br />
Gruppen »Verzeichnisse«, »Vortragsmanuskripte, Ausarbeitungen<br />
und Exzerpte«, »Geistliche Betrachtungen«, »Druckwerke«<br />
und »Alben« verzeichnete 1986 Frau U. Neuendorff<br />
den II. Teil dieser Archivalienablieferung. Sie enthält insgesamt<br />
42 Einheiten und umfaßt 0,40 lfd. m Dokumentationsgut.<br />
Die Teil III der Akzession zugewiesenen Fotos sind allesamt<br />
auf Pappe aufgezogen und wurden von Pfarrer Waldenspul in<br />
eigens dafür hergestellten Pappkartons verwahrt. Bei der<br />
Inventarisierung, die ebenfalls Frau U. Neuendorff übernahm,<br />
wurden die einzelnen Kartons mit römischen Zahlen<br />
versehen und die darin befindlichen Fotos jeweils mit lfd.<br />
arabischen Zahlen durchnumeriert. Bei der Verzeichnung<br />
wurden in der Regel auch die informativen Dorsualvermerke<br />
Waldenspuls übernommen. Fotos, die vom Nachlaßgeber<br />
nicht erläutert worden sind, wurden anhand von W. Genz-<br />
mer, Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns, 2 Bde., Hechingen-Stuttgart<br />
1939-1948, und J. Braun, Tracht und Attribute<br />
der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943, zu<br />
identifizieren gesucht. In Zweifelsfällen wurden die erschlossenen<br />
Abbildungen mit Fragezeichen versehen.<br />
Nach der Verzeichnung und Reinschrift der Titelaufnahmen<br />
erstellte die Bearbeiterin einen Ortsindex. Da ein erheblicher<br />
Teil der Fotos Abbildungen von Heiligenfiguren darstellt,<br />
wurde außerdem ein Index Sanctorum erarbeitet. - Dieser<br />
Teilbestand umfaßt ca. 0,73 lfd. m und enthält 539 Fotos.<br />
4) Bewertung des Nachlasses Waldenspul<br />
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der Nachlaß<br />
Waldenspul eine Quelle par excellence für die Kunst- und<br />
Landesgeschichte Hohenzollerns und darüber hinaus darstellt.<br />
Dieser Befund darf auch für die als Bestand N 53 des<br />
Staatsarchivs Sigmaringen verwahrte Zeitungsausschnittesammlung<br />
gelten. Die Dokumentation läßt nicht nur Rück-<br />
Pfarrer Johann Adam Kraus 85 Jahre<br />
Am 18. März <strong>1989</strong> beging Herr Pfarrer Johann Adam<br />
Kraus, Erzbischöflicher Archivar i. R., in geistiger und<br />
körperlicher Frische seinen 85. Geburtstag. Der Hohenzollerische<br />
<strong>Geschichtsverein</strong> und die »Hohenzollerische<br />
Heimat« überbrachten dem Jubilar ihre<br />
Glückwünsche.<br />
Die »Hohenzollerische Heimat« möchte sich an dieser<br />
Stelle herzlich bedanken für die vielen hundert Beiträge<br />
und die großen materiellen Zuwendungen. In der<br />
nächsten Nummer werden wir eine ausführliche Würdigung<br />
der Person und des Lebenswerkes von Herrn<br />
Pfarrer Kraus bringen.<br />
3
schlüsse auf die Persönlichkeit, die Interessen und die<br />
Arbeitsweise des verdienten Heimatforschers Albert Waldenspul<br />
zu, sondern bietet auch eine Fülle von bibliographischen<br />
Nachweisen zur Landesgeschichte Hohenzollerns und<br />
der angrenzenden württembergischen Gebiete, die man selbst<br />
in der ausgezeichneten Bibliographie der Hohenzollerischen<br />
Geschichte (= Zeitschrift für Hohenz. Geschichte 11/12,<br />
1974/1975) von W. Bernhardt und R. Seigel vergeblich sucht.<br />
Die Sammlung gewährt überdies den raschen Zugriff auf<br />
Literatur, die andernfalls in einer Vielzahl von Zeitungen<br />
mühsam zusammengesucht werden müßte.<br />
Die positive Beurteilung muß in noch größerem Maße für den<br />
II. Teil des im Archiv des Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s<br />
verwahrten Nachlaßteil gelten. Diese Dokumentation<br />
enthält neben Büchern, Abschriften wissenschaftlicher Aufsätze<br />
und Manuskripte Waldenspuls zu Vorträgen u.a. über<br />
Themen zur Geschichte und Kunstgeschichte Hohenzollerns,<br />
Italiens, Roms und über deutsche und niederländische<br />
Maler aus den Jahren 1928 bis 1948, Ausarbeitungen Waldenspuls<br />
über die Geschichte der Pfarrei Owingen und der Orte<br />
Veringendorf, Hochberg und Wald, die als Unikate von<br />
unschätzbarem Wert sind.<br />
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die in diesem Teil des<br />
Nachlasses verwahrten geistlichen Betrachtungen mit Ausführungen<br />
Waldenspuls über verschiedene theologische Themen<br />
aus den Jahren 1912 bis 1948, Gedanken über Zusprüche<br />
im Beichtstuhl aus den Jahren 1942 bis 1948, eine Sammlung<br />
verschiedener Gebete sowie ein Verkündbuch der Kirchengemeinde<br />
Melchingen von 1977 bis Februar 1979, in denen der<br />
Theologe und Pfarrer Waldenspul Gestalt annimmt.<br />
Auch die als III. Teil des Nachlasses formierte Fotosammlung<br />
stellt mit den insgesamt 539 Reproduktionen eine Sammlung<br />
von außerordentlichem Dokumentationswert dar. Sie enthält<br />
vor allem Fotos von Prof. Weise, Tübingen, Pfarrer Waldenspul,<br />
Pfarrer Pfeffer, Lautlingen, Maler Steinle, Sigmaringen,<br />
und P. Weber. Den Schwerpunkt dieser Dokumentation<br />
bilden Ablichtungen von sakralen Plastiken, Sakralbauten,<br />
Innenansichten von Kirchen, Kapellen und Synagogen in<br />
Hohenzollern und Württemberg. Daneben werden auch<br />
Ansichten von Profanbauten, Brunnen, Wappen und Straßenansichten<br />
geboten. Die Entstehung der meisten Aufnahmen<br />
datiert aus den Jahren von 1919 bis 1930. Die jüngsten<br />
Fotos, die 1961 von Rektor Otto Werner, Hechingen, aufgenommen<br />
wurden, sind Melchingen gewidmet.<br />
Als wichtigster Bestandteil des Nachlasses ist jedoch die 1120<br />
Lichtbilder umfassende Diapositivsammlung (Teil I) anzusehen.<br />
Die Dokumentation, die den kunsthistorischen Forschungen<br />
und der regen Vortragstätigkeit Pfarrer Waldenspuls<br />
erwachsen ist, dürfte - es fehlen im Nachlaß genaue<br />
Angaben - zum überwiegenden Teil zwischen 1912, dem<br />
Beginn seiner Mitarbeit am Institut von Prof. Weise, und<br />
1940 entstanden sein.<br />
Sie enthält vornehmlich Abbildungen zur Kunstgeschichte<br />
Hohenzollerns und der angrenzenden württembergischen<br />
Gebiete, aber auch Italiens und des vorderen Orients.<br />
Obgleich Ablichtungen von Objekten der sakralen Kunst wie<br />
Klöster, Kirchen, Kapellen, Heiligenfiguren, Altäre, liturgische<br />
Geräte dabei überwiegen, hat der Fotograf Waldenspul<br />
die profane Kunst und das Alltägliche keineswegs vernachlässigt.<br />
Die Sammlung weist eine ganze Reihe von Stadt- und<br />
Dorfansichten, Abbildungen von Profanbauten wie Burgen,<br />
Schlössern, Rathäusern, Bürger- und Bauernhäusern sowie<br />
idyllischen Plätzen und Winkeln, aber auch Landschaftsaufnahmen<br />
auf. Ein Kasten enthält Blumenaufnahmen von<br />
Pfarrer Waldenspul.<br />
Den in den Teilen I und II verwahrten Bilddokumenten muß<br />
4<br />
im Hinblick auf die Qualität und auch die Quantität der<br />
Lichtbilder ein außerordentlich hoher Dokumentationswert<br />
zugesprochen werden. Die Sammlung vermag auf eine Fülle<br />
von kunsthistorischen und heimatkundlichen Fragen Antwort<br />
zu geben; eine Vielzahl der Fotos ist auch für Illustrationszwecke<br />
geeignet.<br />
Schon die rasche Durchsicht der Sammlung macht deutlich,<br />
welche Veränderungen in jüngster Vergangenheit die Landschaft,<br />
die Städte und Gemeinden erfahren haben, und welche<br />
Verluste an Kulturgütern durch Unverständnis, Nachlässigkeit,<br />
Bau- und Sanierungswut in den vergangenen Jahrzehnten<br />
eingetreten sind. Als Beispiel für letzteres mag im Rahmen<br />
des Beitrags das Lichtbild von der inzwischen vom Erdboden<br />
verschwundenen Windmühle in Inneringen und vom Portal<br />
des Großbayer-Hauses in Haigerloch stehen, das heute einen<br />
völlig veränderten Türsturz aufweist. Die Lichtbildersammlung<br />
Albert Waldenspuls darf somit zurecht als eine Fundgrube<br />
für die Landeskunde und die Denkmalpflege gelten.<br />
Um dem Verfall und einem möglichen Verlust der Fotoplatten<br />
im Teil I der Sammlung vorzubeugen, wurden wenigstens<br />
die Lichtbilder mit Motiven aus dem Bereich von Baden-<br />
Württemberg in den Jahren von 1984 bis 1987 im Hauptstaatsarchiv<br />
Stuttgart sicherungsverfilmt und gleichzeitig für<br />
das Staatsarchiv Sigmaringen Abzüge (Positive) hergestellt.<br />
Diese Fotos, 831 an der Zahl, wurden in der Zwischenzeit in<br />
insgesamt acht großformatige Alben eingeklebt, signiert und<br />
beschriftet und damit der Benutzung zugänglich gemacht.<br />
Durch dieses Verfahren wurde überdies die Anfertigung von<br />
Reproduktionen erleichtert. Die Sicherungsverfilmung von<br />
Teilen der Fotosammlung Waldenspuls (Teil III) ist geplant.<br />
5) Schlußbemerkung<br />
Der im Staatsarchiv bzw. im Archiv des Hohenzollerischen<br />
<strong>Geschichtsverein</strong>s verwahrte Nachlaß stellt trotz seines<br />
imponierenden Umfangs und Inhalts nur ein Torso dessen<br />
dar, was Pfarrer Waldenspul an Papieren und sonstigem<br />
Sammlungsgut hinterlassen hat. Besonders schmerzlich muß<br />
empfunden werden, daß in dem vorliegenden Nachlaß Briefe<br />
und auch Tagebuchaufzeichnungen fehlen. Möglicherweise<br />
befinden sich solche Dokumente noch im Besitz von Verwandten<br />
und Freunden des Nachlaßgebers, die hiermit aufgefordert<br />
werden, diese selbst oder doch wenigstens Kopien<br />
davon dem Nachlaß Albert Waldenspul zum Nutzen der<br />
Kunst- und Landesgeschichte Hohenzollerns zuzuführen.<br />
Archivrepertorien:<br />
Nachlaß Waldenspul (Zeitungsausschnitte), bearb. von J.Adam,<br />
Masch., Sigmaringen 1978<br />
Nachlaß Albert Waldenspul, Teil I: Diapositive, bearb. von G. Huber,<br />
Masch., Sigmaringen 1983<br />
Dgl., Teil II: Persönliche Papiere und sonstiges Sammlungsgut,<br />
bearb. von U. Neuendorff, Masch., Sigmaringen 1986<br />
Dgl., Teil III: Fotosammlung, bearb. von U. Neuendorff, Masch.,<br />
1986<br />
Literaturnachweise:<br />
E.Hösch, Pfarrer Albert Waldenspul zum 90. Geburtstag, in:<br />
Hohenz. Heimat 25 (1975), S.29.<br />
Den., Zum Tod von H. H. Pfarrer Albert Waldenspul, in: Hohenz.<br />
Heimat 29 (1978), S. 13.<br />
E.Keller, Waldenspul, Albert [Nachruf], in: Freiburger Diözesanarchiv<br />
102 (1982), S.215f.<br />
Abbildungsnachweise:<br />
Vorlagen:<br />
Friedhof Inneringen, StAS Dep. 39 NL Waldenspul III K. I, Nr. 39<br />
Windmühle Inneringen, ebda. Nr. 40
WILFRIED SCHÖNTAG<br />
Der Wald Weithart und die Weithartgenossenschaft<br />
Um 1520 stritten sich die Abtei Salem und die Untertanen in<br />
Magenbuch mit den übrigen Weithart-Anstößern, den Städten<br />
Pfullendorf und Mengen und einigen Dörfern, darüber,<br />
ob die Magenbucher berechtigt seien, ihre Schweine zur<br />
Mästung in den Weithart zu treiben. Die Pfullendorfer hatten<br />
1521 die im Wald befindlichen Schweine der Magenbucher<br />
kurzerhand gepfändet, worauf hin zwei Gerichtsverhandlungen<br />
darüber stattfanden. Warum so ein Aufwand wegen ein<br />
paar Schweinen?<br />
Ein anderes Beispiel. In diesen Jahrzehnten schwelte ein Streit<br />
zwischen den Grafen von Sigmaringen und den Truchsessen<br />
von Waldburg als Inhaber der Herrschaft Scheer über das<br />
große Waidwerk im Sigmaringer Forst. Hierbei ging es vor<br />
allem um die Jagd auf Großwild, auf Bären und Wildschweine.<br />
Die Sigmaringer Grafen konnten durchsetzen, daß<br />
ihnen die Jagd auf Bären und Schweine im »Huserhart«, wie<br />
der Weithart damals auch genannt wurde, allein vorbehalten<br />
blieb. 1439 und 1443 waren hierüber Gerichtsurteile ergangen.<br />
Der Streit brach immer wieder auf und wurde 1601 vor<br />
dem Reichskammergericht endgültig beigelegt. Noch 1702 ist<br />
von der Bärenhatz in diesem Forst die Rede.<br />
Was ist das für ein Wald, in dem Schweine und Vieh auf die<br />
Weide getrieben werden, und in dem gleichzeitig Bären und<br />
Wölfe hausen? Wir kennen den Wald heute nur noch als<br />
Fläche für die Holzproduktion, in dem auch noch Wild lebt.<br />
In den letzten Jahren ist der Erholungsaspekt hinzugekommen.<br />
In den vergangenen Jahrhunderten hatte der Wald<br />
jedoch eine weiter gespannte Funktion. Er war für die<br />
Bewohner einer Gegend von großer wirtschaftlicher Bedeutung.<br />
Daher wollen wir uns am Beispiel des Waldes Weithart<br />
mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten<br />
eines Waldes befassen.<br />
Die zwei eingangs geschilderten Ereignisse aus der<br />
Geschichte des Weithart stehen für zwei Sphären. Der Wald<br />
als bäuerliche Nutzfläche und der Wald als Forst, d.h. als<br />
Hoheitsgebiet und Rechtsbezirk.<br />
Der Weitbart als Teil des Sigmaringer Forstes<br />
Im Mittelalter gab es eine Rangfolge von Hoheitsrechten.<br />
Genannt seien die hohe Gerichtsbarkeit, das Steuerrecht, das<br />
Recht, Reisige und Söldner auszuheben, das Recht, Burgen<br />
und Befestigungen erbauen zu dürfen, das Recht, Münzen zu<br />
prägen, und nicht zuletzt das Forstrecht. Wer seit dem<br />
Spätmittelalter alle die Rechte, die vom Reich verliehen<br />
wurden, in seiner Hand vereinigte, der war ein Landesherr,<br />
der in einem abgegrenzten Territorium herrschte.<br />
Für die Herrschaftsbildung hatten die Forstrechte eine große<br />
Bedeutung, da sie sich immer auf mehr oder weniger genau<br />
umschriebene Gebiete bezogen. Wir müssen uns in Erinnerung<br />
rufen, daß sich in früheren Jahrhunderten die Verteilung<br />
von Wald und Feld schnell und weiträumig verändern<br />
konnte. Ein Forst erfaßte daher Waldflächen, aber auch die<br />
dazwischenliegenden Feldfluren und Dörfer. Ein Forst war<br />
ein abgegrenzter Bezirk, in dem der Inhaber bei Strafe<br />
gebieten und verbieten konnte. Diese Befugnis bezog sich auf<br />
die Holznutzung, die Jagd, aber auch auf die Sicherheit der<br />
Personen, die sich in einem Forst aufhielten. Der Inhaber<br />
übte das Geleitrecht aus. Seine Reisigen begleiteten die<br />
durchreisenden Personen bis zur Landesgrenze und waren<br />
für deren Sicherheit verantwortlich. In unserem Falle hieß<br />
dies, daß die Leute der Grafen von Sigmaringen die Reisenden<br />
in Pfullendorf in Empfang nahmen und diese durch den<br />
Weithart nach Norden geleiteten. Das Geleitrecht war also<br />
ein wesentliches Kennzeichen für einen Forst.<br />
Weiterhin übten die Grafen von Sigmaringen den Wildbann<br />
aus. Sie entschieden, wer die Jagd auf Großwild ausüben<br />
dürfe und wer zur Niederjagd auf Hasen, Rebhühner usw.<br />
zugelassen würde. Die Jagd auf das Großwild behielt sich der<br />
Graf wie überall selbst vor. Die hohe Jagd insgesamt war ja<br />
ein Zeichen für hohen Rang der sie ausübenden Person.<br />
Der Inhaber eines Forstes übte zumeist auch die hohe<br />
Gerichtsbarkeit aus. Vergehen über einer gewissen Schadenshöhe<br />
oder Vergehen, bei denen Blut geflossen war, unterlagen<br />
dem Hochgericht. Kleinere Vergehen strafte der Niedergerichtsherr.<br />
Die Forstherrschaft nahm also Ordnungsfunktionen und<br />
hoheitliche Rechte wahr. Daher ist es nicht verwunderlich,<br />
daß in unserem Raum die Forste bei der Bildung von<br />
Territorien eine besondere Rolle spielten. Als K. Friedrich<br />
III. im Jahr 1460 die Herrschaft Sigmaringen zu einer<br />
Grafschaft erhob, legte er für den Umfang der neuen Grafschaft<br />
die alten Forstgrenzen zugrunde, innerhalb derer die<br />
Herren ja schon seit langer Zeit gewisse Hoheitsrechte ausgeübt<br />
hatten. Die vielen Streitigkeiten mit den Nachbarn rührten<br />
daher, daß die Grafen lange Zeit benötigten, diesen Raum<br />
mit realer Herrschaft auszufüllen und ältere Rechte der<br />
Nachbarn zurückzudrängen.<br />
Der große Wald Weithart bildete im Süden des Sigmaringer<br />
Forstes eine geschlossene Fläche, dessen Hoheitsrechte nie<br />
angefochten wurden.<br />
Interessant ist, daß die Grafschaftsgrenzen im äußersten<br />
Süden direkt vor den Toren der Reichsstadt Pfullendorf<br />
verliefen. Pfullendorf hatte als Reichsstadt ein eigenes Territorium,<br />
das aber sehr klein war und im wesentlichen aus dem<br />
Gebiet innerhalb der Stadtmauern bestand. Daher war die<br />
Stadt bestrebt, diese Grenze nach Norden hin zu verschieben,<br />
um Ausdehnungsmöglichkeiten zu erhalten. Über 100 Jahre<br />
wurde daher über die Grenze zur Grafschaft Sigmaringen<br />
gestritten.<br />
Andererseits gehörte die Stadt Pfullendorf zu den Weithartanstößern,<br />
d.h. zu dem Personenkreis, der im Sigmaringer<br />
Forst Holzrechte und Trieb und Trattberechtigungen besaß.<br />
Hier zeigen sich Rechtsüberschneidungen, wie wir sie im<br />
Mittelalter und in der frühen Neuzeit immer wieder finden.<br />
Die Rechte als Anstößer deuten auf alte Beziehungen von<br />
Pfullendorf zum Sigmaringer Forst, die nicht durch die<br />
Erhebung zur Stadt und die daraufhin einsetzende rechtliche<br />
und hoheitliche Sonderentwicklung beseitigt worden sind.<br />
In Erinnerung ist auch zu rufen, daß in dem der Zisterzienserabtei<br />
Salem unterstehenden Amt Ostrach, das sich östlich des<br />
Weithart erstreckte, zunächst die Herren, dann Grafen von<br />
Sigmaringen die hohe Obrigkeit ausübten. Im Jahr 1611<br />
verpfändeten die Grafen von Sigmaringen der Abtei Salem die<br />
hohe, forstliche und geleitliche Obrigkeit. 1700 bzw. endgültig<br />
1715 ging die Grafengewalt im Amt Ostrach ganz an die<br />
Abtei über. Sigmaringen verfügte hier über keinerlei Rechte<br />
mehr. Auch hier werden wir sehen, daß die salemischen<br />
Dörfer, die an den Weithart anstießen, zu den Nutzungsberechtigten<br />
gehörten.<br />
Die Grafen von Sigmaringen verwalteten den Weithart von<br />
Sigmaringen aus. Hier saß der Jägermeister. Im Schloß in<br />
Sigmaringen waren auch der Büchsenmeister und die Jäger<br />
zuhause. In Habstal saß ein Forstknecht, zeitweilig auch im<br />
Schloß Krauchenwies.<br />
5
Die Weithartgenossenschaft<br />
Von der hohen Obrigkeit, dem Geleit und den Jagdrechten ist<br />
die niedere Gerichtsbarkeit und noch mehr das Eigentum und<br />
die Nutzung abzusetzen und zu unterscheiden. Beim Weithart<br />
nahmen die Anstößer diese Rechte wahr. Als sich die<br />
Nutzungsberechtigten 1522 über die Aufnahme von Magenbuch<br />
in ihren Kreis einigten, waren die Grafen von Sigmaringen<br />
in keiner Weise beteiligt. Ja, ein Sigmaringer Beamter<br />
schrieb sogar auf eine übersandte Abschrift des Rezesses:<br />
»Dieser Vertrag geht Sigmaringen nichts an...« Die Anstößer<br />
des Weithart regelten ihre Angelegenheiten allein, da sie auch<br />
die Eigentümer des Waldes waren. Ohne daß der Zeitpunkt<br />
der Erwerbung festzustellen ist, läßt sich dieser Zustand ab<br />
dem 16.Jahrhundert belegen. 1568 und 1591 traten die<br />
Anstößer als Eigentümer des Waldes und als Niedergerichtsherren<br />
auf, die auch die Nutzung genossenschaftlich regelten.<br />
Sie nannten sich »des Waldts Weitharts Aigenthumbs-,<br />
Grundt- und gemeine Nider Oberkeits Herren«. Sie hatten in<br />
einer Waldordnung festgelegt, in welcher Form die Beholzung<br />
und das Holzfällen, aber auch die Aufforstung zu<br />
geschehen habe und wie die Waldweide, d.h. Wunn, Waid,<br />
Trieb und Tratt, zu regeln sei. Jede beteiligte Gemeinde stellte<br />
zwei Holzschauer, die den Holzeinschlag beaufsichtigen<br />
sollten.<br />
Seit der Mitte bzw. Ende des 16.Jahrhunderts werden folgende<br />
Anstößer des Weitharts genannt: Der Abt von Salem<br />
als Territorialherr über die Dörfer Levertsweiler, Magenbuch<br />
und Lausheim sowie die Vertreter dieser Dörfer; die Stadt<br />
Pfullendorf für sich und für die pfullendorfischen Untertanen<br />
in Mottschieß; die Stadt Mengen für sich und für das Wilhelmitenkloster<br />
in Mengen; die Grafen von Sigmaringen für ihre<br />
Untertanen im Dorf Krauchenwies, für das Schloß in Krauchenwies,<br />
für Schwäbiishausen, Rulfingen, Rosna, Hausen<br />
am Andelsbach und den sigmaringischen Anteil von Mottschieß,<br />
und zuletzt das Kloster Habstal. Schwäbiishausen<br />
gehörte später zur Grafschaft Heiligenberg, die Grundherrschaft<br />
in Mottschieß ging vollständig an die Stadt Pfullendorf<br />
über.<br />
Eine übermäßige Nutzung des Waldes schädigte den Wald so<br />
stark, daß man ihn schließlich aufteilte. Dahinter stand wohl<br />
die Hoffnung, daß ein Eigentümer für seinen Wald eine<br />
stärkere Verantwortung entwickelte als eine Genossenschaft.<br />
Als 1740 die Aufteilung vorgenommen wurde, fehlten in der<br />
Liste der neuen Eigentümer das Wilhelmitenkloster in Mengen<br />
und die Gemeinde Magenbuch. Das Ausscheiden des<br />
Klosters hing möglicherweise mit der Umwandlung in ein<br />
Benediktinersubpriorat bzw. dem Verkauf an Kl. Petershausen<br />
zusammen. Bei Magenbuch ist die Sache eindeutig. 1522<br />
hatte es nur die Weiderechte erhalten, nicht aber die Holzrechte.<br />
Es war also kein vollwertiger Genosse. Da es bei der<br />
Aufteilung vor allem um die Holzrechte ging, wurde es<br />
zunächst nicht berücksichtigt. Erst später trat die Abtei Salem<br />
dem Ort Magenbuch einen Holzteil ab.<br />
Bemerkenswert bei der Aufteilung ist, daß damals die jeweiligen<br />
Herrschaften starken Anteil nahmen. Auch in den Holzund<br />
Waldordnungen, die 1740 erlassen wurden, erhielten der<br />
Sigmaringer Förster und die Holzknechte eine stärkere Aufsichtsfunktion<br />
zugewiesen. Neben das genossenschaftliche<br />
Element trat das herrschaftliche.<br />
Der Wald Weithart wurde zwar in einzelne Besitzanteile<br />
aufgelöst, er behielt aber eine geschlossene Gemarkung. Die<br />
abgegrenzten Waldteile wurden also nicht, wie sonst üblich,<br />
den Gemarkungen der neuen Eigentümer zugeschlagen. So<br />
blieb der Wald Weithart bis in den Anfang unseres Jahrhunderts<br />
eine in sich geschlossene, keiner Gemeinde zugehörende<br />
Gemarkung.<br />
6<br />
Der Wald Weithart stellt aus rechtshistorischer Sicht ein sehr<br />
interessantes Gebilde dar. Die nutzenden Parteien schlossen<br />
sich im 16. Jahrhundert zu einer Genossenschaft zusammen,<br />
die die Rechte aus dem Grundeigentum und der niederen<br />
Gerichtsbarkeit gemeinsam wahrnahmen. Die Ursprünge<br />
und die Gründe für diese Sonderentwicklung sind bisher<br />
nicht untersucht worden. Sicher kann jedoch gesagt werden,<br />
daß die Geschichte, eine Jungfrau Wild aus Riedlingen habe<br />
den Wald an die Weithart-Genossen geschenkt, eine späte<br />
Sage ist, um den Besitz der Genossen zu begründen. Man<br />
wußte damals nichts mehr über den Ursprung der Genossenschaft.<br />
Vielleicht ist der Bezug auf Riedlingen ein Hinweis<br />
darauf, daß der Wald ursprünglich den Grafen von Veringen<br />
gehört hatte. Diese hatten Ende des 13. Jahrhunderts ihren<br />
Besitz südlich der Donau an das Haus Habsburg abgetreten.<br />
Und im 16. bis 18. Jahrhundert machte das Haus Habsburg<br />
als Inhaber der Vorderösterreichischen Lande ja Ansprüche<br />
und Rechte in diesem Raum geltend.<br />
Die Waldnutzung durch die Weithartgenossenschaft<br />
1740 heißt es, daß den Genossen der Wald mit »aller Nutzbarkeit<br />
an Wohn (Wunn), Weyd, Trieb und Tratt, Beholzung<br />
und Äckerich etc.« zustehe. Im Gegensatz zum heutigen<br />
bäuerlichen Wirtschaften war bis um 1800 der Wald ein<br />
notwendiger Bestandteil der bäuerlichen Arbeits- und Nutzungssphäre.<br />
Die Alltagskultur war damals vollständig vom<br />
Holz abhängig, der Wald war für das Leben und Überleben<br />
unentbehrlich. Für den Hausbau, für Zäune, für Werkzeug<br />
und Geräte wurde Holz benötigt. Holz war weitgehend der<br />
einzige Brennstoff. Der Wald hatte ein anderes Erscheinungsbild<br />
als der heutige, der fast allein der Holzproduktion dient.<br />
Der Mischwald mit einem hohen Anteil von Laubbäumen<br />
war mit Weideplätzen durchsetzt, auf die das Vieh getrieben<br />
wurde. Das Laub wurde im Herbst gesammelt und als<br />
Laubheu im Winter an das Vieh verfüttert. Die Eicheln und<br />
Bucheckern dienten den Schweinen im Herbst als Mast. Die<br />
Linden und Obstbäume im Wald stellen eine gute Bienenweide<br />
dar. Zu erinnern ist, daß der Honig damals der gängige<br />
Süßstoff war. Für die Bauern bot der Wald ergänzende<br />
Nahrung. Hier holten sie Obst, Beeren, Pilze und Kräuter.<br />
Die gemeine Weide und der Allmendewald hatten für die<br />
bäuerliche Wirtschaft also einen hohen Stellenwert. Eine<br />
größere Tierhaltung war ohne diese Flächen nicht möglich.<br />
Der Wald war auch eine unentbehrliche Nutzungsreserve, die<br />
man vor Übergriffen Fremder wie vor Überbeanspruchung<br />
und Übernutzung schützen mußte.<br />
Man kann sich vorstellen, daß solch breitgefächerte Anforderungen<br />
an einen Wald zu großen Schädigungen führen konnten.<br />
Und daß dies so ist, zeigt die Nutzungsgeschichte des<br />
Weithart. Es ist typisch, daß 1522 der Streit um den Schweinetrieb<br />
der Magenbucher Bauern beurkundet wurde. Ende<br />
des 15. Jahrhunderts ist ein Bevölkerungswachstum und ein<br />
wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen. Wälder wurden<br />
gerodet und damit wurde die Weide, die Futterbasis für<br />
die Tierhaltung, knapp. Auf diesem Hintergrund entstanden<br />
in vielen Territorien herrschaftliche wie dörfliche Ordnungen,<br />
die die Waldnutzung regelten und den Viehauftrieb in<br />
die Wälder beschränkten. Insofern entspricht die Nutzungsgeschichte<br />
des Weithart der allgemeinen Entwicklung in<br />
Süddeutschland.<br />
Der Weithart war für die Anstößer ein Teil der Allmende, ein<br />
Wald, der gemeinschaftlich genutzt wurde. Es war eine ganz<br />
normale Sache, daß die Anlieger, damals Anstößer genannt,<br />
Weiderechte für das Vieh und die Schweine besaßen.
Als um 1520 die Gemeinde Magenbuch neue Weidegründe<br />
suchte, hatte es wahrscheinlich wieder einmal Wiesen unter<br />
den Pflug genommen. Was lag näher, als das Vieh nun in den<br />
großen Wald zu treiben? Der Protest der übrigen Nutzungsberechtigten<br />
erfolgte sofort. Dies ist ein Zeichen dafür, daß<br />
die Waldweide intensiv genutzt wurde, wenn nicht sogar<br />
schon über die Gebühr beweidet wurde. Die Abtei Salem<br />
setzte sich jedoch für die Untertanen ein und erreichte, daß<br />
die Magenbucher zumindest ein Weiderecht erhielten. Die<br />
Bewohner durften künftig 22 Schweine in den Wald treiben<br />
und gemäß der Waldordnung am Äckerricht, d.h. der Mast<br />
mit Bucheckern und Eicheln, teilnehmen. Darüber hinaus<br />
wurde ihnen erlaubt, ihr gesamtes gehörntes Vieh und die<br />
Pferde im Wald zu weiden. Wurden sie in diesem Bereich mit<br />
den anderen Anstößern gleichgestellt, so wurde ihnen jedoch<br />
verboten, Holz zu schlagen, sei es zum Brennen, Zaunherstellung,<br />
oder gar für Bauzwecke. Magenbuch wurde von der<br />
Holznutzung vollständig ausgeschlossen. Wir sehen hier, wie<br />
sich eine neue Partei in den alten Kreis der Nutzungsberechtigten<br />
drängt und schließlich neues Recht geschaffen wurde.<br />
Das Beholzungsrecht konnten die Neulinge jedoch bis 1740<br />
nicht mehr erlangen. Damals schon gab es für den Weithart<br />
eine Waldordnung und es gab Höchstgrenzen für den Viehauftrieb.<br />
Man wußte damals schon, daß das Gleichgewicht im<br />
Wald nur aufrechterhalten werden konnte, wenn die Nutzungsarten<br />
in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander<br />
standen. Wurde zuviel Vieh aufgetrieben, zerstörte dies den<br />
Jungwald und verhinderte ein Nachwachsen des Baumbestandes.<br />
Andererseits war die Viehzucht wichtig für die<br />
Fleischproduktion wie auch für die Düngerproduktion. Gab<br />
es nicht genug Dung, ließ die Fruchtbarkeit auf den Feldern<br />
nach, die sowieso gegenüber heute recht niedrig war. Die<br />
Kornernte betrug etwa das Drei- bis Fünffache des Gesäten.<br />
Der Viehtrieb im Dorf war geregelt. Ein Hirte sammelte das<br />
Vieh im Ort und trieb es auf die Weide. Abends mußte er es<br />
wieder ins Dorf oder in die Dorfnähe zurücktreiben. Hier gab<br />
es besondere Nachtweiden, die Schutz gegen wilde Tiere wie<br />
Bären und Wölfen boten.<br />
Die Schweine galten als Hauptlieferant für Fleisch. Sie wurden<br />
mit Hausabfällen ernährt und auf die Weide getrieben.<br />
Nach der herbstlichen Mast mit Bucheckern und Eicheln im<br />
Wald wurden die Schweine zumeist geschlachtet. Auch der<br />
Schweinetrieb belastete den Wald. Der Boden wurde aufgewühlt,<br />
das Jungholz geschädigt. Um eine reiche Eichelmast<br />
zu erhalten, schlugen die Hirten die Früchte mit Stangen von<br />
den Bäumen und richteten dabei teilweise großen Schaden an.<br />
Dies ist also die eine Seite des Waldes. Jedes Dorf hatte neben<br />
der Feldflur und den Wiesen auch Waldanteile, die in die<br />
bäuerliche Nutzung eng eingebunden waren. Am Rande ist<br />
hier zu erwähnen, daß die Aufteilung einer Ortsgemarkung in<br />
den Etter des Dorfes, die Ackerflur für die Dreifelderwirtschaft<br />
und die Allmende vor allem als Weidefläche eine<br />
hochmittelalterliche Erscheinungsform ist. Früher ging man<br />
davon aus, daß die Allmende eine germanische Einrichtung<br />
aus der Zeit der Landnahme sei. Vor allem die Agrar- und<br />
Siedlungsforscher haben dies widerlegt. Das, was wir heute<br />
als Dorf bezeichnen, entstand nach der Auflösung der Villikationsverfassung<br />
im 12. und 13. Jahrhundert. Damit haben<br />
wir auch einen annähernden Zeitpunkt, wann die Nutzungsgemeinschaft<br />
im Weithart entstanden sein könnte.<br />
Die andere Seite der Waldnutzung ist der Holzeinschlag. Wir<br />
hatten schon gesehen, daß die Weithart-Genossen im<br />
16. Jahrhundert auch die Verfügung über den Holzeinschlag<br />
erlangt hatten. In anderen Landschaften war dies damals ein<br />
herrschaftliches Recht. Die Obrigkeit teilte den Untertanen<br />
das Bau- und Brennholz zu. In den Beschwerdeartikeln der<br />
oberschwäbischen Bauern aus dem Jahr 1525 klagten diese<br />
z.B. darüber, daß sich die Herrschaften das Beholzungsrecht<br />
vorbehalten hätten. Da hatten es die Weithartanstößer besser.<br />
1522 bestimmten sie, daß der Kreis der Holzberechtigten<br />
nicht erweitert werde. Sie legten den Wirtschaftsplan für die<br />
Holznutzung gemeinsam fest, sie bestimmten die Termine<br />
für den gemeinschaftlichen Holzeinschlag und sie legten auch<br />
den Umfang des Einschlags fest. Seit Ende des 16. Jahrhunderts<br />
galt als Richtzahl für den Brennholzeinschlag, daß für<br />
jede Feuerstelle, d.h. für jeden Haushalt, der Genossen, zwei<br />
Klafter Holz jährlich zu schlagen seien. Ein Klafter war ein<br />
Holzstapel, der etwa 2,10 m hoch, 2,10 m lang und 1,30 m tief<br />
war. Hierzu kam die Nutzholzentnahme für Hausbau, Zäune<br />
und die Handwerker.<br />
Der Holzeinschlag richtete sich nicht nach der Leistungsfähigkeit<br />
des Waldes, sondern nach einer von außen herangetragenen<br />
Meßzahl. Dies führte zu großen Waldschäden, vor<br />
allem als die Bevölkerung und damit die Zahl der Haushalte<br />
wuchsen. Seit Ende des 16. Jahrhunderts wurde der Holzeinschlag<br />
immer stärker reglementiert, ein Zeichen dafür, daß<br />
man nicht mehr aus dem Vollen wirtschaften konnte. 1593<br />
wurde bestimmt, daß Reiser und Stöcke, die etwa einen<br />
Finger dick waren, in das Klafter gehörten und nicht etwa<br />
zum Reisigbündel. Es gab nicht mehr genügend starke<br />
Bäume, daher mußte auch das Astholz vollständig aufgemacht<br />
werden. Ausdrücklich wurde vermerkt, daß das Jungholz<br />
und Eichen nicht mehr gefällt werden dürften. Was um<br />
1593 noch zurückhaltend ausgesprochen wurde, wurde 1601<br />
drastisch geschildert. Die Weithartgenossen wie die umliegenden<br />
Herrschaften hätten mit einem intensiven Holzeinschlag<br />
den Weithart zugrunde gerichtet. Die Holzordnung<br />
wurde erneuert. An dem Grundübel, dem Brennholzbezug<br />
von 2 Klaftern, wurde jedoch nichts geändert.<br />
Die Klagen über den schlechten Zustand des Waldes hören<br />
nun nicht mehr auf. Bei einer 1699 vorgenommenen<br />
Begehung stellten die Genossen fest, daß der hohe Wildbestand<br />
wie auch der Viehtrieb den Wald stark geschädigt<br />
hätten. Die schönsten jungen Bäume würden abgehauen, um<br />
Holz für Zäune zu erhalten. Die Gerber würden die für<br />
Bauholz geeigneten Eichen und Tannen fällen, die Rinde<br />
abschälen, das Holz aber liegen lassen. Selbst die Weithartgenossen<br />
fällten dünne Bäume, machten Latten daraus und<br />
verkauften diese an Fremde. In der neugefaßten Holzordnung<br />
wurde bestimmt, daß für ein Jahr überhaupt kein Holz<br />
gefällt werden dürfe. Allein das vom Sturm umgeworfene<br />
Holz durfte aufgemacht werden. Bauholz wies die Gemeindeobrigkeit<br />
zu, Holzverkauf an Fremde wurde vollständig<br />
verboten, ebenso das Roden von Waldflächen.<br />
Als es schließlich um 1740 kaum noch starke Stämme im Wald<br />
gab, dafür jedoch um so mehr Kahlschläge und wüste Plätze,<br />
die nicht mehr aufgeforstet worden waren, befürchteten die<br />
Genossen den gänzlichen Abgang des Waldes. Nachdem man<br />
1736 die Zustimmung des Hauses Habsburg als Oberlehnsherren<br />
und des Grafen von Sigmaringen als Forstherren zu<br />
einer Aufteilung des Waldes eingeholt hatte, ging man 1740<br />
an die Separierung. Der beabsichtigte Schutz galt allein dem<br />
Baumbestand. Der Weidgang, d.h. der Viehauftrieb, wurde<br />
wie bisher beibehalten. Der Holzboden wurde dagegen aufgeteilt,<br />
so daß jeder neue Eigentümer darüber frei verfügen<br />
konnte. Die Zahl der Rauchfänge wurde als Schlüssel für die<br />
Aufteilung zugrunde gelegt. Für die 1107 Rauchfänge standen<br />
2374 Jauchert Wald zur Verfügung, von denen schon 73 J.<br />
an öden Plätzen und 18 J. für die Landstraßen abgezogen<br />
worden waren. Zusammen mit dem Aufteilungsprozeß<br />
wurde wiederum eine Holzordnung erlassen, die unter anderem<br />
vorsah, für die Aufforstung stärker als bisher zu sorgen,<br />
die den einzelnen Baum stärker schützte, und die das Roden<br />
völlig untersagte. Aber auch diese Bestimmungen konnten<br />
den Wald kaum retten. Bis 1827, als der Viehtrieb abgelöst<br />
7
wurde, wuchs kaum Holz nach, so daß damals kein geschlossener<br />
Wald mehr vorhanden war.<br />
In aller Kürze wurde den Wechselwirkungen zwischen Waldentwicklung<br />
und wirtschaftlicher Nutzung nachgegangen,<br />
die tiefgreifende Folgen für den Wald gehabt haben. Was wir<br />
HERBERT BURKARTH<br />
Die Laichinger Hungerchronik<br />
1985 erschien ein sehr schönes und reich bebildertes Buch<br />
»Die Hungerjahre 1816/17 auf der Alb und an der Donau«,<br />
herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft der Heimatmuseen<br />
im Alb-Donaukreis. Neben vielen kleineren Beiträgen<br />
aus verschiedenen Orten ist hier die »Laichinger Hungerchronik«<br />
im Wortlaut abgedruckt. Auch im Katalog der<br />
Napoleon-Ausstellung wird die Chronik erwähnt. Liest man<br />
die Beiträge in Tageszeitungen usw., die zum gleichen Thema<br />
erschienen, so wird zwar gelegentlich von örtlichen Begebenheiten<br />
berichtet, die Schilderung der allgemeinen Verhältnisse<br />
stammt aber meistens wieder aus der Laichinger Chronik.<br />
Die genannte Chronik wurde erstmals 1916 von dem Lehrer<br />
und späteren Rektor C. A. Schnerring in den »Blättern des<br />
Schwäbischen Albvereins« veröffentlicht. Im gleichen Jahr<br />
erschien sie auch in den Württembergischen Jahrbüchern für<br />
Statistik und Landeskunde und wurde damit fast zu einer<br />
amtlichen Verlautbarung.<br />
Die Laichinger Hungerchronik eine Fälschung<br />
Der Münsinger Stadtarchivar Günter Randecker hat das<br />
Verdienst, die Laichinger Hungerchronik als Fälschung<br />
erkannt zu haben. Randecker beschäftigte sich mit der<br />
Geschichte der Buttenhauser Juden. Dabei fiel ihm auf, daß<br />
das, was er in zeitgenössischen Akten fand, mit den Schilderungen<br />
der Chronik keinerlei Ähnlichkeit hat. Nach der<br />
Chronik hatten die Buttenhauser Juden den ganzen Getreidehandel<br />
auf der Alb als Monopol und waren durch ihre<br />
Preistreiberei mitschuldig an der Hungersnot von 1816/17.<br />
Randecker konnte nachweisen, daß die Juden von Buttenhausen<br />
arme Leute waren, die allenfalls einen Hausierhandel<br />
betrieben. Es gab in Buttenhausen nicht einen Getreidehändler.<br />
Randecker hält die ganze Chronik für eine Fälschung von<br />
Schnerring. Er hat seine Erkenntnisse in einer Dokumentation<br />
niedergelegt: »Die Hungerjahre 1816/17auf der Münsinger<br />
Alb«, die bei der Stadt Münsingen zu bekommen ist. Im<br />
ersten Teil findet man eine große Zahl bisher unveröffentlichter<br />
Berichte über die Hungerjahre 1816/17 auf der Münsinger<br />
Alb. Sehr interessant sind auch die Ausführungen über die<br />
Auswanderungen, welche durch die Teuerung ausgelöst wurden.<br />
Die meisten Auswanderer aus der Münsinger Gegend<br />
zogen in den Südkaukasus, um dem Heiligen Land nahe zu<br />
sein. Es spielten dabei religiöse Vorstellungen der »Stundenleute«<br />
über den 1836 drohenden Weltuntergang eine Rolle.<br />
Im zweiten Teil seiner Dokumentation setzt sich Randecker<br />
mit der »Laichinger Hungerchronik« auseinander. Nachdem<br />
er das Original der »Vergilbten Blätter« in Händen hat, bleibt<br />
von der Chronik nicht mehr viel übrig. Auch der Versuch<br />
einer »Schadensbegrenzung«, wie er von dem Volkskundler<br />
Dr. Hans Medick unternommen wurde, dürfte vergeblich<br />
sein: Die Laichinger Chronik ist eine Fälschung von Schnerring.<br />
Man fragt sich, wie kommt jemand dazu, so etwas zu<br />
machen? Schnerring gibt die Antwort selbst: »Zu meinem<br />
8<br />
heute als »Waldsterben« bezeichnen, die Furcht vor dem<br />
Abgang des Waldes wegen veränderter Umweltbedingungen,<br />
hat es früher in anderer Form also auch schon gegeben. Die<br />
Eingriffe der Menschen in die Naturlandschaft haben auch in<br />
früheren Zeiten tiefgreifende Veränderungen und Folgelasten<br />
mit sich gebracht.<br />
geschichtlichen Dorfroman >Du suchest das Land heim
verdiente er keine 24 fl im Monat. Wer hatte in Laichingen ein<br />
festes Monatsgehalt? Allenfalls der Pfarrer und der Lehrer.<br />
Beides war der Chronist wohl nicht; wer war er? Nur der<br />
Rektor Schnerring konnte so denken. Deutlichste Folge der<br />
Mißernte war die Teuerung, wie jedem zeitgenössischen<br />
Bericht zu entnehmen ist. Zur Steigerung der Dramatik<br />
benötigte der Fälscher die Wucherer, die Kornjuden. Da sein<br />
Horizont nicht weiter reichte, ernannte er die Juden von<br />
Buttenhausen dazu.<br />
Es ist das bleibende Verdienst von Randecker, die Laichinger<br />
Chronik als Fälschung erkannt zu haben. Es scheint aber zu<br />
einseitig, anzunehmen, Schnerring habe die Chronik nur<br />
verfaßt, um antisemitische Parolen zu verbreiten. Sie gar als<br />
»flammenden Aufruf« zur Judenvernichtung zu bezeichnen,<br />
Der Meister von Meßkirch hieß Jerg Ziegler<br />
Der »Meister von Meßkirch« ist eine der faszinierendsten<br />
Gestalten in der südwestdeutschen Kunstgeschichte. Schon<br />
im vorigen Jahrhundert war ein Maler der Renaissance aufgefallen,<br />
dessen überragendes Können sich deutlich von der<br />
Kunst seiner schwäbischen Zeitgenossen unterschied. Offensichtlich<br />
war er von der Dürer'schen Schule beeinflußt. Er<br />
arbeitete für die Grafen von Zimmern, die Grafen von Zollern<br />
und auch für Kirchen und Klöster. Irgendwo mußte ja sein<br />
Name in einer Urkunde auftauchen, aber nirgends fand man<br />
ihn. Mit allen möglichen bekannten Künstlern wurde er<br />
identifiziert, aber nichts stimmte.<br />
Pater Ansgar fand den Namen.<br />
1908 veröffentlichte P. Ansgar Pöllmann von Kloster Beuron<br />
eine Entdeckung, die das Problem zu lösen schien. Er<br />
behauptete, daß der Meister von Meßkirch seine Werke<br />
signiert habe und Jerg Ziegler heiße. Auf einer Benediktustafel<br />
in Stuttgart hatte er auch die Jahreszahl 1524 gefunden.<br />
Seine Angaben bewies er durch Fotografien. Doch die<br />
Fachleute, welche seine Angaben überprüfen wollten, fanden<br />
nichts. Dabei hatte er beschrieben, wie seine Aufnahmen<br />
zustande gekommen waren: Mit violettem Licht von Bogenlampen<br />
(ÜV-Licht). Diese Technik wurde damals in Beuron<br />
schon angewendet, um Palimpsesten (abgeschabte und wieder<br />
beschriebene Pergamentblätter) lesbar zu machen. Trotzdem<br />
erklärte man Pöllmanns Signaturen für Phantasiegebilde.<br />
Es wurde sogar behauptet, er habe an seinen Fotoplatten<br />
retuschiert.<br />
Falsche Meister von Meßkirch<br />
Der Karlsruher Kunsthistoriker Hans Rott bot schließlich<br />
einen neuen Namen an, den Baiinger Maler Joseph Weiß. Er<br />
schrieb, die Spukgestalt des Jerg Ziegler könne nun endgültig<br />
aus der Kunstgeschichte verschwinden. Ganz verschwand sie<br />
jedoch nicht, denn 1940 zeigt Josef Hecht aus Konstanz, daß<br />
Pöllmanns Signaturen auf mindestens drei Bildern nachweisbar<br />
sind. Außerdem hatte Johann Adam Kraus entdeckt, daß<br />
es 1548 und 1561 in Hechingen einen Hofmaler namens Jerg<br />
bzw. Jerg Ziegler gab. Seltsamerweise wurde die Arbeit von<br />
Hecht nirgends zur Kenntnis genommen. 1950 tauchte ein<br />
neuer Name auf. Christian Altgraf Salm wies auf die Möglichkeit<br />
hin, daß Peter Strüb aus Veringenstadt der Meister von<br />
Meßkirch sein könnte. In seinem Buch über die Malerfamilie<br />
Strüb bekräftigte Hans Dieter Ingenhoff 1962 die Peter<br />
Strüb-Hypothese. Die Meister-von-Meßkirch-Frage schien<br />
erneut endgültig gelöst. Allerdings gab es auch erhebliche<br />
Bedenken. Alfons Kasper warnte vor dieser völlig unhaltbaren<br />
Theorie und Johann Adam Kraus zeigte, daß Peter Strüb<br />
schon aus biographischen Gründen nicht der Meister von<br />
geht zu weit. Wahrscheinlicher ist, daß Schnerring durch die<br />
Hungersnot im 1. Weltkrieg angeregt wurde, sich mit einer<br />
historischen Hungerzeit zu befassen. Es stimmt auch nicht,<br />
daß Schnerring den Wucher der Juden als Ursache der<br />
Hungersnot bezeichnete. Er behauptet lediglich (fälschlich),<br />
die Juden hätten sich an der Not bereichert. Auch dürfte der<br />
Ausdruck »Jahrhundertfälschung« für das Schnerring'sche<br />
Elaborat etwas zu hoch gegriffen sein. Ps. In Heft 1 - <strong>1989</strong> der<br />
»Blätter des Schwäbischen Albvereins« bringt Randecker<br />
einen Aufsatz: Die »handschriftlichen Aufzeichnungen eines<br />
Aelblers über die Teuerungs- und Hungerjahre 1816/17« -<br />
eine Jahrhundertfälschung. Er zeigt mehrere Faksimile-Beispiele,<br />
welche den Charakter der Fälschung deutlich erkennen<br />
lassen.<br />
Signatur der Benediktustafel in der Staatsgalerie Stuttgart: 1524 jerg<br />
z. (nach Pöllmann)<br />
Meßkirch sein konnte. Er war in der fraglichen Zeit körperlich<br />
schon so behindert, daß er nicht einmal gehen konnte.<br />
Trotzdem stürmte man begeistert in diese Sackgasse. Am<br />
»Strübhaus« in Veringenstadt kann man selbiges heute noch<br />
nachlesen. Pfarrer Kohler aus Veringenstadt glaubte sogar,<br />
das Strübhaus auf dem Meßkircher Dreikönigsbild zu erkennen,<br />
und forderte die Stadt Meßkirch auf, dem Peter Strüb ein<br />
Denkmal zu errichten. Zum Glück waren die Meßkircher<br />
vorsichtig. Aber auch in Museen wird Peter Strüb noch als<br />
Meister von Meßkirch angeboten.<br />
Jerg Ziegler heißt er.<br />
Unter diesem Titel erschien am 4. Januar <strong>1989</strong> in der »Stuttgarter<br />
Zeitung« ein Aufsatz von Wolfgang Urban, u.a.<br />
Kunstbeauftragter der Diözese Rottenburg. Urban ist mit<br />
9
detektivischer Kleinarbeit vorgegangen und hat erneut die<br />
Angaben von Pöllmann und Hecht überprüft. Urban zitierte<br />
Goethe, das schwerste sei, zu erkennen, was vor den Augen<br />
liege. Nicht nur, daß er Pöllmanns Angaben bestätigen<br />
kohnte, er fand auch auf anderen Bildern, die dem Meister<br />
t?0\<br />
*<br />
Signatur einer verschollenen Drei-Königs-Tafel aus Hechingen (nach<br />
Hecht).<br />
von Meßkirch zugeschrieben werden, die gleichen Signaturen.<br />
Bemerkenswert ist der Thalheimer Altar im Landesmuseum<br />
Stuttgart, der erst spät dem Meister von Meßkirch<br />
zugeschrieben wurde (Ingenhoff u.a.). Hier fand Urban auf<br />
einem Stein die Signatur »jerg«. Der mittlere der Hl. Drei<br />
Könige blickt den Beschauer an; an den äußeren Enden seines<br />
Mützenbandes findet man die Zeichen I und 3 für JZ. Kein<br />
Zweifel, hier hat sich Jerg Ziegler selbst dargestellt. Wir<br />
wissen nun nicht nur, wer der Meister von Meßkirch war, wir<br />
wissen auch, wie er aussah.<br />
Alle Probleme sind noch nicht gelöst.<br />
Bisher wurde angenommen, daß der Meister von Meßkirch<br />
WOLFGANG HERMANN<br />
nach 1540 gestorben sei, weil sein Werk plötzlich abbreche.<br />
Dabei wurde nie bedacht, daß nach 1535 in Württemberg und<br />
vielen Städten und Herrschaften die Reformation eingeführt<br />
wurde. Ein Bildersturm brach los, in dem unzählige Bilder<br />
und Plastiken vernichtet wurden. Nach Urban hat Ziegler<br />
z. B. 440 Pflanzenaquarelle für den Tübinger Professor Leonhart<br />
Fuchs geschaffen. Hecht glaubte, daß Ziegler Hofmaler<br />
in Hechingen war. Es scheint also durchaus eine zweite<br />
Schaffensperiode des Meisters von Meßkirch gegeben zu<br />
haben. Zitat Urban: »Schwierigkeiten bereitet es noch, das<br />
Leben Jörg Zieglers genealogisch zu erfassen. Aber daß er der<br />
Meister von Meßkirch ist, läßt sich durch die Fülle von<br />
Belegen nachweisen.« B.<br />
Das Wasserschloß der Herren von Neuneck -<br />
die Wiederherstellung seines äußeren Bildes und seine künftige Aufgabe<br />
Im Juni 1984 hatte der Verfasser an dieser Stelle gefragt:<br />
»Rettet Sulz sein Wasserschloß?« Heute, etwa zum Erscheinen<br />
dieser Nummer der »Hohenzollerischen Heimat«, darf<br />
man sagen, daß die Renovation des Schloßäußeren abgeschlossen<br />
ist. Noch im Februar 1985 war es allen Betrachtern<br />
nicht klar, ob die Renovierung der Innenräume im laufenden<br />
Jahrzehnt möglich würde, da keine Geldgeber in Sicht waren.<br />
Mit der Errichtung eines Museums, das von den Kreisen<br />
Rottweil und Freudenstadt getragen wird, könnte dem<br />
Schloß jetzt eine neue Bedeutung zugewiesen werden.<br />
Die Außenrenovierung wurde in der Hauptsache vom Land<br />
mit ca. 2,2 Mio DM finanziell getragen. Bezüglich der<br />
Wiederherstellung der Innenräume war man sich noch 1984<br />
im Gemeinderat von Sulz weder im klaren darüber, woher die<br />
Stadt die Geldmittel nehmen sollte; auch wußten die Räte<br />
nicht, welchem Nutzungskonzept man zuneigen sollte. Erst<br />
10<br />
Selbstporträt des Jörg Ziegler auf dem Talheimer Altar (Württ. Landesmuseum<br />
Stuttgart)<br />
dann, als das regionale Bauernmuseum von Horb nach Glatt<br />
verlegt wurde, gab es auch neue Hoffnung für das Hauptgebäude.<br />
Was im Sommer 1983 noch in der Planung war, oder gar sehr<br />
in Frage stand 1 , ist jetzt verwirklicht. Die Erneuerungsarbeiten<br />
erforderten ihre Zeit; »unter Volldampf« wurde kaum<br />
gearbeitet. Zwischen 1984 und 1987 geschah dies: An der<br />
Südseite wurde die frühere Balustrade wiedererrichtet und<br />
die vermauerten Türen geöffnet, welche vom ehemaligen<br />
Rittersaal auf diese hinausführten. Die Balustrade ist über<br />
dem Gewölbe der Schloßkapelle errichtet. An derselben<br />
Front wurde der Putz erneuert, am Südwestturm eine Wappennische,<br />
ein Schießschlitz und Bemalungen um dieselben<br />
freigelegt und renoviert. Die Westfassade brachte wenig<br />
Probleme, da es bei diesen Arbeiten nur um die Wiederherstellung<br />
des Putzes ging.
Wasserschloß Glatt, Zustand Juli 1988. Foto P.T.Müller<br />
Innerhalb dieser genannten Jahre wurde der nördliche Torturm<br />
gesichert und der senkrecht verlaufende Riß im Mauerwerk<br />
beseitigt. Sein Dach wurde gerichtet, sein Verputz<br />
erneuert und in weißer Farbe gehalten. Die Ausbauchungen<br />
der steinernen Brücke über den Graben wurden aufgefangen.<br />
Ebenso machte man den Wehrgang zur inneren Hofseite hin<br />
als Fachwerkkonstruktion wieder sichtbar und deckte sein<br />
Dach frisch ein. Vier neu aufgerichtete Schornsteine mit<br />
gekröpftem Abschluß unterhalb der Kaminhauben erheben<br />
sich nun über dem Westflügel 2 .<br />
Im September 1988 machte man im Innenhof diese Entdekkungen:<br />
Es hatte zwei Nischen in der Wehrmauer gegeben,<br />
die sich hinter den zugehörigen Schießschlitzen befanden.<br />
Zwischen ihnen ist der Trogbrunnen des Innenhofes in die<br />
Wand des Wehrbaues eingefügt. Die Nischen waren zuge-<br />
mauert. Ihr Platz wurde am neu aufgebrachten Verputz<br />
angedeutet. Rechts vom Brunnen, in der zugemauerten<br />
Nische, fand sich ein mächtiger Baustein, etwa 0,90 x 0,35 m<br />
stark. In ihn ist die Jahreszahl 1547 eingehauen und der Stein<br />
trägt noch Spuren einer Abbildung des kaiserlichen Kammerherrenschlüssels.<br />
Die Vermutung darf geäußert werden, daß<br />
der Fundort des Bausteins, der einem Eckstein gleicht, nicht<br />
der ursprüngliche Verwendungsort gewesen ist.<br />
Überraschender war die Aufdeckung einer zugemauerten<br />
großen Nische über dem Portal der Kapelle. Diese war hinter<br />
der Stelle, an der man heute das große Wappen jener Eigentümer<br />
des Schlosses vorfindet, die den Herren von Neuneck<br />
folgten: Die beiden größeren Mittelwappen, Landsee und<br />
Trassberg, sind von 8 kleineren Wappen umgeben: Schilling<br />
von Cannstadt, von Rollin, Kayser, Herbst von Herbstburg,<br />
11
von Furtenbach, Papus von Trassberg, Freiherr von Landsee<br />
und Reinhold von BabenwoP. Leider läßt sich heute ohne<br />
Aktenkenntnis nicht sagen, zu welchen Demonstrationszwecken<br />
diese Nische seinerzeit eingefügt worden war.<br />
Wappen wiesen den Eigentümer aus<br />
Im Dezember 1984 wurde von einer Wappentafel berichtet' 1 ,<br />
die in der Mauer des Südostturmes gefunden wurde. Diese<br />
zeigte das Wappen derer von Hohenrechberg und bezog sich<br />
auf Magdalena von Rechberg (zweites bis letztes Drittel des<br />
16.Jahrhunderts). Der Verfasser stellte damals die Frage,<br />
warum die Tafel ohne das neuneckische Wappen gemalt war.<br />
Die Antwort gab eine aufgefundene Nische der gleichen<br />
Größe im Südwestturm. Leider fand man sie leer. Von Seiten<br />
des Architekten, Herrn Anton Beuter, wurde angenommen,<br />
daß sich an dieser Stelle das neuneckische Wappen befunden<br />
hatte. Dieses hat auf rotem Grund einen goldenen Querbalken<br />
in der Schildmitte und darüber einen Stern in Silber 5 .<br />
Eine der zahlreichen Wappenvorlagen wurde dazu verwendet,<br />
um eine Nachbildung in dieser Nische anzubringen. Es<br />
muß bemerkt werden, daß die Malereien, auf dem Putz<br />
befindlich und die Tafel umgebend, in keiner Weise auf die<br />
analogen Malereien am Südostturm abgestimmt sind. Man<br />
darf jedoch annehmen, daß zuerst die Tafeln für Hans<br />
Heinrich von Neuneck (1530-1577, fl578) und seine Frau<br />
Magdalena von Rechberg (+1614) geschaffen wurden und<br />
dann, in unterschiedlich später Zeit oder durch verschiedene<br />
Meister, die Secco-Bilder angebracht worden sind.<br />
Am nördlicherseits gelegenen Torturm wurde an seiner<br />
Frontseite eine Nische von ungefähr 150 X 100 cm Abmessung<br />
aufgefunden. Auch sie war leer. Angebracht war eine<br />
Tafel zwischen einem darüberliegenden Fenster und dem<br />
später hinzugefügten steinernen Wappenrelief des Fürstenhauses<br />
von Hohenzollern-Sigmaringen. Was die Tafel als<br />
Bildwerk trug, wissen wir nicht. Vielleicht stammte sie aus<br />
der Zeit vor dem Kloster Muri (ab 1706) und trug ein<br />
Heiligenbildnis oder auch adelige Wappen. Im Zuge der<br />
Renovierung wurde eine neue Wappentafel geschaffen, welche<br />
die Reihe der Schloßeigentümer repräsentieren soll. Es<br />
handelt sich um sechs Wappen: zwei Orts- und vier herrschaftliche<br />
Wappen. Sie sind nach diesem Schema angebracht:<br />
Adelswappen<br />
Hohenz.-Sigmaringen<br />
Adels wappen 6<br />
Neuneck<br />
Ortswappen<br />
Glatt<br />
Adelswappen<br />
Landsee<br />
Ortswappen<br />
Sulz<br />
Herrschaftswappen<br />
Kloster Muri<br />
Wappen dienten u. a. als Hauszeichen. Es ist möglich, daß<br />
Franz von Landsee nach der Übernahme der Herrschaft Glatt<br />
(1680) die Wappentafeln am Südost- und Südwestturm entfernen<br />
bzw. zumauern ließ. Dieser hatte im Anschluß an ein<br />
Verfahren vor dem Lehengericht die Herrschaft Glatt zugesprochen<br />
erhalten. Das Geschlecht der Familie von Neuneck<br />
war in ihrem Mannesstamm 1671 erloschen. In diesem Sinne<br />
ist denkbar, daß der Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen<br />
um 1806 eine eventuell vorhandene Wappentafel aus dem<br />
Torturm herausnehmen ließ, um mit dem eigenen steinernen<br />
Wappenrelief - zwei Hunde halten den Wappenschild - sein<br />
Eigentumsrecht zu dokumentieren.<br />
Bildhafte Humoresken und vielfältiges Rankenwerk<br />
Die wesentlichste Zeit der Jahre 1987/88 galt der Wiedersichtbarmachung<br />
früherer Wandbemalungen. Sie stammen<br />
nach Aussage der Restauratoren aus der Zeit der Renaissance.<br />
Zwei stilistisch völlig verschiedene Ausschmückungen, die<br />
12<br />
Fensterdekoration am Turm, Wasserschloß Glatt. Foto W. Hermann<br />
sog. Weiß- und Rotmalerei, befinden sich an den Außenwänden.<br />
Die weiße und zugleich jüngere stammt vom Ende des<br />
17.Jahrhunderts. Allein sie war am obersten Stockwerk<br />
auffindbar, an den beiden unteren Geschossen jedoch beide<br />
Arten der Bemalung. Die weiße Bemalung sei ungefähr 80<br />
Jahre nach der roten Bemalung aufgetragen worden 7 . Diese<br />
Weißmalerei besteht aus bandartigen Ornamenten, die die<br />
Fenster umrahmen. In diesem Beitrag soll die Rotbemalung<br />
der Nordtürme im Vordergrund stehen. Das teils humoristische,<br />
teils skurrile Bildprogramm 8 am nordöstlichen Rundturm<br />
umgibt acht Fenster. Diese sind in zwei Ebenen angeordnet;<br />
um je vier Fenster im Unter- und 1. Obergeschoß.<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Wolf gang Hermann, Rettet Sulz sein Wasserschloß, HH 1984,<br />
S. 20, S. 54.<br />
2<br />
Unter »kröpfen« versteht man in der Baukunst: ein Gesims oder<br />
ein Gebälk um ein vorstehendes Architekturglied (Wandpfeiler,<br />
Wandsäule, Pilaster usw.) herumführen. - Meyers Enzyklop.<br />
Lexikon, Band 14, S.396.<br />
3<br />
Kunstdenkmäler Hohenzollerns, 1896, S.82<br />
4<br />
Wolfgang Hermann, Das Wasserschloß Glatt, HH 1984, S.56<br />
5<br />
Kinder von Knobloch, Oberbad. Geschlechterbuch Bd. 3,<br />
S. 234-235<br />
6<br />
Das Wappen der Herren von Neuneck erhielt auf der Wappentafel<br />
des Torturms einen Stern in goldener Farbe; die neue Wappentafel<br />
in der Nische des runden Südwestturms zeigt ebenfalls einen<br />
goldenen Stern.<br />
7<br />
Bericht in der Südwestpresse: Fantasiefiguren unter Putz, vom<br />
21. 7. 1988, Redaktion Sulzer Chronik.<br />
8<br />
Dieses Bildprogramm wie die übrigen Wandmalereien an der<br />
Ostfassade, wurde nicht wie im Dezember 1984 vom Verfasser<br />
angegeben, der wissenschaftlichen Untersuchung zugeführt.<br />
Schluß folgt!
WALTER KEMPE<br />
Unterweilerund seine Kapelle<br />
1. Der Ort<br />
Unterweiler ist ein kleiner Ort, der zwischen Ostrach und<br />
Königseggwald am Seebach liegt. Mit Laubbach und Oberweiler<br />
gehört er seit der Kreisreform 1973/74 zur Gesamt-<br />
Gemeinde Ostrach.<br />
Die 29 Teilorte bzw. Wohnbezirke Ostrachs stammen aus<br />
verschiedenen Territorien und Verwaltungsbezirken. Die<br />
einen waren badisch, die anderen hohenzollerisch oder württembergisch.<br />
Wenn man sich die letzten 800 Jahre der wechselhaften<br />
Geschichte vor Augen führt, gehörten sie schon einmal<br />
früher, nämlich in der Zeit der Herrschaft des Klosters Salem,<br />
größtenteils zusammen und hatten gleiche Nöte und Sorgen.<br />
Oft vergessen wir bei dem Geschehen der Gegenwart, daß<br />
wir selbst mit der Kette vergangener Generationen verbunden<br />
sind. Trotz allem Wandel der Zeiten, waren unsere<br />
Vorfahren in ihrem Fühlen, Denken und Handeln uns ähnlich<br />
und standen genauso in einer Wechselbeziehung zu<br />
unserer Landschaft.<br />
Manches läßt sich nur bei Kenntnis des Vergangenen erklären.<br />
Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung des Schicksals<br />
Unterweilers, so wie Urkunden und Akten es uns erzählen.<br />
2. Die Kapelle<br />
Mitten im Ort steht eine kleine Kapelle, wie auch in Wangen<br />
oder Jettkofen. Sie wurde jetzt zum Anlaß, sich näher mit den<br />
geschichtlichen Zusammenhängen zu befassen. Bei den<br />
Gesprächen über Renovierungsarbeiten wurde festgestellt,<br />
daß weder das Alter, noch der Anlaß ihrer Errichtung, noch<br />
die Besitzverhältnisse genauer bekannt sind. Klar war bis<br />
jetzt, daß sie auf einem Gemeindegrundstück steht und die<br />
Gesamt-Gemeinde Ostrach verpflichtet ist, sie baulich zu<br />
unterhalten.<br />
Unsicherheiten bestehen, welchem Patron sie zuzuordnen<br />
ist. Zum Bewußtsein kam wieder, daß die 87 Einwohner<br />
kirchlich heute noch zu den drei verschiedenen kath. Pfarreien<br />
Hoßkirch, Königseggwald, Ostrach und den zwei<br />
Diözesen Freiburg und Rottenburg gehören.<br />
Die Antwort auf die Frage nach dem »Warum« sollen die<br />
folgenden Ausführungen, soweit möglich, geben.<br />
I. ZUR GESCHICHTE DES ORTES<br />
Auf der Suche nach den urkundlichen Spuren des Ortes<br />
Unterweiler gab es zunächst eine Schwierigkeit, die mit dem<br />
Namen zusammenhängt.<br />
1. Der Name Unterweiler<br />
Der heute noch für die Siedlungsform von mehreren Höfen<br />
verwendete Begriff Weiler, wurde zu einem Ortsnamen, der<br />
nicht nur bei uns vorkommt, sondern auch in anderen<br />
Gegenden. Das Wort stammt aus der Merowingerzeit. Es<br />
wurde erst im 7. Jahrhundert zur Ortsnamenbildung herangezogen<br />
1 .<br />
In den alten Urkunden ist die Schreibweise unterschiedlich,<br />
teils deutsch, teils lateinisch, z.B. Wiler, villare.<br />
Zusammengesetzte Formen des Namens, wie Tagebrehtswilaer<br />
= Davidschweiler = Tafertsweiler (z.B. 1246) 2 oder<br />
Burcwiler = Burgweiler (z.B. Mai 1279) 3 waren schon früh<br />
zu festen Begriffen geworden. Sie erleichtern die Lagebestim-<br />
mung und die Zuordnung von in Urkunden genannten<br />
Sachverhalten. Es sind jedoch manchmal auch hier noch<br />
neben dem Namen weitere Kriterien erforderlich, um eine<br />
sichere Identifizierung vornehmen zu können.<br />
Auch die Nennung von Ober- und Unterweiler in Verbindung<br />
mit anderen Nachbarorten hilft oft weiter. In den<br />
Anfängen wurde Unterweiler auch als Nidrenwillare (Niederweiler)<br />
bezeichnet, das jedoch von dem jüngeren Ort<br />
Niederweiler bei Wilhelmsdorf zu unterscheiden ist.<br />
Eindeutiger wird ferner die Zuordnung bei Erläuterungen<br />
wie Weiler bei Hoßkirch (Wiler prope Huskilch, 1278) 4 .<br />
Bei Zeugen oder Vertragspartnern einer Beurkundung wurde<br />
oft der Wohn- und Geburtsort zugefügt. Hier finden wir z. B.<br />
Friedrich, Schmied (fabro) von Weiler, der sowohl in Zusammenhang<br />
mit Unterweiler 1265 5 , als auch 1279 mit Burgweiler<br />
genannt wurde 6 , Heinrich von Weiler 1279 6 und Mantz<br />
von Weiler 1334 7 .<br />
Eine sichere Zuordnung ist bei Personennamen in dieser Zeit<br />
schwierig. Zumindest dürfte der Schmied Burgweiler zugehörig<br />
sein.<br />
2. Die verschiedenartigen Besitzverhältnisse<br />
Die Vielschichtigkeit der Besitz- und Rechtsverhältnisse der<br />
früheren Jahrhunderte erschwert uns heute oft das Verständnis<br />
für und den Überblick über die verschiedenen Besitzübertragungen,<br />
die in den Dokumenten festgelegt sind.<br />
Da erscheint beispielsweise der Grundherr als Eigentümer<br />
des Grund und Bodens. Er konnte in der Rechtsform der<br />
Leihe (Lehen) oder Pacht seine Höfe an andere Personen<br />
geben. Sie hatten dann nur ein Nutzungsrecht und ein stark<br />
eingeschränktes Verfügungsrecht über Hof und Land.<br />
Die Rechte, Steuern und andere Abgaben einzuziehen (z.B.<br />
Bede, Zehntrecht) und andere Verwaltungsbefugnisse in<br />
einem bestimmten Bezirk, konnten wieder von dem Grundherren<br />
oder einem Dritten wahrgenommen werden.<br />
Die hohe Gerichtsbarkeit, d.h. die Entscheidung über Leben<br />
und Tod, war dem Landesherren vorbehalten. Er war oft mit<br />
dem Grundherren identisch.<br />
Die niedere Gerichtsbarkeit, das Dorfgericht, konnte wieder<br />
in anderen Händen liegen.<br />
Das Patronatsrecht über eine Pfarrei, mit dem Vorschlagsrecht<br />
bei Einsetzung von Geistlichen, wurde oft gesondert<br />
ausgeübt. Es war auch mit der Verpflichtung zur baulichen<br />
Unterhaltung der Kirche verbunden.<br />
3. Die Weifen und das Kloster Weingarten als Besitzer<br />
Unterweilers<br />
Die Geschichte Unterweilers ist mit der des einflußreichen<br />
Geschlechts der Weifen und des Klosters Weingarten verknüpft.<br />
Stammschloß und Burg der Weifen lagen nach Vanotti auf<br />
dem Martinsberg bei Altdorf. Sie selbst nannten sich Grafen<br />
von Altdorf. Nachdem Herzog Weif III. sein Schloß und<br />
seine Burg im Jahre 1055 dem Kloster Altomünster zur<br />
Umwandlung in ein Kloster überlassen hatte, verließen die<br />
Grafen den Flecken Altdorf und zogen in die alte Veitsburg<br />
bei Ravensburg. Diesem Umstand verdankte die Stadt<br />
Ravensburg ihren Ursprung, die Vergrößerung und nachmalige<br />
Bedeutung.<br />
13
Das Benediktinerkloster auf dem Martinsberg erhielt dann<br />
seinen Namen von den Weingärten, welche den Hügel<br />
schmückten »das Kloster in den Weingärten bei Altdorf«.<br />
Später nahm auch der Flecken Altdorf den Namen »Weingarten«<br />
mit an.<br />
Während Kloster Weingarten aus dem Erbe Herzog<br />
WelfsIII. mit 22 Bauerngütern in der Umgebung bedacht<br />
wurde, soll um 1090 sein Neffe Weif IV. dem Kloster weitere<br />
Ländereien aus dem Familienbesitz geschenkt haben. Bei<br />
diesen Übertragungen blieb es nicht. Von allen Seiten erhielt<br />
Weingarten um diese Zeit Mehrungen an größeren und<br />
kleineren Stiftungen und Gütern.<br />
Der nächste Weifenherzog, WelfV., überließ aus dem verbliebenen<br />
Vermögen kurz vor seinem Tode, am 11. Juni 1190,<br />
dem Kloster u. a. noch die Dörfer Hoßkirch, Bergatreute und<br />
Weiler 8 .<br />
Der Besitz im Dorf Hoßkirch, das Kirchenpatronat und seine<br />
Liegenschaften in Weiler bei (prope) Hoßkirch, werden mit<br />
anderen Orten in einer späteren Papst-Urkunde in Zusammenhang<br />
mit dem Schutz und den Rechten des Klosters<br />
Weingarten aufgeführt 9 .<br />
Die dortige Kirche (Pfarrei) selbst, soll schon von den Stiftern<br />
dem Kloster bzw. der Abtei Weingarten übergeben worden<br />
sein 10 .<br />
So dürfte »Weiler bei Hoßkirch« mit dem 1198 genannten<br />
Ober- und Unterweiler 11 identisch sein, das jetzt zur<br />
Gesamt-Gemeinde Ostrach gehört.<br />
In Unterweiler hat heute noch die Gemeinde Hoßkirch<br />
Grundbesitz.<br />
4. Kloster Salems Besitz in Unterweiler<br />
Nicht nur Kloster Weingarten hatte Besitz in Weiler, sondern<br />
auch das Zisterzienserkloster Salem.<br />
1198 hören wir aus Rom, daß Papst Innocenz III. den Domkustos<br />
von Konstanz und den Propst von Marchtal beauftragte,<br />
gegen jene Kirchenstrafen zu verhängen, die u.a. die<br />
14<br />
Besitzungen Salems - hier Obren- und Nidrenwillare (Unterweiler)<br />
genannt - geschädigt hatten 12 .<br />
Im Jahr 1250 bestätigte dann Papst Innocenz IV. das Grundeigentum,<br />
die Rechte und die Privilegien des Klosters Salem.<br />
Hierbei erfahren wir, wo in unserer Nachbarschaft salemische<br />
Besitzungen lagen, u.a. in Ertingen, Bachhaupten,<br />
Eschendorf, Tafertsweiler, Ober- und Unterweiler 13 .<br />
15 Jahre danach hat Salem einen Teil der Güter in Unterweiler<br />
gegen Liegenschaften in Spöck eingetauscht. Sie gehörten<br />
dem uns aus Ostrach bekannten Konrad von Gundelfingen.<br />
Er war auch damals Herr in Burgweiler und hatte diese Güter<br />
Albert von Eberhardsweiler und Frau zum Lehen gegeben.<br />
Als Zeugen waren u.a. dabei: Heinrich von Ochsenbach und<br />
Friedrich, der Schmied von Weiler 14 .<br />
5. Wie Unterweiler mit den Herren von Königsegg in Verbindung<br />
kam<br />
Die getrennte Vergabe von Rechten ohne Wechsel der<br />
Grundherrschaft, wird uns 1286 vor Augen geführt. In dem<br />
Jahre übertrug (verpfändete) König Rudolf von Habsburg die<br />
Vogtei-Rechte (Schirmherrschaft) der Orte Hoßkirch und<br />
Ober- und Unterweiler an seinen Getreuen, Ulrich von<br />
Königsegg. Kloster Weingarten war und blieb Grundherr 15 .<br />
Ulrich von Königsegg übte damit die Gerichtsbarkeit aus und<br />
konnte hierüber Einfluß auf die Bewohner der Orte nehmen.<br />
Rund 240 Jahre später, 1527, erhielten die Herren von<br />
Königsegg Hoßkirch nebst Ober- und Unterweiler von<br />
Kloster Weingarten als pfandschaftlichen Besitz, dann 1535<br />
- mit Ausnahme des Patronats- und Zehntrechtes - als<br />
Eigentum 16 .<br />
Um diese Zeit bildete die Herrschaft Königsegg das Amt<br />
»Wald« und ernannte einen Oberamtmann mit Sitz in Unterweiler.<br />
Zwischen 1554 und 1565 war Oberamtmann Sebastian<br />
Bosch tätig. Er siegelte auch Urkunden, die Salem betrafen<br />
Bosch wohnte vermutlich auf dem Hof mit der ehemaligen
Haus-Nummer3. Der Familienname Bosch war noch 1811<br />
und später in Unterweiler vertreten 18 .<br />
Das sogenannte Hochgericht - mit der Entscheidung über<br />
Leben und Tod - war für verschiedene Teile der Herrschaft<br />
Königsegg, u. a. für einige Felder von Ober- und Unterweiler,<br />
noch in Händen des Reichstruchsessen von Friedberg-<br />
Scheer. Er verzichtete dann 1746, nach längerem Streit, zu<br />
Gunsten von Königsegg-Aulendorf 19 . Wie uns im Urbar der<br />
Pfarrei Ostrach aus dem Jahre 1593 berichtet wird, war<br />
Unterweiler selbst dem Nieder- und Hochgericht der Herren<br />
von Königsegg-Aulendorf unterstellt 20 .<br />
Auf der beigefügten Karte von 1703 sind die Grenzen des<br />
»Hohen Obrigkeits-Bezirks« eingezeichnet. Der Kommentar<br />
auf der rechten Seite des Bildes beschreibt die Grenzen des<br />
Bezirks im Jahre 1584.<br />
6. Die großen politischen Veränderungen in unserer Gegend<br />
nach 1806<br />
Revolutionen und Kriege gingen der napoleonischen »Flurbereinigung«<br />
zwischen 1803 und 1806 voraus. Sie brachte bei<br />
uns einschneidende politische Veränderungen. Mit der Auflösung<br />
der Klöster, wie Salem und Weingarten und der<br />
Aufteilung ihres Besitzes, sowie der Abtretung großer Teile<br />
Vorderösterreichs, kamen neue Herren.<br />
Das salemische Oberamt Ostrach wurde zunächst Besitz des<br />
Fürsten von Thum und Taxis. Es wurde dann der Landeshoheit<br />
des Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen unterstellt.<br />
Saulgau, Hoßkirch, Königseggwald, Laubbach, Ober- und<br />
Unterweiler und Jettkofen wurden dagegen dem Königreich<br />
Württemberg zugeschlagen.<br />
Nach Beendigung der Umorganisation lautete die amtliche<br />
Bezeichnung für Unterweiler: Donaukreis (Ulm), Königliches<br />
Oberamtsgericht Saulgau, Königliches Bezirksamt<br />
Aulendorf, Gemeinde Laupbach, Parzelle Unterweiler 21 .<br />
1811 zählte man in Unterweiler 14 Höfe, die folgende<br />
Familien bewirtschafteten: Sauter, Neil, Irmler, Gebhardt,<br />
Kohler. Scholter, Schmid, Bumüller, Bosch, Nassal, Lang,<br />
Buchbesprechung<br />
Karl Werner Steim:<br />
Die Synagoge in Haigerloch. Haigerloch 1988<br />
Schon mehrfach hat Karl Werner Steim von der Geschichte<br />
und dem Alltag der Juden in Haigerloch berichtet, hat<br />
Eindrücke und Ansichten vom »Haag«, dem erst Ende des<br />
18.Jahrhunderts entstandenen Dorfghetto, geliefert. Deutlich<br />
getrennt von der christlichen Haigerlocher Bürgerschaft<br />
und um die Synagoge als augenfälligem Mittelpunkt zentriert,<br />
behielt das Judenviertel im »Haag«, auch nachdem aus nur<br />
geduldeten, auf fürstliche Privilegien angewiesenen »Schutzjuden«<br />
endlich spät im 19. Jahrhundert gleichberechtigte<br />
Staatsbürger geworden waren, seinen eigenen, durch jüdische<br />
Kultur und Tradition geprägten Charakter. Gerade deshalb<br />
wurde auch der »Haag« in der Nacht zum 10. November<br />
1938, der sogenannten »Reichskristallnach«, zum Ziel eines<br />
aus Sulz herangeschafften SA-Trupps, der hier, wie es auch<br />
gleichzeitig überall in Deutschland geschah, durch seinen<br />
unbehinderten Vandalismus deutlich machte, daß die Natio-<br />
Gruber, Sedelmayer, Haller. Die ersten 5 Höfe gehörten »seit<br />
mehr als 500 Jahren« zur Pfarrei Ostrach 22 .<br />
Nach der alten Beschreibung der Pfarrei Ostrach von 1593,<br />
lebten hier um 1590: Hans Nefenburg, Hans Bosch, Balthus<br />
Binder, Peter Knäbler und Martin Stokher. Zwei Höfe waren<br />
damals Soldgüter 23 (siehe auch Anlagen 1 und 2)<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Bach, Adolf: Deutsche Namenskunde, Deutsche Ortsnamen 2,<br />
S. 361, § 604.<br />
2<br />
CDS, Bd. I, S. 267.<br />
5<br />
CDS, Bd. II, S. 217.<br />
4<br />
Wü UB VIII, S. 123.<br />
5<br />
CDS, Bd. I, S. 460.<br />
6<br />
CDS, Bd. II, S. 224.<br />
7<br />
CDS, Bd. III, S. 266.<br />
8<br />
Vanotti, J. N.: Beiträge zur Geschichte der Orden in der Diözese<br />
Rottenburg, FDA18, S. 292 ff.<br />
9 Wie Anm. 4.<br />
10 Memminger: Beschreibung des Oberamtes Saulgau, Cotta, Stutt-<br />
gart und Tübingen. 1829, S. 226.<br />
11<br />
CDS, Bd. I, S. 89.<br />
12<br />
Wie Anm. 11.<br />
15<br />
CDS, Bd. I, S. 290/291.<br />
14<br />
Wie Anm. 5.<br />
15<br />
Wü UB IX, S. 92.<br />
16<br />
Wie Anm. 10.<br />
17<br />
StA Sigmaringen, Dep.30, Kloster Salem, OA Ostrach, Urkunden,<br />
Repert. Schwarzmaier, Ho 158, Kloster Salem, Herrschaft<br />
Ostrach, Urkunden, Repert. Herberhold<br />
18<br />
Kath. Pfarrarchiv Ostrach, Zehntablösung (Hohenzollerische<br />
Lande), Beschreibung der kath. Filialen Jettkofen, Laubbach und<br />
Unterweiler, welche zu Ostrach eingepfarrt sind und im<br />
Königreich Württemberg liegen, samt einer Beilage vom 7.1.1811.<br />
19<br />
StA Sigmaringen, Dep.30, Urkunden-Repertorium über das<br />
Friedberg-Scheersche Archiv, 1786, Bd. 1, S. 280, Nr. 11.<br />
20<br />
Kath. Pfarrarchiv, Urbar des Pfarrers Georg Weiß von 1593.<br />
21<br />
Gemeindearchiv Ostrach, Abt. Laubbach »Concept des Güterund<br />
Servitutenbuchs«, Laubbach-Unterweiler, angelegt 1840/47.<br />
22<br />
Wie Anm. 18.<br />
25 Wie Anm. 20.<br />
Schluß folgt!<br />
nalsozialisten in Zukunft ihre bislang, aus außen- und innenpolitischen<br />
Rücksichten diktierte, relative Zurückhaltung<br />
aufgeben würden und den nächsten Schritt von der sozialen<br />
Diskriminierung der Juden hin zu ihrer physischen Vernichtung<br />
zu tun entschlossen waren.<br />
Karl Werner Steim rekonstruierte für Haigerloch die Ereignisse<br />
in dieser Nacht. Von der schon damals für die meisten<br />
erkennbar allzu fadenscheinigen propagandistischen Darstellung<br />
von dem spontanen »Sühneakt des deutschen Volkes«<br />
für die Ermordung eines Botschaftsangehörigen in Paris<br />
durch einen polnischen Juden findet sich auch in Haigerloch<br />
keine Spur. Der Pogrom in Haigerloch, bei dem die<br />
Fensterscheiben der Häuser im »Haag« zu Bruch gingen, die<br />
Einrichtung der Synagoge verwüstet und der Rabbinatsverweser<br />
mißhandelt wurden, war eine organisierte Aktion, die<br />
15
Verlag: <strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Karlstraße 3, 7480 Sigmaringen<br />
M 3828 F<br />
Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt.<br />
deutlich - trotz des »Räuberzivils« der Gewalttäter - den<br />
Stempel der SA trug. Es wundert daher nicht, daß der vom<br />
jüdischen Kaufmann Reutlinger herbeigerufene Haigerlocher<br />
Gendarm sich schnell und ohne einzugreifen wieder davonmachte.<br />
Der sofort informierte Landrat glaubte, anscheinend<br />
in völliger Fehleinschätzung der Vorgänge, den Staatsanwalt<br />
informieren zu müssen.<br />
Freilich legten sich bald erste Irritationen der lokalen Verwaltung<br />
und Polizei - auch der Regierungspräsident war über die<br />
geplanten Aktionen nicht informiert -, wie man mit den<br />
tumultarischen Vorgängen umzugehen hatte, nachdem sie<br />
von der Gestapo mit der Verhaftung von fünfzehn Haigerlocherjuden<br />
beauftragt wurden, die man sofort ins KZ Dachau<br />
weiterleitete. Auch in Haigerloch wird deutlich, daß die<br />
vermeintliche Spontaneität der Ausschreitungen kalkuliert<br />
war und man in Berlin keineswegs daran dachte, sich das<br />
Gesetz des Handelns von der Straße diktieren zu lassen.<br />
Nicht nur, daß sofort alle sichtbaren Spuren der Verwüstung<br />
Register 1988<br />
beseitigt werden sollten; jetzt durfte und mußte die Polizei<br />
verstärkt zur Verhinderung weiterer Aktionen eingesetzt<br />
werden. Und wirklich verhinderte die Gendarmerie in Haigerloch<br />
eine nachträgliche Brandstiftung an der in der<br />
Pogromnacht zwar im Innern verwüsteten, jedoch nicht<br />
niedergebrannten Synagoge.<br />
Für viele Haigerlocher Juden war seit dem 10. November<br />
klar, daß in dieser Nacht mehr zu Bruch gegangen war als nur<br />
die Fensterscheiben im »Haag«. Viele, die bislang noch<br />
gezögert hatten, entschlossen sich jetzt zur Ausreise. Die<br />
Zurückbleibenden wurden 1941/42 deportiert und ermordet.<br />
Mit der Zerstörung des religiösen, kulturellen und gesellschaftlichen<br />
Mittelpunktes der Juden, der Synagoge, wurde<br />
auch in Haigerloch deutlich gemacht, daß es für die Levis,<br />
Behrs und Ulimanns das einst von Fürst Karl Friedrich<br />
zugestandene Heimatrecht im »Haag« nicht mehr gab. In<br />
dem Gebäude, das am 30. Mai 1783 feierlich als Synagoge<br />
eingeweiht wurde, ist bis heute nicht mehr gebetet worden.<br />
Klaus Peter Burkarth<br />
Allerlei Bei- oder Nebennamen S. 47 Hechingen: Sebastiansbruderschaft S. 18<br />
Archiv des Füsilierregiments S. 63 Heimatglocken S. 46<br />
Beuron: Augustinerchorherrenstift S. 57 Hirtenbrief und NS-Polizei S. 14<br />
Bilder: Johanna von Berselle S. 33 Hungerjahre 1816/1817 S. 54<br />
Hechingen: Hl. Sebastian S. 17 Hungerjahre 1816/1817in Gammertingen S. 55<br />
Orchester des Gymnasiums Hedingen S. 1 Kaufhold, Monsignore: Zum 80. Geburtstag S. 35<br />
Buchbesprechungen: Kettenacker: Tischlesrücker S. 2<br />
Das Große Buch der Schw. Alb S. 64 Kraus, Johann Adam: 60. Priesterjubiläum S. 15<br />
Felsen, Burgen, Rittersleut S. 48 Meister von Meßkirch: Frauenportrait S. 34<br />
Museen u. Galerien zw. Neckar u. Bodensee S. 16 Meister von Meßkirch: Portrait Eitelfriedrichs S. 61<br />
Oberschwaben S. 32 Medaille Christof Friedrichs Graf zu Zollern S. 23<br />
Romanik in Baden-Württemberg S. 15 v. Neuneck, Reinhard S. 9,24,64<br />
Vorgesch. Höhensiedlungen S. 15 Pommern: Fürstl. Hohenz. Besitzungen S. 49<br />
Burladingen: Käpfle S. 53 Ringingen: s'Hairles Luschtgaata S. 31<br />
Dettensee, fürstlicher Kameralhof S. 44 Sigmaringen: Depotfund der Bronzezeit S. 6<br />
Grynaeus, Simon: Münzbildnis S. 37 Sigmaringer Turnerbund 1848 S. 41<br />
Haigerlocher Ehrenbürger im 19. Jahrhundert S. 28 Trochtelfinger Heidegg-Burg S. 13,32<br />
Haigerloch: Judenpogrom 1938 S. 38 Verbote und Strafen in der »Guten alten Zeit« S. 56<br />
Hechingen: Fasnachtstanz in St. Luzen S. 19 Wiedendrehen S. 32<br />
Hechingen: Der Schultheis und seine Frau, die Hexe S. 34<br />
HOHENZOLLERISCHE HEIMAT<br />
hrsggbn. vom Hohenz. <strong>Geschichtsverein</strong>.<br />
Die Zeitschrift »Hohenzollerische Heimat«<br />
ist eine heimatkundliche Zeitschrift. Sie will<br />
besonders die Bevölkerung in Hohenzollern<br />
und der angrenzenden Landesteile mit der<br />
Geschichte ihrer Heimat vertraut machen. Sie<br />
bringt neben fachhistorischen auch populär<br />
gehaltene Beiträge.<br />
Bezugspreis: 8.00 DM jährlich.<br />
Konto der »Hohenzollerischen Heimat«:.<br />
803843 Hohenz. Landesbank Sigmaringen<br />
(BLZ 653510 50).<br />
Druck:<br />
M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co.,<br />
7480 Sigmaringen, Karlstraße 10.<br />
16<br />
Die Autoren dieser Nummer:<br />
Dr. Otto H. Becker<br />
Hedingerstraße 17, 7480 Sigmaringen<br />
Dr. Herbert Burkarth<br />
Eichertstraße 6, 7487 Gammertingen<br />
Klaus Peter Burkarth<br />
Reutlinger Straße 7, 7487 Gammertingen<br />
Wolfgang Hermann<br />
Fischingerstraße 55, 7247 Sulz<br />
Walter Kempe, Apotheker<br />
Silcherstraße 11, 7965 Ostrach<br />
Dr. Wilfried Schöntag,<br />
Staatsarchivdirektor<br />
Karlstraße 3, 7480 Sigmaringen<br />
Schriftleitung:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth,<br />
7487 Gammertingen Telefon 07574/4211<br />
Die mit Namen versehenen Artikel geben die<br />
persönliche Meinung der Verfasser wieder;<br />
diese zeichnen für den Inhalt der Beiträge<br />
verantwortlich. Mitteilungen der Schriftleitung<br />
sind als solche gekennzeichnet.<br />
Manuskripte und Besprechungsexemplare<br />
werden an die Adresse des Schriftleiters erbeten.<br />
Wir bitten unsere Leser, die »Hohenzollerische<br />
Heimat« weiter zu empfehlen.
Herausgegeben vom<br />
M 3828 F<br />
Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
39. Jahrgang Nr. 2 / Juni <strong>1989</strong><br />
Pfarrer Johann Adam Kraus, Erzbischöflicher Archivar i.R., Nestor der Hohenzollerischen Geschichtsschreibung,<br />
am 18. März <strong>1989</strong>, seinem 85. Geburtstag, in Freiburg (Foto: H. Burkarth)<br />
EBERHARD GÖNNER<br />
Johann Adam Kraus 85 Jahre alt<br />
HOHENZOLLERISCHE<br />
HEIMAT<br />
Wer sich mit hohenzollerischer Geschichte befaßt, stößt in<br />
der Literatur auf Schritt und Tritt auf Veröffentlichungen von<br />
Pfarrer Johann Adam Kraus. Im Register der Bibliographie<br />
der Hohenzollerischen Geschichte (1974/75) hat kein anderer<br />
Autor eine längere Nummernliste aufzuweisen. Für die Jahre<br />
nach 1972 findet diese Liste eine Fortsetzung in den Bänden<br />
der Landesbibliographie Baden-Württemberg. Der Jubilar<br />
selbst hat für die Zeit von 1924 bis 1988 833 Artikel gezählt.
In seinem Gesamtwerk nehmen die ortsgeschichtlichen<br />
Abhandlungen, Miszellen, Mitteilungen und Hinweise den<br />
größten Raum ein. Es gibt wohl nur wenige Orte in Hohenzollern,<br />
zu deren Geschichte J.A. Kraus nichts beigetragen<br />
hat. Uber die Ortsgeschichte kam er zur Burgen- und Adelsgeschichte,<br />
zur Familien- und Namensgeschichte, zu rechtsgeschichtlichen<br />
Fragen und zur Volkskunde. Die zeitliche<br />
Spanne seiner Forschungen reicht von der Römerzeit bis ins<br />
20. Jahrhundert.<br />
Hinter der Lebensleistung von J.A. Kraus stecken ein schon<br />
früh erwachtes elementares historisches Interesse, eine große<br />
Neugier nach vergangenen Zuständen, Ereignissen und Personen<br />
und - nicht zuletzt - eine tiefe Heimatliebe. Die ersten<br />
heimatgeschichtlichen Forschungen des am 18. März 1904 in<br />
Ringingen/Hohenzollern Geborenen beginnen noch während<br />
seiner Gymnasial- und Konviktszeit in Sigmaringen.<br />
Kurz nach seiner Reifeprüfung im Jahre 1923 edierte er als<br />
Theologiestudent in den »Mitteilungen des Vereins für<br />
Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern« (1924) die<br />
Ringinger Gemeindeordnung vom Jahre 1530, das sogenannte<br />
»Fleckenbüchle«. Inzwischen war er dem hohenzollerischen<br />
<strong>Geschichtsverein</strong> beigetreten, in dem er zu einem<br />
besonders eifrigen Mitglied wurde.<br />
Die Forschungsgegenstände hängen bei Johann Adam Kraus<br />
zu einem großen Teil mit seiner Biographie zusammen.<br />
Seinem Heimatort, dessen Herrschaftsträgern, Kirchengeschichte,<br />
Familien, Häusern, Flurnamen, galten im Laufe der<br />
Jahrzehnte unzählige kleinere und größere Aufsätze, darunter<br />
die umfassende Darstellung in den Hohenzollerischen<br />
Jahresheften 1960-1962. Auch mit der Geschichte der<br />
benachbarten Orte Melchingen, Salmendingen, Stetten u. H.,<br />
Hörschwag und Trochtelfingen hat er sich wiederholt befaßt.<br />
Nachdem er im Jahre 1928 zum Priester geweiht und<br />
zunächst in drei badischen Pfarreien als Vikar eingesetzt<br />
worden war, nutzte er seine Vikarszeit in Burladingen von<br />
1931 bis 1936 zu heimatgeschichtlichen Forschungen über<br />
Orte und den Adel im Fehla- und im Killertal. Der Verfasser<br />
dieser Zeilen erinnert sich noch gut, wie bei ihm schon als<br />
Kind die Veröffentlichungen von J.A. Kraus über die Burgen<br />
in diesen beiden Tälern sein historisches Interesse weckten.<br />
Nach der Versetzung in die Pfarrei Bingen (1936) und dann<br />
als Pfarrverweser (1937) bzw. Pfarrer (1938-1941) in Dietershofen<br />
weitete der junge Geistliche sein Forschungsfeld<br />
auf die südlicheren Gemeinden Hohenzollerns aus. Die Nähe<br />
zu Sigmaringen ermöglichte ihm die Benutzung der hohenzollerischen<br />
Archive und damit den Zugang zu den wichtigsten<br />
Quellen der hohenzollerischen Geschichte.<br />
Seit 1942 im Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg tätig,<br />
wurde Pfarrer Kraus 1943 zum Militärdienst als Sanitäter<br />
eingezogen und geriet 1944 in amerikanische Gefangenschaft.<br />
Im Jahre 1946 konnte er seinen Dienst in Freiburg wieder<br />
aufnehmen und verblieb dort als Registrator und als Erzbi-<br />
JOHANN ADAM KRAUS<br />
Zur Geschichte eines Hofes in Ringingen (Hs. Nr. 98/99)<br />
»Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit!« Nachdem im Jahre<br />
1938 unser Mitbürger J. Viesel im Gäßle anstelle seiner<br />
bisherigen Scheuer eine neue, geräumigere erstellt hat, der<br />
auch bald ein neues Wohnhaus (»Ghäusget«) folgt, reizt es<br />
uns, einen Blick auf die früheren Besitzer und Verhältnisse<br />
dieses Grundstücks zu werfen. Es handelt sich nämlich um<br />
eines der ältesten Häuser des Dorfes, um einen Lehenhof der<br />
Herrschaft, bei denen gewöhnlich, wie hier, Wohnhaus und<br />
Scheuer getrennt voneinander, und zwar nach Möglichkeit im<br />
18<br />
schöflicher Archivar bis zu seiner Zurruhesetzung am<br />
1. Januar 1966. Diese zwanzig Jahre waren seine Hauptschaffenszeit<br />
als Heimatforscher. Nach wie vor stand die hohenzollerische<br />
Geschichte bei ihm im Vordergrund, wobei ihn<br />
die Beschäftigung mit den Beständen des erzbischöflichen<br />
Archivs in verstärktem Maße zu kirchengeschichtlichen<br />
Arbeiten führte. Die Ergebnisse seines Forschens veröffentlichte<br />
er vorzugsweise in der seit 1951 bestehenden, von ihm<br />
auch finanziell unterstützten Hohenzollerischen Heimat, in<br />
den Hohenzollerischen Jahresheften bzw. der Zeitschrift für<br />
Hohenzollerische Geschichte, im Freiburger Diözesan-<br />
Archiv, in Tageszeitungen und in Heimatblättern. Sein südbadischer<br />
Wohnsitz und die ihm dort zur Verfügung stehenden<br />
Quellen ließen ihn die heimatgeschichtlichen Aktivitäten<br />
auch auf Südbaden ausdehnen.<br />
Gerne befaßte er sich mit ungelösten Fragen und regte die<br />
Forschung immer wieder mit neuen Lösungsvorschlägen an.<br />
Als Beispiele sollen hier nur seine Beiträge zur Frühgeschichte<br />
der Grafen von Gammertingen und der Grafen von<br />
Sigmaringen, zur Geschichte der Herrschaft Straßberg, zur<br />
Freien Pirsch, zur Lage der Burg Stauffenberg bei Hechingen<br />
und zur Identifizierung des Meisters von Meßkirch erwähnt<br />
werden. Mit seinem immensen Detailwissen konnte er manche<br />
Irrtümer der bisherigen Forschung beseitigen und in<br />
Rezensionen landesgeschichtlicher Publikationen Korrekturen<br />
und Ergänzungen anbringen. Er wich dem wissenschaftlichen<br />
Disput nicht aus und führte dabei mitunter eine spitze<br />
Feder.<br />
Ein besonderes Verdienst von J. A. Kraus für die hohenzollerische<br />
Geschichtsforschung liegt in den unzähligen Hinweisen<br />
auf Quellen und in seinen Quellenveröffentlichungen, für<br />
die nur die bedeutendste genannt sein soll: die »Urkunden des<br />
Dominikanerinnenklosters Stetten im Gnadental bei Hechingen,<br />
1261-1802« (1955-1957). Für die Erforschung der<br />
Stammgrafschaft Zollern ist dieses Regestenwerk zu einem<br />
unentbehrlichen Hilfsmittel geworden.<br />
Nicht vergessen werden soll auch die große Zahl von heraldischen<br />
und siegelkundlichen Beiträgen, mit denen J.A. Kraus<br />
die Frühzeit von Adelsgeschlechtern und von Städten mit<br />
Erfolg aufhellte.<br />
Obwohl ihm ein Augenleiden, das seine vorzeitige Pensionierung<br />
zur Folge hatte, bei seinen Forschungen Beschränkungen<br />
auferlegte, war J.A. Kraus auch nach 1966 unermüdlich<br />
für die Geschichte unserer Heimat tätig, stets kritisch beobachtend,<br />
kenntnisreich kommentierend und im übrigen ungemein<br />
produktiv. Dabei übernimmt er immer noch priesterliche<br />
Aufgaben und wirkt in der Altenbetreuung mit. Sein<br />
runder Geburtstag ist ein willkommener Anlaß, ihm aus<br />
Hohenzollern und vor allem vom Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>,<br />
dessen Ehrenmitglied er seit dem Jahre 1968<br />
ist, einen herzlichen Dank für sein in 65 Jahren geschaffenes<br />
Werk zu senden mit den besten Wünschen für sein Wohlergehen.<br />
rechten Winkel zueinander standen, der Giebel des Wohnhauses<br />
gegen den Weg. Diese Anordnung ist für dieses Haus<br />
durch den Ortsplan von 1728 bezeugt, die ältesten Nachrichten<br />
reichen aber noch rund 200 Jahre weiter zurück. Das<br />
Wohnhaus ist einstöckig, enthält neben Stube, Kammer,<br />
Küche, Hausgang noch Stall und Futterscheuerle, unter dem<br />
Dach einige Kammern und zuoberst die Bühne mit der<br />
weiter auf Seite 20
ifA<br />
a<br />
r r<br />
3. ? afts, e««t>, te. 11. tfril<br />
«I - ion»«<br />
Sri id) prangt We Su im îkrtetiMu<br />
»lod, idfrldft nett räumt [ » ft - lu<br />
Dodj fdjon jrmotfit im uflorgenaiwti<br />
Der lag tit rotlirf) liditim ®tra rJ<br />
Unb oDt SB rit fit méâtf auf<br />
fftn Oftermp-^en jitfy In mfl<br />
fiofcn mir t* v" * I XuftrfMpi<br />
It lad» 6m |»nge ! umenftor:<br />
ftittlW&e OtttSt» -<br />
*i t tcubtg t 6ä»0(1<br />
Un) d)hv fltitv m a b«n Drang<br />
De* Ofteirorgtrt ^Hfenttang.<br />
Bolji bcm, ber fh -tim - «tili»<br />
Stmt m« ft H** ubi» ftrnum<br />
hm ihm btr ft .nj yrjr bringt.<br />
Unb r ~t (eine 60. tn<br />
nimmt.<br />
nie er M) bcr Œottr*<br />
Dir Ofttrworgei» < HfeiiHüng!<br />
®«fii r8«»flti »tot<br />
' jta (m fiontil.<br />
Mft* Ootldft M.<br />
CM) ftnn em traut*» en Bi hi, Tal unb lying<br />
64«Hi cr )ti 2« tkng;<br />
Un» üben H too it fi tu<br />
ßedjt nwntxnwU bi rime tin.<br />
Unb mAtyig t igt oui iieitem Œijor<br />
©n Sieb jam reis be* Aerrn « npor<br />
Cal rOawtt r, ,<br />
! w M ^wi jtii<br />
I m 9n jti [Mu mrabeii.<br />
Ma »m ttfcw Ht al «tud. ttMOl Ri -t<br />
ff .,< ovri'-idjt nMfet •»-*»««) ont trfc,:en, l .„ «or<br />
5th Ingen auftei ter fMarrftafte nodj »irr Papel«<br />
Ansicht, das Kreuz am Burladinger Weg bezeichne den<br />
Standort des alten Kirchleins, ist unrichtig. Nach einem<br />
gleichzeitiger Kärtchen stand es vielmehr im Eck vom Bäbeloch<br />
hart ai der alten Staig, wo sich die auffällige Vertiefung<br />
befindet.<br />
Heute besteht nur noch die eine Kapelle, die der Mutter<br />
Gottes geweiht ist. Ihre Erhaltung ist wohl nur dem Umstand<br />
zu verdanken, daß 1841 der Friedhof von der Kirche dorthin<br />
Seit 65 Jahren schreibt Johann Adam Kraus hohenzollerische Geschichtc.<br />
n beimnorn Sa: n fit nrxrut »erben jtnt 1 .tfj mon<br />
nid)i. feber»*"* un 5 rt t! » mare fie î<br />
Dr erftt < bit Unftrti ieben !._ t" btr tott-<br />
mt*er ,1 innen« ift befonbi uebanbeit. .)lcr (ef nur<br />
Su- ftefct on ber rgeft^C V «K^<br />
dot &en rn (t » nirt n ( r.) enufeten 6; ifce,<br />
fid? »on ïxr Sd)li0 wirb t 8. Ifti im 1466 tin« IN it men?<br />
3ati ti otrtin er. Dod> fdjim 1585 -wirbt biefe " ju<br />
ber 9 jirt itt) 1, b« Te .bei to n 1 leren } tu .n<br />
grofttr Sot 1 1V tnuÎM* I « S«4e rti St. [•<br />
m ent M «Kefir gtlefen werbt«. Unttr bem .nrluft be»<br />
ffieii. nxTOiom^nu b 1. tr Kufflär " fdnuttt<br />
bes "iistur.jtitnwitr oott onflanr muri bit SaptOt<br />
1SSI auf îlbtmxJj «tH ift. Son ben btiben C' Jtfltm bângt<br />
Li 13 iHttftt tjmtc in Shn^turm, « onbeie, mxt> Wjoi 400<br />
3 Ijrt alt auf ufbav. ff» r'rb Vri^tet, ktln<br />
fei eftemi 1 Bforrfht^t 1 ftn<br />
Sor tr britttn '«ptO«, .61. Sarooen' mifftn mir raft<br />
lid) Kadj bei nf^n 1 im „fjUdtnM^ie* sont<br />
Safer» a mu It auf be gefèanbtn 1 ben, tl m<br />
0 beute fid) î si îrttrfri j ergebt )er alte 3atm. ber<br />
, wt » Dorf 1 ifd lief I rt —t.. 3m<br />
3 rt 1M1 bei » r 1 t%r: .Vine tritt« Jtape&e .rtb ebt<<br />
mal *t aft be« Drtti batt« aber feinen tUt«r; nunm<br />
ir ift fie «b| tn * sie fditin i(fo ben 6türm« bes<br />
b rtijjli Jfi .jen rneg 1618 48) m Cpf ' gefW st<br />
ftin. iti ti ai Œrfag befür trf6eint fp4ier am H »•<br />
i g » ' irfts nad Saimenbingen bie J t&^erto) lt".<br />
Uber «udj fie nwrtt 1884 k rtbr^en: bie »iefe tr! t nod><br />
btn iamen ba' n.<br />
jit oiertt ftapeik !>.. ben tf Bern jarb jutn on.<br />
S ft ti »m nbwo am B< ^mifefeen ftentetv ind> 8et<<br />
rrMDiefm. benbort tfrtw fk^ aber ènt i . at) imoert<br />
? Ic . Iii , At". Seibt ? ime». ,^cincn a(|b bas*<br />
ttN in vtidirti. fytutt tutet mir 110(9 Mt tfi) rfc<br />
ft If auf bas .»aligt jjeiüg, . La» cor tna^i 100 v<br />
ren in bei lu dr jeit in F Ummer frnt. 6(1 ten | t<br />
man nod| ben Çlunwmtn .bei Seilers jtS^pelt" Die<br />
n m 1 IIIMUmiMI<br />
1 -<br />
verlegt wurde. Wenn man bedenkt, daß in früheren Zeiten die<br />
soziale Lage der Bevölkerung keineswegs »rosig« war, muß<br />
man sich geradezu wundern, wie die Mittel zu so vielen<br />
kirchlichen Gebäuden auch an anderen Orten aufgebracht<br />
wurden. Damals lebte eben in den Herzen der meisten tiefe<br />
Religiosität, die sich ganz von selbst offenbarte in der Bereitschaft<br />
zu den größten Opfern für den hl. Glauben.<br />
19
Fortsetzung von Seite 18<br />
Fruchtschütte. Die Stube hat noch altertümliches ganz dunkles<br />
Holzgetäfer an Wänden und Decke, einen alten Eckschrank<br />
und an der Wand neben dem (neuen) Ofen künstlerische<br />
Plättchen mit bunten Pflanzenornamenten aus dem<br />
Jahre 1788 mit den Anfangsbuchstaben des Hafners W. L.<br />
Das Wohnhaus trug als letztes dahier noch zu Menschengedenken<br />
ein Strohdach (1867 übrigens noch die meisten Häuser!),<br />
allerdings über den Ziegeln, das eines Sonntagnachmittags<br />
fein säuberlich in des Nachbars Garten hinabgerutscht<br />
war. Als älteste Besitzerin des damals noch werdenbergischen<br />
Lehenhofes, der mit andern Gütern von den Schwelhererben<br />
um 1488 erworben worden war, nennt die Geschichte eine<br />
Willa Sutorin (Sauter) ums Jahr 1520. Die fürstenbergische<br />
Güterbechreibung vom J. 1545 führt als Besitzer an: Valentin<br />
Mayer. Der Hof war der Herrschaft eigen: aber des Inhabers<br />
Erbgut. Dazu gehörten: Haus, Scheuer und Garten beieinander<br />
zwischen Wißengäßlin (wohl nach einem früheren Anlieger<br />
Weiß, der 1392 vorkommt und vielleicht gerade unseren<br />
Hof hatte als Lehen von Heinrich von Killer, genannt<br />
Affenschmalz. Er hieß Hainz Weiß) und Hieronymus Mayer<br />
(heute Dieter Andreas), stoßt hinten an Ludwig Rächlins<br />
Garten (heute Bachbauern K. Hipp). Der jetzige Garten<br />
hinter der Scheuer ist nur ein Teil des damaligen. Denn der<br />
sog. Kipfengarten hinter dem Wohnhaus gehörte bis ins<br />
18. Jahrhundert ebenfalls dazu. Ferner gehörten zum Hof an<br />
Äckern: Esch Tiefental: 2 Jauchert an der Heerstraß, 2 J. im<br />
Wasserruns, 3 J. unter Hellischloch, l'A J. am Eisenlocher<br />
Weg, IV2 J. ebenda; Esch Houck: IV2 J. auf der Houck bei<br />
Unser Lieben Frauen Kapell, 1 J. daselbst, 2 J. am Salmendinger<br />
Weg, 1 J. im Lützenwinkel, 4 J. am Hechinger Weg, 2 J.<br />
auf Gallenbühl. Esch Breimischmadt: 3 J. unter der Herrschaft<br />
Braite an Kernenwies, 4 J. im Grund, 2 J. an der<br />
Staingen (Galggruob), 1 J. unterm Briel, 1 J. am Talwieser<br />
Weg, 2 J. auf Altegert, 2 J. unter Bühl. Wiesen: 1 Wiesplätzle<br />
jetzt Hanfgarten in Untern Wiesen, 1 Mannsmahd in Talwies<br />
am Weg zu beiden Seiten, 2 Mm. daselbst, 4 Mm. am<br />
Hechinger Weg, 3 Mm. beim Eichle, 3 Mm. in der Viehwaid,<br />
1 Mm. vor Louchen. Endlich gehörte dazu ein Wald in<br />
Seehalde, zwischen beiden herrschaftlichen Hölzern, stoßt<br />
oben und unten an die Gemeinde. Dieser Wald von 10%<br />
Jauchert 71 Ruten oder 502,09 Ar ist heute in 8 Teile zerlegt.<br />
Das unterste Wäldle grenzt an die Gemeinde Killer, das<br />
oberste an Killer Bürger, welche die erwähnten fürstenbergischen<br />
Wälder käuflich erworben haben. Spätere Besitzer des<br />
genannten Lehenwaldes sind von unten angefangen: Christian<br />
Kraus, Karl Dieter Wtw., Karl Schmid, Josef Faigles<br />
Kinder, der Hirschwirt, Klemens Kraus jung, Andreas Dieter,<br />
Johann Dorn bzw. Otmar Bailers Erben.<br />
JOHANN ADAM KRAUS<br />
Das Ende der Schwelher von Straßberg<br />
Peter Schwelher von Straßberg, erwähnt 1465 bis 1513, war<br />
der letzte Vertreter seines Geschlechtes. Über ihn und seine<br />
Familie, die sich ursprünglich »von Wielandstein« (bei Oberlenningen)<br />
nannte und im 15. Jahrhundert in Ringingen, auf<br />
Holnstein ob Stetten und in Straßberg saß, wurde schon 1938<br />
ausführlich gehandelt 1 .<br />
Zwar war bekannt, daß Peter nach seiner Verheiratung und<br />
nach dem Tod seiner Frau um 1503 noch Priester geworden<br />
war, aber von Kindern wußte man nichts. Dann wurde 2<br />
überraschend bekannt, Peter habe auch einen Sohn Hans<br />
20<br />
Der Lehenhof hatte jährlich abzugeben (bis zur Ablösung um<br />
1830-50): Für Heufeldzehnten 3 Schilling 4 Heller (später<br />
1 Schilling zu 2 Kreuzer gerechnet), Vesen 6 Scheffel, Haber<br />
3 Scheffel (je Reutlinger Maß), Vogthaber 4 Viertel (Tübinger),<br />
1 Henne, 1 Viertel Eier (=120 Stück, oder dafür im Jahre<br />
1666 ganze 24 Kreuzer!!). Endlich mußte der Inhaber der<br />
Herrschaft 2 Tage Dung führen und 1 Tag mähen oder für<br />
beides 9 Schilling Heller zahlen, endlich den Zehnten der<br />
Früchte usw. abgeben und zum Kloster Stetten b. Hech.<br />
20 Kreuzer gilten.<br />
Auf Valentin Mayer folgten als Besitzer: um 1555 Hans<br />
Kuderer, dann Andreas Quintle, 1578 sein Schwiegersohn<br />
Michael Werner, 1607 Hans Ott, um 1640-62 Kaspar Kipf<br />
der eine Frau Anna Werner hatte (Vgl. Kipfengarten!),<br />
1662-74 etwa Michel Ott und Hans Jerg Rhein, 1714 Kaspar<br />
Hipp und 1720 Josef und Martin Hipp und Michael Rueß<br />
jung. Deren Nachfolger waren in weitergehender Zersplitterung<br />
Johann Bayler jung zu 3 Achtel, Kaspar Hipp der<br />
jüngere zu 3 Achtel (er behielt das Gartenstück hinter dem<br />
Wohnhaus), und Bartholomä Dorn zu 1 Viertel. Der Bayler<br />
besaß die Gebäude u. 108 Ruten vom Garten, die restlichen 70<br />
Ruten hatte ein Peter Kraus im Bach im Besitz. Diese Teile<br />
erlangte später Schultheiß Benedikt Emele 1836 bis 43, löste<br />
die Lehenverbindlichkeit gegen die Herrschaft ab und<br />
erstellte in der Scheuer noch eine Wohnung. Das andere<br />
Gartenstück (Kipfen) hatte kurz zuvor Schultheiß Baltas<br />
Hipp des Johann (1830-36) abgelöst, das noch in Händen<br />
seiner direkten Nachkommen ist. Von Benedikt Emele<br />
erwarb der Urgroßvater des heutigen Inhabers das Haus für<br />
seinen Sohn Isidor Viesel, der dann auch die Scheuerwohnung<br />
von Benedikt Feßler an sich brachte, die seitdem (etwa<br />
1880) leerstand und jetzt abgerissen ist. Die Grundstücke des<br />
Hofes sind längst zerstückelt. Vom Wald hatte noch Johann<br />
Bayler jung 4J. 41 Ruten, Kapsar Hipp ebensoviel und Bartie<br />
Dorn 2Vz J. 112 Ruten. Später findet man Matheiß Beck im<br />
Besitz der beiden ersten Teile, später Augustin Mayer und<br />
Senes Kraus in dem der Hälfte des einen, von je 1 Jauchert<br />
IOV2 Ruten, die seitdem eigen gemacht sind. Heute sind es die<br />
Wäldle von Andreas Dieter und Klemens Kraus des jungen<br />
Erben.<br />
Während in den letzten 200 Jahren die Güter immer im<br />
Erbgang weiterliefen, wechseln vorher die Familien in auffallender<br />
Weise, was sich auch bei anderen Höfen feststellen<br />
läßt. Der Grund hierfür ist nicht bekannt. Man sollte doch<br />
erwarten, daß bei Unteilbarkeit des ganzen Hofes eine Familie<br />
auch jahrhundertelang Besitzer bliebe! Die Teilbarkeit<br />
setzt bei uns nach dem 30jährigen Kriege, eingeleitet durch<br />
ein par Vergantungen, beinahe planmäßig ein!<br />
Erschienen in der »Lauchert-Zeitung« am 24.12.1938.<br />
gehabt, der am 31. Dezember 1497 durch Österreich mit<br />
einem Hof zu Dettingen bei Kirchheim, den vorher Peter<br />
hatte, belehnt worden ist. Somit konnte auch wohl kein<br />
Zweifel bestehen, daß jener Hans Sweller (mit dem Schwelherischen<br />
Siegel, dem sechsmal quergeteilten Schild) Peters<br />
Sohn war, der am 10. Juli (nicht 6. 7.) 1500 die Urfehde des<br />
Hans Zech von Laufen a.d. Eyach siegelte 3 . Wir wissen aus<br />
einer Urkunde Kaiser Maximilians, daß Peter jedoch am<br />
3. Mai 1504 keine Kinder (mehr) hatte 4 . Hans muß somit früh<br />
gestorben sein. Auffälligerweise hat Peter schon 1497 veran-
laßt, daß das Lehen Straßberg nicht etwa dieser Sohn, sondern<br />
der Oheim Melchior von Thierberg von der Äbtissin zu<br />
Buchau bekam. War der junge Hans krank, oder mit seinem<br />
Vater zerfallen?<br />
In der Jahrtagsstiftung Peters vom Jahre 1512 5 ist von ihm<br />
bezeichnenderweise nicht ausdrücklich die Rede, wohl aber<br />
von Peters Vorfahren, der Frau, den Geschwistern und deren<br />
Nachkommen. Wenn ich seinerzeit 6 Peters Gemahlin Margaretha<br />
von Neuneck angezweifelt habe, so kann dieser Zweifel<br />
nicht aufrecht gehalten werden, denn es gab damals zwei<br />
Frauen dieses Namens! Peters Gemahlin Margaretha v.<br />
Neuneck war tatsächlich die Tochter Melchiors von Neuneck<br />
zu Glatt, während die andere Margaretha v.N., Tochter des<br />
JOHANN ADAM KRAUS<br />
Mae Hoemet (1925)<br />
1. O Eatle, mei Ringinga, wia bischt Du schee / Ka(n)s oiba a<br />
Derfle so wi Di no gee(n)? / Grad zwischat em Nähbearg<br />
und Hälschla verschlupft / Daß Luft it ond s'Weatter<br />
schlimm a dr rum rupft!<br />
2. An Heisr u. Schuira, an Gääta und Ställ / Vom Lai u. vom<br />
Schmittaroi bis a seall Quäll: Am Saumärkt, da Bach na<br />
ond d'Raoße deet numm / gaod Gässle ond Weagle toils<br />
grad u. toils gromm.<br />
3. Do wuuslets vo Leide mit Wäga und Vieh / se denglet u.<br />
mischter u. fahret: Hott! Hi! Ond zwischet da Henna u.<br />
Spatza im Saus / Hui, springet dia Kindr um Gääta und<br />
Haus.<br />
4. Se schupfet im Hefle, teand fanga im Hae, weand Wägele<br />
fahra dur Gumpa ond Sae. Wia bhupfet dia Trendl und<br />
glepfet dia Schua: Hoi singet! ond schlahet da Takt frao<br />
drzua!<br />
5. Narr, aist i dr Ernat: A n Amoisahauf / mit ällem seim<br />
Duranand könnt nemme auf! Do lauft ällts und springt<br />
ällts ond naoftet im Schaffa vom eltesta Miaterle bis zum<br />
Rotzaffa!<br />
6. Se mähat, se warbet, se shlahet noch um, ma schechlet u.<br />
bindet u. reachet drum rumm. Ma leed noch ond spannat,<br />
feert hoe im Karree / daß lället die Leit samt der Mene, o<br />
je!<br />
7. Dees Weatter isch laonisch, jaichts wiast dur anand / loot<br />
bhäb Zeit zum eassa: ma schluckt nu im Stand. Ma<br />
schaffet grad wie wenn diaTäg ginge aus! Doch fraet ma<br />
se! Vool wearet Haebaarn u. Haus!<br />
8. Und sust uf em Acker, an Roena, im Wald / ist iberal<br />
Leaba bei Jung ond bei Alt. Drum singat ao G'stora, dr<br />
Fink schreit: Witt, witt! Ond d Spatza dia lärmet vom<br />
Nägelebritt.<br />
HERBERT RADLE<br />
Oswald von Neuneck, den Thomas von Wehingen ehelichte<br />
und schon 1477 tot war 7 . Die genauen Lebensdaten der<br />
Gattin Peters kennen wir bis dato freilich nicht.<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Hohenz. JHeft 1938, S. 94-148; Nachträge erschienen ebd. 1960,<br />
S. 148-153, und 1964, S. 349-355. Vgl. Straßberg, ebd. 1959, 17f.<br />
2<br />
Hohenz. Heimat 1961, 8.<br />
3<br />
Stauffenberg-Archiv im Staatsarchiv Sigmaringen.<br />
4<br />
Hohenz. JHeft 1938, 132.<br />
5<br />
Ebd. S. 142.<br />
6<br />
Ebd. 131.<br />
7<br />
Hodler, OA Haigerloch 1928, 179; K.v. Knobloch, Oberbad.<br />
Geschl. Buch 111,231.<br />
9. Am Sonnteg duat alles sei Weateghäß ra / ond gloedet se<br />
festlich vo oba bis na. / Wia leitet dia Glocka: »bimbim«<br />
und »bimbaum!« Dia Kirchatir schluckt dia vill Beatter jo<br />
kaum!<br />
10. Noom Weihwasser prediget s'Hairle ganz nett / ond<br />
nochear wuut gsonga ond beattet um 'd'Wett. »O Hearget<br />
gib Säaga! Was wär's aone Di!? Schitz Fealder ond<br />
Wiisa, schitz aos samt deam Vieh!«<br />
11. »Verzeih aosre Sinda, ob graoß oder klei(n). Lass aos<br />
wenn mr stearbet in Himmel doch nei! Du bist jo dr Vattr,<br />
mo älles regiert, ond mir Deine Kender, schao oft hao mrs<br />
gspirt!«<br />
12. Ist Kinderlaer rum und d'Veasper voll aus, gaod oene uf<br />
d'Fealder oder sust mo na naus. De andre en Wald ond in<br />
d'Nochberschaft, in d'Kappl, uf d'Greber schier massahaft.<br />
13. Mr ghairet doch zeema, d'Arm Saela und miar / Se sind it<br />
vergeassa as wia a n arms Tiar. Si kriaget s'Weihwasser<br />
ond »Herr gib ana Ruah!« (Guck, 2035) d'Engel im<br />
Himmel, dia singat drzua!<br />
Wortdeutung: schupfa = Kinderspiel: Werfen von Roßnägeln in ein<br />
auf- den Boden gezeichnetes Quadrat; bhupfa = hüpfen; Trendl<br />
= Kreisel, Tanzknopf; narr: wahrlich; naofta: eiligst arbeiten; warba<br />
= gemähtes Gras zerstreuen; Mene = Gespann, Zugvieh; jaicha<br />
= jagen; gloeda = kleiden; noohear = nachher; Kinderlaer = Christenu.<br />
Kinderlehre; sust = sonst; mo na = wohin; loss = höre.<br />
Heimatgeschichtliche Bemerkungen zum Kloster Heiligkreuztal<br />
1. Beziehungen zu Sigmaringen, Hornstein und Veringen<br />
Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Heiligkreuztal<br />
stand in der Vergangenheit in vielfältiger Beziehung zum<br />
heutigen Kreisgebiet Sigmaringen. Vom Ende des H.Jahrhunderts<br />
an waren die Grafen von Werdenberg als Inhaber<br />
der Herrschaft Sigmaringen Vögte über Heiligkreuztal, und<br />
nach deren Aussterben 1534 kam die Vogtei an die Grafen<br />
von Hohenzollern, denen sie bis zur Säkularisation unterstand<br />
1 . Neben den Gründern des Klosters, den Grafen von<br />
Grüningen-Landau, gehörten vor allem auch die Ritter von<br />
Hornstein und Bittelschieß (nahe Sigmaringen) schon früh zu<br />
den Förderern des Klosters. Im 14. Jahrhundert finden wir<br />
allein 17 Hornsteinerinnen als Klosterfrauen in Heiligkreuztal,<br />
unter ihnen drei Äbtissinnen 2 . Um diese Zeit (1370) wird<br />
vier Klosterschwestern aus Oberstetten der »lagenzehenden<br />
(= Nutzzins) in dem Banne ze Sigmaringen, den man nennt<br />
Brenzhofer« bestätigt 3 . Ein Jahrzehnt später, 1381, tritt<br />
21
Elisabeth Strueb aus Veringen in das Kloster ein: ohne<br />
Zweifel eine Angehörige der bekannten Strueb-Familie, welche<br />
im 15. und 16. Jahrhundert in Veringen mehrere begabte<br />
Bildhauer bzw. Maler hervorgebracht hat. Der »Leibdingbrief«<br />
der genannten Elisabeth Strueb wird am 13.Januar<br />
1381 auf »Güter zu Grüningen (bei Riedlingen), Enslingen<br />
und Veringen« ausgestellt 4 . Die von G.Pape 5 angeführte<br />
Mechthild von »Yeringen«, Äbtissin von Heiligkreuztal,<br />
muß zweifellos als Mechthild von »Veringen« gelesen werden;<br />
die achte Äbtissin, Regierungszeit 1326-1332, war also<br />
eine Gräfin von Veringen.<br />
2. Veronika von Rietheim und der Meister von Meßkirch<br />
Unter allen Äbtissinnen von Heiligkreuztal war die bedeutendste<br />
ohne Zweifel Veronika von Rietheim, geboren 1472<br />
als Tochter des Reichsritters Ulrich von Rietheim. Sie regierte<br />
von 1521-1551 und hat sich in der schwierigen Zeit von<br />
Reformation und Bauernkrieg als energische Regentin und<br />
treue Anhängerin des alten Glaubens bewährt. Sie ist aber vor<br />
allem als Bauherrin und in diesem Zusammenhang auch als<br />
Auftraggeberin des Meisters von Meßkirch in die Geschichte<br />
des Klosters eingegangen: ihre Bautätigkeit war bestimmend<br />
für das heutige Aussehen Heiligkreuztals. Nachdem bereits<br />
ihre Vorgängerin, Anna von Gremiich d.J. (1490-1521), die<br />
beiden Seitenschiffe der Kirche hatte einwölben lassen, wurde<br />
von der Rietheimerin im Zuge ihrer Baumaßnahmen auch das<br />
Mittelschiff eingewölbt, ebenso der Kreuzgang, der Kapitelsaal<br />
und die Refektorien 6 . Der neue malerische Schmuck an<br />
Wänden und Gewölben aber wurde, wie schon angedeutet,<br />
dem Meister von Meßkirch übertragen. Dieser schuf in den<br />
Jahren 1532-1534 zusammen mit seinen Schülern die Fresken<br />
in der Kirche und im Kreuzgang. Christian Altgraf zu Salm<br />
hat die Fresken in seiner Arbeit »Die Wand- und Gewölbemalereien<br />
des Meisters von Meßkirch in Heiligkreuztal«<br />
(1956) ausführlich beschrieben und gewürdigt. Ob der Meister<br />
von Meßkirch freilich auch die Entwürfe für die sechs<br />
monumentalen Glasfenster geliefert hat, die sich seit 1870 in<br />
Stuttgart befinden und deren eines hier abgebildet ist<br />
(Abb. 1), bleibt umstritten 7 . Die Frage soll uns nicht weiter<br />
beschäftigen, da wir uns lediglich noch mit dem auf der<br />
Abbildung sichtbaren Wappen Veronikas beschäftigen<br />
wollen.<br />
3. Die Veringer Hirschstangen im Wappen der Veronika von<br />
Rietheim<br />
Die abgebildete Scheibe zeigt in einem Architekturrahmen<br />
einen Engel als Wappenhalter, der das Wappen der Äbtissin<br />
präsentiert. Das Wappen - es nimmt die gesamte untere<br />
Hälfte des Bildes ein - weist in einem gevierteilten Schild die<br />
Esel der Rietheimer und die Hirschstangen der Veringer auf.<br />
Die Rietheimer Esel 8 weisen als Wappentiere zurück auf die<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Vgl. Ursmar Engelmann, Heiligkreuztal, Beuroner Kunstverlag<br />
2<br />
1983, S. 37.<br />
2<br />
Vgl. Engelmann, S. 15. Alfons Bacher, Heiligkreuztal, Geschichte<br />
und Gegenwart, Heiligkreuztal 1982, S. 80.<br />
3<br />
Pape, bei Bacher, S. 35.<br />
4<br />
Pape, bei Bacher, S.35.<br />
5<br />
Pape, bei Bacher, S. 80, Nr. 8.<br />
6<br />
Vgl. Engelmann, S. 36; Kummer, bei Bacher, S. 85 f.<br />
7<br />
Vgl. L. Balet, Schwäbische Glasmalerei, Kataloge der kgl. Altertümersammlung<br />
in Stuttgart, Bd. 2, Stuttgart/Leipzig 1912, S. 33 f.,<br />
der die Frage bejaht. Anders Chr. Salm, Der Meister von Meßkirch,<br />
Diss. Freiburg 1950, S. 169f.<br />
8<br />
Die Rietheimer Esel sind auch zu sehen auf dem Wappen Anna<br />
Marias von Rietheim auf dem Aufsatz des Epitaphs ihres Mannes,<br />
des Ritters Albrecht von Speth (f 1608), in der Pfarrkirche Neufra.<br />
9<br />
Rietheimer begegnen - außer in Riedheim/Donaumoos - auch in<br />
Überkingen, Stotzingen, Rammingen, Stetten, Bissingen im Lone-<br />
22<br />
Wappenscheibe der Veronika von Rietheim, Heiligkreuztal, 1532,<br />
Hüttenglas, Schwarzlot, Silbergelb, Eisenrot, H. 81 cm, B. 4} cm.<br />
Stuttgart, Württ. Landesmuseum, Inv. Nr. 1089 d. Inschrift: Fronnicka<br />
Äbbtdisin zu hailig Creiczdall. Geborn von Ryetthain<br />
südlich von Heidenheim in der Gemarkung Herbrechtingen<br />
gelegene Eselsburg, die Stammburg der Rietheimer 9 .<br />
Wie aber kommen die Veringer Hirschstangen in das Wappen<br />
Veronikas? Die Antwort lautet: über ihre Mutter Veronika,<br />
Gräfin von Landau 10 . Denn das Haus Landau, das durch zwei<br />
Heiratsverbindungen ein Zweig der Grafen von Veringen<br />
war, führte die Hirschstangen der Veringer im Wappen".<br />
tal, Remshart, Rettenbach, Angelberg sowie als Pfandschaftsinhaber<br />
in Günzburg und Reisenburg. Vgl. Karl Bosl, Handbuch der<br />
historischen Stätten Deutschlands, Bd. 7, Bayern, Stuttgart 1961,<br />
S. 588.<br />
10 Zwei Brüder der Mutter Veronikas, Jakob und Hans von Landau,<br />
traten als wichtige Stützen des habsburgisch-österreichischen<br />
Reiches in Schwaben unter Maximilian und KarlV. hervor. Vgl.<br />
Engelmann, S. 43 f.<br />
11 Vgl. H. Burkarth, Geschichte der Herrschaft Gammertingen,<br />
S. 47. Uber die Grafen von Grüningen-Landau kam das Veringer<br />
Wappen übrigens an die Grafen von Württemberg. Die drei<br />
Hirschstangen bildeten bis 1952 das württembergische Staatswappen.<br />
Zur Stammtafel der Württemberger vgl. auch K. Bosl, Biographisches<br />
Wörterbuch zur deutschen Geschichte, München<br />
1973-1975, S. 3255. Anzumerken bleibt noch, daß Veronika von<br />
Rietheim auch den schönen Marienbrunnen von 1548 in Auftrag<br />
gab, der heute - in freilich erbarmungswürdigem denkmalpflegerischem<br />
Zustand - im Schloßhof zu Grüningen steht.
JOHANN ADAM KRAUS<br />
12 Empfinger Urkunden<br />
Als Ergänzung zur Ortsgeschichte F. X. Hodlers in »Oberamt Haigerloch« (1928) seien aus dem Generallandesarchiv<br />
Karlsruhe (Konstanz 5,653) einige Urkunden mitgeteilt:<br />
1) Friihmeßstiftung<br />
1327Mai 25, Reichenau: Abt Diethelm von Reichenau, OSB,<br />
tut kund: Der Priester Conrad genannt Hildpolt von Haigerloch<br />
und die Untertanen in Empfingen, das zu unserem<br />
Kloster gehört, haben zu ihrem und ihrer Vorfahren Seelenheil<br />
und zur Mehrung des Gottesdienstes mit Zustimmung<br />
des Konstanzer Bischofs Rudolf (gb. Graf v. Montfort) für<br />
ihre Pfarrkirche Empfingen eine Stiftung gemacht, wo Johannes,<br />
der Sohn des Johannes Truchseß von Diessenhofen,<br />
Kirchrektor ist. Sie dotierten den Altar der heiligen Nikolaus<br />
und Katharina mit vier Mark Silber. Der Inhaber dieses Altars<br />
soll jährliche Einkünfte erhalten: 7 Pfund Heller und 10 Malter<br />
Roggen in Horber Meß. Der Abt darf jeweils einen<br />
geeigneten Kaplan einsetzen, der sich eidlich zur Residenz<br />
verflichtet, den Altar besorgt, täglich die Frühmesse hält,<br />
außer er sei verhindert. Er muß gewissenhaft sein Amt<br />
verwalten und darf kein Opfergeld annehmen. Siegler: Der<br />
Aussteller, der Bischof und der Kirchrektor Johannes Truchseß<br />
von Diessenhofen. (Nur das letzte Siegel ist erhalten:<br />
Kessel mit Halbrundhenkel im Schild. Diessenhofen liegt im<br />
schweizerischen Thurgau.)<br />
2) 1432 Dez. 26: Freiherr Walther von Geroldseck zu Sulz<br />
urkundet; von Abt Friedrich von Reichenau durch seinen<br />
Vetter Heinrich von Geroldseck zu Sulz zu Mannlehen<br />
empfangen zu haben: Kirche und Kirchensatz (Patronatsrecht)<br />
zu Empfingen, den Kelnhof daselbst, alle Zehnten,<br />
Leute und Güter, die dahin gehören. Siegler: dieser Vetter, da<br />
Walther kein Siegel da hat.<br />
3) 1455 Aug. 28: Freiherr Heinrich von Geroldseck zu Sulz<br />
beurkundet den Empfang des Mannlehens Empfingen von<br />
Abt Johannes von Reichenau (wie oben).<br />
4) 1457 Apr. 26: ebenso der Freiherr Hans von Geroldseck,<br />
wie das Lehen seine Vorfahren hatten. Im Siegel: ein Querbalken.<br />
5) 1465 Nov. 8: derselbe nochmals von Abt Johannes.<br />
6) 1489 März 9: Freiherr Erhard von Gundelfingen urkundet<br />
für seinen Herrn, den Grafen Eberhard von Wirtemberg d.<br />
HERBERT RÄDLE<br />
älteren, daß dieser von Abt Johannes von Reichenau Empfingen<br />
als Mannlehen erhalten habe (wie 1432). Er hat dem Abt<br />
gehuldigt, den Eid geschworen, ihm treu und verbunden zu<br />
sein und alles nach Lehensrecht zu tun. Siegler: der Aussteller<br />
(dorniger Schrägbalken).<br />
7) 1489 Apr. 2: Herr Gangolf von Geroldseck bestätigt, von<br />
Abt Johannes v. R. das Lehen Empfingen erhalten zu haben,<br />
wie es sein Vetter Johannes hatte. (Wieso ist bald Geroldseck,<br />
bald Wirtemberg Leheninhaber?)<br />
8) 1497 März 9: Freiherr Erhard von Gundelfingen bestätigt,<br />
von Abt Martin von Reichenau für seinen Herrn, den Grafen<br />
Eberhard v. Wirtemberg, den Lehenempfang von Empfingen:<br />
Kirche und Kirchensatz, Kelnhof und Zehnten.<br />
9) 1536 Sept. 12: Graf Joachim von Hohenzollern hat auf<br />
Zehnten, Kirchensatz, Umgeld und die Scheuer zu Empfingen<br />
von Abt Markus von Reichenau lOOOfl. Hauptgut (bei<br />
50 fl. Zins) aufgenommen. Sein Anwalt und Sekretär ist<br />
Baptist Hönnedl. Siegler: der Aussteller und Burkart von<br />
Danketschwyler. (Dieser führt eine große Lilie im Schild.)<br />
10) 1538 Nov. 5: Graf Jos Nikiaus von Hohenzollern<br />
schreibt an Abt Markus von Reichenau als Lehensherrn:<br />
Mein verstorbener Vater Gr. Joachim von Zollern hat den<br />
Zehnten zu Empfingen samt Kirchensatz und neugebauter<br />
Scheuer und allen Rechten als Reichenauer Lehen empfangen<br />
gehabt und jetzt auf mich vererbt. Da das Lehen künftig dem<br />
Grafen Christoph von Nellenburg, Herrn zu Tengen,<br />
zusteht, so sende ich es anmit auf mit der Bitte, es diesem<br />
Grafen zu leihen (Wildmannssiegel auf Oblate).<br />
11) 1554 Aug. 18: Graf Carl von Hohenzollern will dem<br />
Bischof von Konstanz, der zugleich Abt von Reichenau ist,<br />
nur das Handgelübde geben, aber nicht beim Lehenempfang<br />
Empfingen schwören.<br />
12) 1560: Aug. 11: derselbe Graf beauftragt die Obervögte<br />
Bastian Schlegel und Christoph Wendler von Bregrat für ihn<br />
das Lehen Empfingen zu empfangen.<br />
Ein Porträt des Botanikers Leonhard Fuchs von der Hand Jörg Zieglers<br />
Der Kunsthistoriker Werner Fleischhauer hat in seinem Buch<br />
»Die Renaissance im Herzogtum Württemberg«, Stuttgart<br />
1971, auf ein mit IZ signiertes Porträt des Tübinger Medizinprofessors<br />
und »Vaters der Botanik« Leonhard Fuchs 1 im<br />
Ulmer Stadtmuseum (Abb. 1) aufmerksam gemacht und das<br />
kleinformatige 1569 datierte Aquarell dem damals in Rottenburg<br />
tätigen Jörg Ziegler zugewiesen; freilich mit dem<br />
Zusatz: »Die Identifizierung Jörg Zieglers mit dem Meister<br />
von Meßkirch hat sich als unhaltbar erwiesen« (S. 181).<br />
Gerade diese »Identifizierung« wird indessen neuerdings<br />
wieder versucht - und mit keinen schlechten Argumenten<br />
(von Wolfgang Urban in der Stuttgarter Zeitung vom<br />
4. 1.<strong>1989</strong>, S. 25). Mag auch in dieser umstrittenen Frage das<br />
letzte Wort noch immer nicht gesprochen sein, auf jeden Fall<br />
hat Urban die Aufmerksamkeit wieder auf Jörg Ziegler<br />
gelenkt.<br />
Und so scheint es im Sinne eines Weitergangs der Forschung<br />
nicht unangebracht, erneut auf das bereits von Fleischhauer<br />
erwähnte Porträt hinzuweisen, da es, wie mir nochmals vom<br />
Ulmer Stadtmuseum bestätigt wurde, eindeutig die Signatur<br />
IZ trägt. Das Porträtbild stellt gleichzeitig eine Verbindung<br />
zwischen dem Rottenburger Maler und einem Professor der<br />
Universität Tübingen sicher.<br />
23
Porträt des Arztes und Botanikers<br />
Leonhard Fuchs (1501 bis<br />
1566). Mit 12 (= Jörg Ziegler)<br />
monogrammiert, auf dem Foto<br />
nicht sichtbar. 1569 datiert.<br />
Ulm, Stadtarchiv Nr. 1441.<br />
Aquarell (Öl?) auf Pergament.<br />
33 x 22,6 cm<br />
Das Bild zeigt einen phantasievollen Architekturrahmen und<br />
in dessen Zentrum ein Medaillon mit dem Bild des Professors<br />
auf blauem Grund. Den Rahmen zieren Hermen, Putten und<br />
Rollwerk und, was eher ungewöhnlich ist, naturgetreu wiedergegebene<br />
Kürbisranken. Der Rand des Medaillons trägt<br />
als Umschrift den Namen des Abgebildeten und sein Alter im<br />
Todesjahr. Darüber erscheint das Wappen Fuchsens in Gold<br />
und Blau mit je einem Fuchs im Feld bzw. als Helmzier. Der<br />
Porträtierte ist mit grauem Vollbart, Barett und pelzverziertem<br />
Mantel wiedergegeben und trägt in spitzen Fingern eine<br />
rote Blume (Rose). Vor ihm zwei Bücher. Darunter, von zwei<br />
springenden Füchsen flankiert, ein freies Feld für eine Inschrift.<br />
Wer war Leonhard Fuchs f<br />
Der Abgebildete, Leonhard Fuchs, geboren 1501 in Wemding<br />
bei Donauwörth, wird, wie schon angedeutet, zu den<br />
Vätern der wissenschaftlichen Botanik gezählt. Sein Hauptwerk,<br />
ein botanisch-medizinisches Handbuch, das zunächst<br />
24<br />
für den Arzt und Apotheker gedacht war, erschien unter dem<br />
Titel »Historia stirpium« 1542 bei Michael Isengrin in Basel<br />
auf lateinisch und ein Jahr später, 1543, ohne die zahlreichen<br />
wörtlichen Zitate aus antiken Autoren, auch auf deutsch als<br />
»New Kreüterbuch« mit über 500 Abbildungen. Alle Pflanzen<br />
sind mit ihren griechischen Namen alphabetisch aneinandergereiht,<br />
da Fuchs sich stark an das Werk des griechischrömischen<br />
Pharmakologen Dioskurides (1. Jh. n. Chr.) angelehnt<br />
hat.<br />
Die wissenschaftliche Karriere von Fuchs hatte 1526 mit einer<br />
Professur in Ingolstadt begonnen, wo er sein Lehramt aber<br />
bereits 1528 aus Glaubensgründen aufgeben mußte. Eine<br />
Stellung als Leibarzt beim Markgrafen Georg von Brandenburg<br />
in Ansbach bot dem überzeugten Lutheraner mehr<br />
Sicherheit. Als sich freilich die Pläne zur Errichtung einer<br />
protestantischen Universität in Ansbach zerschlugen, folgte<br />
er 1533 einem erneuten Ruf nach Ingolstadt. Nicht viel später<br />
wurde er endlich von Simon Grynaeus, der 1534/35 im
Auftrag Herzog Ulrichs die Universität Tübingen reformierte<br />
und mit einem neuen Lehrkörper ausstattete, auf den<br />
Lehrstuhl für Medizin nach Tübingen berufen 2 .<br />
Von 1535 bis zu seinem Tod im Jahre 1566 hat Fuchs in<br />
Tübingen gelehrt und siebenmal das Amt des Rektors bekleidet.<br />
Sein dortiges Wirken als Lehrer und Forscher stand ganz<br />
im Zeichen des Humanismus. Als Anhänger der altgriechischen<br />
Medizin war er bestrebt, die Lehren Galens und des<br />
Hippokrates zu verbreiten und arabische Lehrmeinungen<br />
anzufechten.<br />
Unser Bild, das ihn mit einer Blume in der Hand zeigt, weist<br />
ihn als Verfasser seiner botanischen Arbeiten aus, die in<br />
Buchform vor ihm liegen. Leonhard Fuchs starb 1566 in<br />
Tübingen, wo - im Botanischen Institut - noch heute 23<br />
Druckstöcke der ursprünglich über 500 Holzschnitte seines<br />
Kräuterbuches liegen 3 .<br />
JOHANN ADAM KRAUS<br />
Jungingen, ehemals bischöflicher Besitz<br />
Eine bisher unbeachtete Urkunde aus dem Besitz des früheren<br />
Johanniterordens ist im Stande, das Dunkel der älteren<br />
Geschichte des Dorfes und der Burg Jungingen im Killertal<br />
zum Teil aufzuhellen. Das schön erhaltene lateinische<br />
Schriftstück liegt heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart unter<br />
B 352 als Pergamenturkunde Nr. 406. Es ist datiert vom<br />
15. November 1278, entstand also vor fast 700 Jahren. Die<br />
Übersetzung lautet:<br />
»Rudolf, durch Gottes Erbarmung Bischof von Konstanz,<br />
entbietet allen Lesern dieses Schreibens Segen im Herrn.<br />
Damit das Geschehene nicht aus dem Gedächtnis der Menschen<br />
schwindet, sei es vorsorglich schriftlich für die Zukunft<br />
festgehalten. Kund sei allen, daß Ritter Eberhard von Jungingen<br />
den Johanniter-Ordensherren, dem Komtur und den<br />
Hospitalbrüdern des hl. Johannes von Jerusalem und ihrem<br />
(Ordcns-)//d«se in Jungental seine Besitztümer geschenkt<br />
hat: Nämlich die Hälfte des Dorfes Jungingen und den<br />
völligen Bereich der Burg Jungingen (medietatem ville J. et<br />
municipium integraliter castri Jungingen), die im Volke<br />
»BurchstaU heißt, und zwar mit allem Zubehör an Vogteien,<br />
Wiesen, Weiden, Wäldern, Hainen, Wassern, Wasserläufen,<br />
Mühlen, Wegen, Unwegsamen, Bännen und Rechten, die im<br />
Volke »Ban und Getwinck« (Bann und Zwing) heißen. Diese<br />
Besitzungen hat der genannte Eberhard von Jungingen von<br />
uns und unserer bischöflichen Kirche Konstanz als Lehen<br />
besessen und nun rein um Gottes Willen abgetreten. Und wir<br />
haben, nachdem Eberhard darauf in unsere Hand verzichtete,<br />
das Obereigentum daran den erwähnten Ordensbrüdern<br />
übertragen, deren Eifer für das Heil der Gläubigen uns<br />
bekannt ist. Dazu kam auch die Zustimmung unseres<br />
(Dom-)Kapitels. Zum Zeugnis hierfür übergeben wir den<br />
Johannitern diese Urkunde, besiegelt mit unserem und dem<br />
Kapitelssiegel.<br />
Wir der Propst und Dekan und das ganze Kapitel der<br />
Konstanzer Kirche stimmen dieser Schenkung zu und siegeln<br />
mit. - Geschehen in der Burg Balbe (Balm bei Lottstetten-<br />
Waldshut) im Jahre des Herrn MCCLXXVIII, XII Kalendas<br />
Decembris (15. November), indictione VII. im Beisein des<br />
Abts von Berwangen, des Abts und Propstes von St. Agnes in<br />
Schaffhausen, des Propstes der Kirche Werd (Insel bei Stein a.<br />
Rhein), ferner des Grafen Heinrich von Veringen des älteren,<br />
des Edlen Lütold von Regensberg des älteren, Eberhards von<br />
Henkrat, N. von Ulingen und N. von Buchsee, die alle Ritter<br />
sind, auch anderer mehr. Vorstehendes wurde rechtskräftig<br />
durch Zustimmung des Konstanzer (Dom-)Kapitels am<br />
19. November des genannten Jahres.«<br />
Anmerkungen<br />
' Ihm zu Ehren hat der französische Botaniker Plumier 1696 die<br />
»Fuchsie« benannt, die er auf den westindischen Inseln entdeckt<br />
und von dort nach Europa gebracht hatte.<br />
2 Vgl. den Brief von Grynaeus an Blarer (Traugott Schieß, Blarerbriefwechsel,<br />
Bd.l, Nr. 596, S. 702) vom Juni 1535, in dem<br />
Grynaeus die wissenschaftliche und menschliche Qualifikation<br />
von Fuchs würdigt und auch das ausgehandelte Professorengehalt<br />
von 160 Gulden jährlich mitteilt. Fuchs trat am 14. August 1535 in<br />
den Rat der Universität ein.<br />
3 Über letztere: K.Dobat, Tübinger Kräuterbuchtafeln des Leonhard<br />
Fuchs, Begleitheft, Tübingen 1983. Uber Fuchs allgemein:<br />
E. Stübler, Leonhard Fuchs, Leben und Werk. In: Münchener<br />
Beiträge zur Geschichte und Literatur der Naturwissenschaften<br />
und Medizin 13/14, 1928, S. 64-263.<br />
Während man von dem ursprünglich wohl hochadeligen<br />
Geschlecht der Herren von Jungingen durch Friedr. Eisele 1<br />
seit dem Jahre 1075 aus einer später überarbeiteten aber sonst<br />
unverdächtigen Urkunde des Klosters Hirsau Kunde hat, in<br />
der Altrich (= Walterich) von Jungingen als Zeuge genannt<br />
ist, wissen wir von dem viel älteren Dorfe Jungingen erst seit<br />
dem Jahre 1300, wo der Johanniterorden Burg und Dorf<br />
Jungingen mit zugehörigen Gütern an den Grafen Eberhard<br />
von Wirtemberg vertauschte 2 .<br />
Mit vertauscht wurden auch alle Ordensgüter von Hechingen<br />
an das Killertal aufwärts und ganz oben im Tal an der Scheer<br />
und Alb, wie sie bisher zur Burg Jungingen gehört hatten.<br />
Nur das Hospiz Jungental behielt sich der Orden vor. Dieses<br />
Johanniterhaus mit Kirche stand ehemals westlich von Starzein<br />
auf halber Anhöhe, wo man noch heute eine »Kirchstaig«<br />
kennt. Der Ort dürfte von Jungingen aus und wohl auf<br />
Veranlassung des dortigen Adels benannt worden sein, denn<br />
gelegentlich findet man ihn auch verkürzt als »von Jungen«<br />
aufgeführt. Jungental wird in einer leider verlorenen<br />
Urkunde 1256 erstmals erwähnt, war 1406 mit einem Prior<br />
besetzt 3 und wurde 1605-12 vom Orden an das gräfliche<br />
Haus Zollern-Hechingen verkauft 4 .<br />
Der in der bischöflichen Urkunde genannte Stifter Eberhard<br />
von Jungingen ist vielleicht der jüngere Ritter dieses Namens,<br />
den Eisele a.a.O. Seite 117 erwähnt. Die Familie starb im<br />
Mannestamme am 16.Januar 1501 mit Ulrich v.J. aus 5 .<br />
Vermutlich hatten die Junginger der Sitte der Zeit gemäß ihre<br />
Besitzungen zum Teil (zu einem früheren Zeitpunkt) dem<br />
Bischof aus Devotion oder Schutzbedürfnis übertragen und<br />
als Lehen zurückerhalten gehabt. Da die Burg Jungingen hier<br />
»Burchstall« heißt, darf man annehmen, sie sei zu dieser Zeit<br />
unbewohnbar gewesen; im Jahre 1300 ist jedoch ausdrücklich<br />
von »Burg« die Rede! Municipium bedeutet nach Cu Cange<br />
»eine Burg oder Stadt, die mit Mauern umgeben ist«. Es sind<br />
zwar Zwing und Bann aufgeführt, aber merkwürdigerweise<br />
(oder nur irrtümlich?) keine Äcker! Wo die Herren von<br />
Jungingen, nunmehr niederadeligen Standes, zu dieser Zeit<br />
wohnten, scheint nicht überliefert zu sein. Um 1316 erwarben<br />
sie die Burg Schiltau an der Lauchert, bauten in der Nähe eine<br />
neue Burg, die in der Folge mit den Namen Jungnau die alte<br />
Siedlung überflügelte 6 . Reste der alten Schiltau-Burg sind<br />
noch auf einem Felsen zu erkennen, vom mächtigen Burgfried<br />
der Junginger durch eine Dorfstraße getrennt. Man<br />
möchte annehmen, daß mit Gründung des Johanniterhauses<br />
Jungental einige benachbarte kleine Burgen ihre Bedeutung<br />
25
verloren, so der Burgstall auf Schnait, ein zweiter zu Hausen-<br />
Starzeln, sowie die Höhenburg Bernstein (Bärenstein) auf<br />
dem Hausener Kapf gegen das Tiefental 7 .<br />
Württemberg hatte Jungingen bis 1473 inne und an verschiedene<br />
Adelige verliehen 8 . Angeführt sei noch, daß der zuständige<br />
Bischof II. aus dem Geschlecht der Grafen von Habsburg-Laufenburg<br />
stammte, der von 1274 bis 1293 im Amte<br />
war. Die Burgstelle Hohenjungingen südlich des Dorfes<br />
unterm Himberg hat Oberlehrer Michael Lorch von Killer<br />
mit einigen Helfern ausgegraben und in der »Hohenzollerischen<br />
Heimat« 9 darüber berichtet. Von der Jungentaler<br />
Kapelle, die 1759 ins Dorf Starzein versetzt wurde, ist m. W.<br />
nur noch ein Glöcklein vorhanden, auf dem die Namen der<br />
Evangelisten stehen (ohne Johannes, für den der Platz man-<br />
JOHANN ADAM KRAUS<br />
Zwiefalter Einkünfte aus Jungnau<br />
Vom 2. bis 8. November 1667 hat der Pfleger des Klosters<br />
Zwiefalten zu Bingen namens Christoph Fischer im Auftrag<br />
des Abtes Christoph Rassler die Einkünfte des Klosters im<br />
Jungnauer Bann neu beschrieben. Die vorige Erneuerung<br />
scheint im Jahre 1550 vorgenommen gewesen zu sein. Die<br />
Erlaubnis der weltlichen Obrigkeit, des landgräflich fürstenbergischen<br />
Obervogtes zu Jungnau, Christoph Gumppert,<br />
war dazu eingeholt worden. Gleich eingangs ist bestimmt:<br />
»Beim Untergehen (Feldvermessen) oder sonst sollen die<br />
Grundstücke mit dem Jungnauischen Lehens- oder Holzseil<br />
gemessen werden«, dessen Größe nicht ersichtlich ist 1 . Die<br />
Grundstücke sind samt den Angrenzem nach Jauchert bzw.<br />
Mannsmahd und Zinsern einzeln aufgeführt, lediglich die<br />
Wälder sind merkwürdigerweise nicht vermessen gewesen.<br />
Die Güter zu Inneringen wurden damals nicht renoviert.<br />
Das Kloster Zwiefalten hatte kurz vor 1138 laut Bertholds<br />
Chronik 2 vom Grafen Heinrich d. alt. von Berg, der sich in<br />
der Todesstunde in die Schar der Mönche aufnehmen ließ,<br />
sechs Mansus oder Bauerngüter in Oppintal geschenkt erhalten.<br />
Letzter Rest dieses Dörfleins war der um 1900-1920<br />
mitten zwischen Jungnau und Hornstein (Luftlinie) abgegangene<br />
Hof Hoppental (nicht Mochental bei Kirchen-Ehingen,<br />
wie die württembergischen Forscher bis in neueste Zeit<br />
meinten!). Auch in dessen Nähe, in Ankilkofen und Isinkofen<br />
3 , erhielten die Benediktinermönche damals Güter, nämlich<br />
der gleichnamige Sohn des Grafen, der ebenfalls zum<br />
Schluß seines Lebens Mönch wurde, schenkte zu Ankilhofen<br />
sechs Mansus. Zu beiden Dörfern gehörten damals noch<br />
weitere fünf Mansus, die Abgaben in bestimmter Höhe entrichteten.<br />
Rapoto, der andere Sohn des ersterwähnten Grafen,<br />
schenkte u. a. in Isinkofen eine Mühle.<br />
Der Name Ankilkofen ist nun im Laufe der Jahrhunderte bis<br />
1667 zu Enkelkhofen und Isinkofen zu Ensikhofen abgeschliffen<br />
worden. Die Mühle an letzterem Ort klingt nur<br />
noch in der »Mühlhalde« an. Alle drei Orte gingen wie<br />
Empfingen und Frauensberg sowie ein Sindelfingen*, das in<br />
unserer Beschreibung als Endelfingen erscheint, in Jungnau<br />
auf, der Nachfolgerin von Schiltau, wo die Herren von<br />
Jungingen um 1316 eine zweite Burg gebaut hatten. Ob<br />
zusammen mit den Gütern, wie es sonst üblich war, auch die<br />
Bebauer ans Kloster geschenkt wurden, ist nicht angemerkt.<br />
Auf alle Fälle hat das Kloster Zwiefalten die Grundstücke<br />
nicht selbst bewirtschaftet, sondern sie alle später (wie die<br />
ersten 5 Mansen) gegen Zins an die Leute zu Lehen ausgegeben.<br />
Im Jahre 1667 waren es lauter Erblehen, sie vererbten<br />
sich also auf die ehelichen Kinder. Der Verkauf an andere<br />
26<br />
gelt!). Eine Altarplatte kam nach F.Staudacher im 18. Jh.<br />
nach Salmendingen, und 13Jauchert »Höfleäcker« der<br />
Gemarkung Ringingen gingen um 1810 käuflich auf die<br />
Pächter über.<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Eisele in Mi«. Hohenz. 62, 1931, S. 1 ff.; Zum Wappen: HzJHeft<br />
1960, 142 f.<br />
2<br />
WUB 11, 367; Mi«. Hohenz. 62,7.<br />
3<br />
Affenschmalzer Jahrtag: Hohenz. JHeft 1954, 124.<br />
4<br />
Zollerheimat 1941, 13-17 mit vielen Einzelheiten.<br />
5<br />
Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins 1916, 196: Totenschild.<br />
6<br />
Hohenz. Heimat 1969 Anhang S.7.<br />
7<br />
Hohenz. Heimat 1969 Anhang S.5 und 1970, 41.<br />
8<br />
Hohenz. Heimat 1967, 30.<br />
9<br />
Hohenz. Heimat 1953, 55: 1954, 39; 1965, 4.<br />
Bauern hing von der Genehmigung des Abtes ab, wie es<br />
ausdrücklich in der Einleitung heißt. Es sind, mit einer<br />
Ausnahme, keine ganzen Bauernhöfe mehr, sondern bereits<br />
an Größe und Güte sehr verschiedene Teile geworden, zehn<br />
an der Zahl.<br />
1. Ein bereits in zwei Teile geteilter Hof war teils in Hand<br />
des Schultheißen Hans Flad von Jungnau, teils des Martin<br />
und Andreas Gramman, Gebrüder (zuvor Joseph Gramman).<br />
Sie hatten jährlich 38 Schilling (ß) oder einen<br />
Gulden und 16 Kreuzer an das Kloster und an das Amt<br />
Jungnau 8 Viertel »Gatterhaber« zu geben von insgesamt<br />
45'/2 Jauchert Acker, 6-Vi Mannsmahd Wiesen und zwei<br />
nicht gemessenen Hölzern oder Wäldern. Die anfangs<br />
ziemlich bedeutende Zinssumme von 38 ß war also bis<br />
1667 nur noch 1 fl. 14 kr wert und sank bis zur Aufhebung<br />
des Klosters 1803 noch mehr. Unter den Feldern dieses<br />
Hofes ragt ein Acker mit 8 Jauchert im Oberen Höllweg<br />
hervor, im Unteren Höllweg sogar einer mit 21 Jauchert.<br />
Die Jauchert wird etwa 45 Ar groß gewesen sein. Sonst<br />
finden sich meist nur Grundstücke von Vi bis 4 Jauchert<br />
bzw. Mannsmahd.<br />
2. Hans Kläck-Flad und Jakob Trunks Erben (vorher Jakob<br />
Tanner und Hans Kläck) gaben jährlich 2fl. aus 5 Vi J<br />
'Acker und 6 3 /4 Mm Wiesen.<br />
3. Die Herrschaft Fürstenberg und Kaspar Ostertag (zuvor<br />
Eva Stierin 4a und Georg Sprißler) zinsten aus ihrem<br />
Lehen 32 ß (jetzt 1 fl. 4 kr), nämlich aus 9 J Acker und 7%<br />
Mm Wiesen.<br />
4. Die Herrschaft Fürstenberg und Kaspar Ostertag (zuvor<br />
Eva Stierin) zahlten jährlich 8ß (oder 16 kr) aus 3J auf<br />
Hoppental (an ULB Frauen Stock-Holz von Bingen und<br />
an Gotteshausgütern von Zwiefalten gelegen) und aus<br />
Vi Mm Wiesen im Prüel.<br />
5. Hans Müller, Hans Bamberger und Abraham Trunken<br />
Erben (zuvor Ludwig Wolf und Hans Krammer7 gaben<br />
nach Zwiefalten jährlich 32 ß (bzw. jetzt 1 fl. 4 kr) aus<br />
I4V2J Acker und hVi Mm Wiesen und aus dem Holz<br />
Schweinsfeld.<br />
6. Hans Müller, Hans Bamberger und Abraham Trunken<br />
Erben (zuvor Ludwig Wolf und Hans Grammer!) gaben<br />
aus 1 Lehen 35 ß 4 hl (oder 1 fl. 10 kr und 4 hl) aus 24'/2J<br />
Acker, 7?A Mm Wiesen und 1 Wald am vorgenannten<br />
Holz.<br />
7. Martin Gramman und Hans Schluedin Wirt (zuvor<br />
Joseph Gramman) gaben aus ihrem Lehen 14 ß (oder<br />
28 kr), nämlich aus I5V2J Acker und VA Mm.
8. Joseph Herbst (zuvor sein Vater Hans) zinste nach Zwiefalten<br />
35 ß 4 hl (oder 1 fl. 10 kr 4 hl) aus 18 J Acker und 7 l A<br />
Mm Wiesen.<br />
9. Jakob Herbst (zuvor sein Vater Hans) zinste aus einem<br />
anderen Lehen 14 ß oder 28 kr, nämlich aus I6V4J Acker<br />
und PA Mm Wiesen.<br />
10. Hans Flad, Andreas Gramman, Hieronymus Gramman,<br />
Jakob Trunken Erben und Hans Miller wegen denen von<br />
Kaiseringen zinsen jährlich (zuvor Stephan Gramman<br />
und Hans Pfaff) 1 Pfunde Heller (oder 40 kr), nämlich aus<br />
19V2J Acker und VA Mm Wiesen.<br />
Summa summarum sind es 171 'A Jauchert Acker, 42 3 /t<br />
Mannsmahd Wiesen und einige nicht gemessene Wälder.<br />
»Die von Kaiseringen haben ihren gebührenden Teil nicht<br />
angezeigt.«<br />
An Familien kommen vor: Bamberger, Hans; Blum,<br />
Georg; Danner (Tanner), Jakob und Stoffel selig; Flad, Hans,<br />
Schultheiß; Flad, Georg selig; Gramman (oder Kramer!)<br />
Andreas, Jakobs Sohn; Gramman, Joseph selig; Gramman,<br />
Andreas und Martin, Gebrüder; Gramman, Stephan selig;<br />
Gramman, Hieronymus; Grammer, Hans selig; Grom,<br />
Georg, nach 1667; Gutknecht, Jakob; Herbst, Hans selig;<br />
Herbst, Jakob und Hans; Kläck, Hans = Kläck-Flad, Hans;<br />
Krammer, Hans selig (= Grammer!); Krämer, Matheus;<br />
Maurer, Hans; Müller (Miller), Hans des Bartlins Sohn;<br />
Miller, Klemens, nach 1667; Oschwald, Jakob; Ostertag,<br />
Kaspar; Pfaff, Hans des Klausen Sohn; Reiser, Jakob; Schluedin,<br />
Hans der Wirt; Schluedin, Hansjerg, nach 1667; Schluedin,<br />
Martin; Schnaittenberger, Christian; Schnitzer, Georg;<br />
Sick, Georg der Schmied; Speidel, Hans; Sprißler, Georg und<br />
Christoph; Stier, Eva selig; Trunk, Abraham selig und Jakob<br />
selig; Volk, Christoph; Wolf Ludwig selig.<br />
Aus Bingen sind genannt: Fischer, Christoph; Kappeler,<br />
Michael; Rhein, Jakob. Aus Hornstein: Gasser, Friedrich,<br />
und Sonntag, Jakob. Aus Veringendorf: Fauller, Hans; Hauspach,<br />
Hans; Ruoff, Jakob; Schuler, Hans.<br />
Flurnamen (die Esche sind nicht angegeben) von Ackern:<br />
Uf dem Wuest ob dem Höllwang, stoßt an Haselbrunnen und<br />
Hassis Acker; Im oberen Höllwang, Unterer Höllwang, 21J<br />
unterm Höllwang stoßen aufs Herrschaftsholz, ober auf des<br />
Inhabers Holz, das dem Gotteshaus Zwiefalten gehört. Zu<br />
Enkelkhofen am Kesseltäle; in der Baindhalde (Bindhalde); in<br />
der Mettina (Mettin, Mettna). Am Egelsperg und Kesseltäle;<br />
Wiesacker im Ried, stoßt beiderseits an des Gotteshauses<br />
Holz; im Oeschbrunnen am Herrschaftswald; Wiesacker zu<br />
Enkelkhofen; im Seefeld; zu Ensikhofen, stoßt an die Laudiert.<br />
3 J auf Hoppental (so neunmal), stoßen auf den Junker<br />
von Hornstein und den Binger Wald. Einhalb J daselbst<br />
zwischen dem Heiligen von Jungnau und dem Münchholz;<br />
im Lengenfeld (Lingenfeld). Uf Ensikhofer Staig; an der<br />
Mühlhalde und den Landgarb-Ackern; in Appengruob; im<br />
Tiefental; uf Hoppental an UFr. Stockholz von Bingen und<br />
an den Gotteshausgütern von Zwiefalten; zu Eschbrunnen;<br />
zu Eschbrunnen, stoßen an Laizer Hart und das Herrschaftsholz;<br />
zu Enkelkhofen, genannt Seeacker, stoßen an Baindter<br />
Halde; auf der Höhe; an der Halde ob der Mättin; gegen dem<br />
Engelsperg; am Hertensteiner 5 Ried, stoßt oben an die<br />
Zwiefalter Abtsgüter, unten an Martin Grammans Klostergüter;<br />
im Seefeld, stoßen auf die Straß; zu Enkelkhofen auf der<br />
Höhe; unter dem Weisen Weg; zu Enkelkhofen am Weisen<br />
Weg; im Seefeld, stoßen oben an Egelsperger Staig, unten an<br />
die Straß gegen Grunstaig; uf Hoppental im Zwerchwinkeltäle<br />
am Weg; 1J stoßt an die Mühlhalde; an Unser Frauen<br />
Holz von Bingen; unterhalb an Wuest; im Haubenzeil an den<br />
Reutäckern; auf Mühlhalden am Weg; am Zwerchwinkel; am<br />
Seefeld am Grunstaigweg, stoßt unten an den Trieb; vor<br />
Tiefentäle; auf Leinladt am Wiescker, stoßt unten auf die<br />
Lettenäcker; am Kapf am Trieble, stoßt unten ans Bannen-<br />
täle; im Gäßle, stoßt oben auf die Fuchshalde; im Endelfinger<br />
(Sindelfinger 4 ) Täle, stoßt unten auf die Gasse; im Seefeld,<br />
stoßt unten uf die Mühlwiesen; im Höllwanger Tal am<br />
Hohen Stich, ist ein Anwander; Unter dem Kalchstich an der<br />
Straß, stoßen oben uf den Wyenbrunnen, unten an den<br />
Kalchstich; 1J vor der Pfingsthüttin, stoßt unten auf den<br />
Weyen Brunnen; uf Hoppental an gnäd. Herrschaft Aecker;<br />
überm Haw; bei der Linden, stoßt auf U. Frauen Stockholz<br />
von Bingen und auf das Gotteshaus von Zwiefalten Anwander;<br />
unter dem Wuest, stoßt unten uf Ensikhofer Staig; auf<br />
der Clammen, stoßt an gnäd. Herrschaft Holz; auf Roßfeld<br />
im Münzental, stoßt oben auf die von Hornstein; auf der<br />
Mihlhalde, stoßt hinaus aufs Tiefentäle, vorn gegen dem Weg<br />
an die Mihlhalde; im Seefeld, stoßt unten auf den Trieb gegen<br />
die Brandhalde; auf Binger Weg; auf der langen Mühlhalde;<br />
2V4J auf Hoppental, stoßt auf die vordere Mühlhalde; oben<br />
im Zwerchwinkel, stoßt auf den Hornsteiner Weg; ueber dem<br />
Haw; im Langenfeld, stoßt oben auf Haubenzeil.<br />
Wiesen: Im Hertensteiner 5 Ried zwischen Lauchert und<br />
Holderwies; die Stadtwies; im Ried an Sigmaringer Gassen;<br />
in der Mettna; im Tal hinaus zwischen Lauchert und dem<br />
Gotteshausholz von Zwiefalten; die Talwiesen stoßen an die<br />
von Hitzkofen; im Seetal unter der Steinenbruck zwischen<br />
der Gasse und den Gottshausgütern; an der Schönen zwischen<br />
Lauchert und Zimmerhalden; in der Ziegelwiese an der<br />
Lauchert; in Hertenstein 5 am Wasser, stoßt oben und unten<br />
aufs Sigmaringer Holz; im Priel zwischen Lauchert und Saun;<br />
in Langwiesen, stoßt oben auf des Fleckens Espan, unten auf<br />
die Acker; in der Schönen zwischen Lauchert und Altwasser;<br />
zu Ensikhofen mit der Herdte, zwischen der Gasse und Hans<br />
Schluedin, stoßt an die Lauchert; unter dem Kackelstein 6 am<br />
Felsen und Lauchert; in Fählen (bzw. Fehlen) 7 an der Zimmerhalde<br />
und Lauchert. Zu Hörtenstein 5 stoßt an die Gstadwies<br />
und hinauf auf den Anwander; in Gemeinen Wiesen<br />
zwischen Lauchert und Gasse, streckt aufs Fleckenwiesle;<br />
ebenda im Tiefentaler Weg; auf dem Priel, stoßt oben auf des<br />
Fleckens und des Gotteshauses Espan, unten aufs Katzentürle;<br />
an der Ziegelwies und Beindhalde; auf dem Prüel an<br />
Wädelins Gäßlin; im Tiefental an der Lauchert; die Theuberoder<br />
Scheueries Wies zwischen des Fleckens Espan und<br />
Georg Sick, stoßt unten an des Wädelins Gäßlin; die Seewiese<br />
an der Gasse, anderseits Veringendorfer Wiesen; die Spitzwies<br />
am Wiesacker; auf dem Leinladt an der Kaplaneiwies<br />
von Veringendorf; auf dem Priel, stoßt oben auf den gemeinen<br />
Espan, hinten aufs Katzentürle, ist eine Wechselwies.<br />
Wälder: Ein Stockholz, genannt Schweinsfeld, stoßt heraus<br />
gegen Enkelkhofen; Holz unter dem Weisen Weg zwischen<br />
den Sigmaringern und an Schweinshalden hinein; ein Holz im<br />
Höllwang.<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Jungnauer Erneuerung: Hauptstaatsarchiv Stuttgart, H236,<br />
Nr. 81; Kopie im Staatsarchiv Sigmaringen.<br />
2<br />
E. König und K. O. Müller, Die Zwiefalter Chroniken, 1941, lateinisch<br />
und deutsch, S. 172-173. Schon Arsenius Sulger 1698 und der<br />
wackere Chr. F. Stälin 1847 haben Oppintal irrig mit Mochental bei<br />
Ehingen gleichgesetzt.<br />
3<br />
Die Burg Insinkofen, von der noch einige Mauertrümmer 2,1 km<br />
südlich von Jungnau nahe des linken Lauchertufers zu sehen sind,<br />
wird wohl schon 1138 verlassen gewesen sein (Hohenz. Heimat<br />
1969, Anhang S. 6).<br />
4<br />
Zu Sindelfingen: Mitt. Hohenz. 60, S. 62; Zu den verschwundenen<br />
Orten bei Jungnau vgl. Hohenz. Heimat 1965, S. 38.<br />
4a<br />
Frau bzw. Witwe eines älteren Kaspar Ostertag. Von 1613 an<br />
wurden ihnen 6 Kinder geboren.<br />
5<br />
Die Burg Hertenstein der Herren von Hornstein-Hertenstein auf<br />
Sigmaringer Gebiet, dort wo das Laucherttal sich verengt. Die Burg<br />
war schon 1449 Ruine.<br />
6<br />
Ob Kachelstein oberhalb Veringendorf?<br />
7<br />
Ob die Fehla bei Hettingen-Neufra gemeint war?<br />
27
HANS-DIETER LEHMANN<br />
Zur älteren Vorgeschichte von Kloster Beuron an der Donau<br />
Über die Gründungsgeschichte des Klosters Beuron wurden<br />
in jüngster Zeit widersprüchliche Ansichten vorgetragen.<br />
Anläßlich des 250jährigen Jubiläums der Beuroner Abteikirche<br />
hat sich Schöntag (1988, <strong>1989</strong>) mit den dort dargestellten<br />
Gründungs-Traditionen und ihrem historischen Hintergrund<br />
befaßt. Er sieht in Beuron ausschließlich eine Gründung<br />
der kirchlichen Reform des 11. Jahrhunderts und lehnt<br />
mit Herberhold (1955) die in gefälschter Urkunde behauptete<br />
karolingische Vorläufer-Gründung ab. Gezielte Manipulationen<br />
und dilettantische Fälschungen sollen zur Durchsetzung<br />
unbeweisbarer Rechtsansprüche systematisch die Tradition<br />
eines Alt-Beuron - »Pussen-Buron oder Montburon«<br />
- aufgebaut haben: darnach soll der Schwager Karls des<br />
Großen, der schwäbische Graf Gerold, anno 777 auf dem<br />
Kirchberg bei Fridingen, auf den Jurafelsen hoch über dem<br />
Donaudurchbruch ein Martinskloster gestiftet haben. Anno<br />
1077 soll es in einer Neugründung, dem heutigen Beuron,<br />
aufgegangen sein. Name und Patrozinium sollen dabei in das<br />
Donautal übertragen worden sein. In der Abteikirche sind<br />
beide Gründungen dargestellt. Die Überhöhung der Vorgänge<br />
in diesen Bildern unterstreicht das Streben der Abtei im<br />
18. Jahrhundert nach territorialer und rechtlicher Unabhängigkeit.<br />
In ihm sieht Schöntag den Antrieb für das Kloster,<br />
sich eine frei erfundene Vergangenheit zuzulegen.<br />
Der ein Alt-Beuron ablehnenden Meinung Schöntags stehen<br />
Hinweise entgegen, die diese Traditionen mindestens bis ins<br />
16.Jahrhundert zurück belegen. Stierle (1987) führt neben<br />
dem allein erhaltenen Deckblatt eines Liber fundationum die<br />
Auflistung der Pröpste Beurons an, die der Beuroner Chorherr<br />
und Egisheimer Pfarrherr Pirzschelin in einem Urbar<br />
niedergelegt hat. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts müßten<br />
daneben noch die uns nur auszugsweise erhaltenen Annales<br />
Beuronenses existiert haben. Auch in der Zimmer'schen<br />
Chronik wird bereits in dieser Zeit über den Gründer von<br />
Beuron spekuliert. Die im 18. Jahrhundert im Bild dargestellten<br />
Traditionen können somit nicht frei erfunden sein oder als<br />
späte Erfindungen abgetan werden, nur weil sie heute nicht<br />
mehr urkundlich belegbar sind. Angesichts der Verluste im<br />
Beuroner Archiv erscheinen die dortigen späteren Fälschungsversuche<br />
verständlich: für anno 1571 ist auf dem oben<br />
WOLFGANG HERMANN<br />
erwähnten Deckblatt der Gründungsbeschreibung deren<br />
Raub durch die als Klostervögte fungierenden Herren von<br />
Enzberg bezeugt. Aus der Zeit des Niedergangs Beurons<br />
kennt die Zimmer'sche Chronik einen dort tätigen emsigen<br />
Leimsieder, der auch in den Zimmer'schen Urkundenbeständen<br />
Schaden angerichtet hat.<br />
Im folgenden soll versucht werden, für die umstrittene<br />
Beuroner Gründungs-Tradition auf einen wahren Kern zu<br />
schließen aus Quellen, die nicht von Beuroner Urkunden<br />
abhängen. Dabei wird von drei Tatsachen ausgegangen:<br />
1. vom Namen Beuron und seiner Bedeutung,<br />
2. vom Martins-Patrozinium der sagenhaften Urgründung,<br />
3. von der merkwürdigen Lage Alt-Beurons.<br />
7.um Namen Beuron<br />
Anläßlich der 1000-Jahr-Feier der Abtei Ottobeuren hat sich<br />
Dertsch (1964) mit den Ortsnamen auf -beuren auseinandergesetzt.<br />
Nach gängiger Auffassung (Walter 1948) gehören sie<br />
in die erste mittelalterliche Ausbauphase. Diese lag im<br />
11. Jahrhundert, zur Zeit der Gründung des Reformklosters<br />
Beuron, abgeschlossen lange Zeit zurück. Der Name Beuron<br />
muß für eine Neugründung somit von anderer Stelle in dieser<br />
Zeit übertragen worden sein; für eine Gründung des 11. Jahrhunderts<br />
ist er zu altertümlich. Er wird anno 861 urkundlich<br />
zusammen mit Fridingen und Buchheim genannt. Aus der<br />
Schreibung »in Purron« glaubte Walter (1948) auf das 7. oder<br />
8. Jahrhundert für die Entstehung der Beuren-Namen schließen<br />
zu können.<br />
Dertsch hat für die -beuren-Orte in Ost-Schwaben eine<br />
Funktion als kirchliche Zentren betont. Auffällig häufig ist<br />
der Ortsname im Raum zwischen Flandern und Österreich<br />
mit klösterlichen Niederlassungen verbunden. Aus der gleichen<br />
althochdeutschen Wurzel »bur« in ihrer Bedeutung<br />
eines einräumigen kleinen Gebäudes leiten sich die Ortsnamen<br />
»Betbur« am Ober- und Niederrhein her.<br />
Als Namensdeutung für »Beuren« und das altertümliche<br />
»Beuron« gibt Walter (1948) an: »bei den Schafhäusern«.<br />
Hierauf wird unten zurückzukommen sein.<br />
Das Wasserschloß der Herren von Neuneck (Fortsetzungaus Nr. 1 /<strong>1989</strong>)<br />
1. Allgemeines<br />
Sämtliche acht Fenster sind paarweise von aufgemalten Säulen<br />
eingefaßt. Diese besitzen unterschiedlich ausgeführte<br />
Kapitäle. Die Säulen, die den Eindruck von Rundsäulen<br />
machen, ruhen auf Gesimsen. Über den Fensterwölbungen<br />
sehen wir Guirlanden, die durch Darstellungen aus der<br />
Pflanzen- und Tierwelt ergänzt sind. Eine gleichartige Bereicherung<br />
finden wir unterhalb der aufgemalten Gesimse im<br />
1. Obergeschoß. Die Säulenschäfte haben zwar alle runde<br />
Wülste, insgesamt betrachtet weisen sie jedoch eine Verschie-<br />
28<br />
(Fortsetzung in Nr. 3 / <strong>1989</strong>)<br />
denheit in ihrer Gestaltung aus. Im Untergeschoß wurden<br />
drei horizontale Schießschlitze während der Erbauungszeit<br />
des Schlosses bzw. im Zeitalter der Musketen eingefügt.<br />
Diese drei sind gleichfalls bildnerisch umrahmt. Die beiden<br />
äußeren - jede in einen urwaldhaften Kopf eingearbeitet; zum<br />
Maul wurde der Schießschlitz - befinden sich oberhalb der<br />
äußersten Fenster. Der mittlere Schießschlitz ist nur von<br />
einem aufgemalten Steinwerk umgeben. Auf der darüberliegenden<br />
»Steinbank« sitzen Arabesken 9 auf, welche zwei<br />
Traubendolden umfangen.
2. Besonderheiten der einzelnen Fensterummalungen<br />
a) Uber dem Sturz: Auf den Säulenkapitälen sehen wir<br />
aufrechtsitzende Hasen, die mit ihren Vorderpfoten die<br />
Löffel hochhalten. Unter ihnen schauen Hofnarrengesichter<br />
auf uns herab. In der Mitte des Sturzbogens erblickt man eine<br />
gefüllte Obstschale mit Äpfeln, Birnen und eventuell Bananen.<br />
Unter dem Sims: Eine Laubguirlande mit einer herabhängenden<br />
Hopfenblüte.<br />
b) Über dem Sturz: Auf den Säulenkapitälen erheben sich<br />
bauchige Vasen, die den Leib von Vögeln, ausgestattet mit<br />
Adlerflügeln, bilden. Sie tragen Perlenketten um den Hals,<br />
die auf den Leib herunterhängen. Ihre Augen sind einander<br />
zugewandt. Im langen gebogenen Schnabel trägt der rechte<br />
»Vogel« ein dreiblättriges Kleeblatt, der andere eine nicht<br />
erkennbare Pflanze. Unter den Vögeln, im Kapitell verborgen,<br />
sind Köpfe erkennbar, die statt Ohren Flügel besitzen.<br />
Im Schaitelbogen des Fenstersturzes erblickt man eine Eule,<br />
wobei man an Hieronymus Bosch erinnert wird 10 . Unter dem<br />
Sims: Rechts und links außen sehen wir zwei Rinderköpfe,<br />
die einander nicht anblicken. Aus ihren Mäulern lassen sie<br />
zwei Bänder zur Mitte hin flattern.<br />
c) Über dem Sturz: Auf den Säulen stehen zwei Erdgloben,<br />
und der Äquator ist bei beiden durch einen umlaufenden<br />
Wulst erkennbar. Darunter finden wir »vermenschlichte«<br />
Schweinsköpfe. In der Mitte des Bogens sehen wir Blätter in<br />
arabesker Form. Unter dem Sims: Drei geflügelte Pferde<br />
kommen auf den Betrachter zu. Der mittlere Pferdekopf<br />
gehört zu dem »hinteren« Tier, wobei es uns die Stirn<br />
zuwendet. Die beiden anderen sind vorn zur Linken und<br />
Rechten und sehen sich in die Augen.<br />
d) Über dem Sturz: Über den Säulen erheben sich Amphoren<br />
mit langen schlanken Hälsen. Sie sind mit Obst gefüllt. Die<br />
Kapitäle unter ihnen sind einfach gehalten: es sind lanzettförmige<br />
Blätter. In der Mitte des Bogens sind Blätter wie beim<br />
vorigen Fenster angebracht. Unter dem Sims: Wald- oder<br />
Spitzmäuse mit großen Augen sitzen in gerankten Ästen.<br />
Diese reichen in die Mitte hinein und lassen eine geöffnete<br />
»Blumenzwiebel« herunterhängen.<br />
e) Über dem Sturz: Vom Betrachter her links außen gesehen<br />
und nahe der Ostfassade, blickt ein eberartiges Untier, mit<br />
der Schießscharte als Maul, auf den Betrachter herab. Die<br />
Hauer des Tieres ragen nach oben. Über der Säule an dieser<br />
Fensterseite war für eine zusätzliche Darstellung wegen der<br />
Gestaltung um den Schießschlitz herum kein Platz mehr.<br />
Dafür richtet sich auf der Säule gegenüber eine Meerkatze auf,<br />
die ihren Schweif hochstellt und ihre Zunge weit heraushängen<br />
läßt. In der Mitte des Sturzbogens streben von zwei Seiten<br />
»Schnabeltiere« einer Blüte zu. Unter den oberen Säulenschaftringen<br />
sehen wir Menschengesichter mit weit geöffneten<br />
Mündern. Hinter ihren Wangen stoßen die Haare zur<br />
Seite hin weg.<br />
f) Über dem Sturz: Auf dem rechten Säulenkapitell erhebt<br />
sich ein aufrecht sitzender Hase, der in einem Buch liest. Über<br />
dem linken Kapitell befindet sich die Ummalung des Schießschlitzes.<br />
Auf dem Sturzbogen sind Blätter und Stengel im Stil<br />
eines Kerzenleuchters zusammengefaßt.<br />
g) Über dem Sturz: Es ist das Fenster, das am tiefsten von<br />
allen in den Rundturm eingepaßt ist. Auf den korinthischen<br />
Kapitalen stehen Katzen, die die Schalmeien blasen. Auf dem<br />
Schaitel des Sturzbogens steht eine Vase, übergefüllt mit<br />
Blättern und Gras. Zwei Geißböcke springen von beiden<br />
Seiten auf diese zu. Das Gesims, welches unter diesem Fenster<br />
aufgemalt ist, ist auch das aufwendigste mit zahlreichen, nach<br />
unten kürzer werdenden Bänken.<br />
h) Über dem Sturz: Auf den oberen Säulenzonen sitzen zwei<br />
aufeinander zugewandte Enten, die von Blattwerk umgeben<br />
sind. Beide gehören einzig zur realistisch dargestellten Tierwelt.<br />
In der Mitte schaut der »Waldmensch« hervor, der<br />
Blätter statt Haaren besitzt; keine Ohren, aber dafür<br />
geschwungene kurze Hörner sehen läßt.<br />
Diese Bilderreihung ist am Nordostturm zu sehen, von den<br />
übrigen Rundtürmen birgt nur der Nordwestturm gleichartige<br />
Darstellungen. Diese befanden sich bei der Entdeckung<br />
in einem schlechten Zustand, so daß von einer Sichtbarmachung<br />
weitgehend Abstand genommen wurde. Nur bei zwei<br />
Fenstern waren die Malereien in solcher Qualität, daß sie<br />
sichtbar gemacht wurden. Sie befinden sich analog zu jenen<br />
am Südostturm auf gleicher Geschoßhöhe. Die gesamte<br />
Fensterordnung ist allerdings nach oben bis unter die Traufe<br />
des Rundturms verschoben.<br />
r . J<br />
V<br />
» Waldmensch« Wasserschloß Glatt. Foto W. Hermann.<br />
Auf der steinernen Brücke 11<br />
Der Blick geht nach oben. Betrachten wir die Vorderfront des<br />
mittelalterlich gebliebenen Torturms.<br />
Über dem steinernen Wappenrelief - Hunde halten wie schon<br />
erwähnt den viergeteilten runden Wappenschild - befindet<br />
sich ein weiterer waagerechter Schießschlitz. Darüber sehen<br />
wir die oben beschriebene Wappennische. Zuoberst erblicken<br />
wir eine vergitterte Fensteröffnung. Dem horizontal dreifach<br />
gegliederten Mauerwerk entspricht eine Bemalung in drei<br />
Stufen.<br />
1. Untere Partie<br />
Der Schießschlitz ist farblich »ummauert«. Blatt- und Blütenranken<br />
in Intarsienmanier 12 heben sich weiß vom rötlichen<br />
Farbton ab. Am unteren »Steinfries« hängt eine fledermausartige<br />
Gestalt. Sie besitzt zehn Krallen, die von den gezackten<br />
Flügeln ausgehen. Das menschenähnliche Gesicht mit weit<br />
geöffneten Augen läßt seine Zunge weit heraushängen.<br />
2. Mittlere Partie<br />
Zwei Rundsäulen begrenzen die hölzerne Wappentafel. Beide<br />
Säulen sind mehrfach durch Ringe gegliedert. Ihre Mittelteile<br />
werden von spitzen Blättern begrenzt, die von den Ringen<br />
aufsteigen bzw. abfallen.<br />
3. Obere Partie<br />
Auch die Fensteröffnung ist von zwei Säulen umgeben, und<br />
Schaftringe gliedern diese in drei Zonen. Bemerkenswert ist<br />
jedoch die vom Betrachter aus rechts zu sehende Säule, die als<br />
eine einfache aufsteigt und als Doppelsäule endigt. Ein vier-<br />
29
ändiges Gesims schließt Fenster und Säulen ab. Über dem<br />
Sturz sehen wir ein aufgezäumtes Rößlein, das über ein<br />
Phantasiegesträuch hinwegspringt.<br />
Kommen wir nun zur Westfront des Torturms. Zwei Schießschlitze,<br />
im Abstand von mehreren Metern übereinander,<br />
sind mit einem Mauerwerk wie auf der Frontseite ummalt.<br />
Darüber und darunter ist ein Rankenwerk, ähnlich dem am<br />
Nordostturm, angebracht. Der untere Schießschlitz diente<br />
dem Schützen, der im Durchgang auf Posten stand.<br />
An der Ostfront dieses Turmes haben wir zwei Schießschlitze<br />
wie gegenüber, und zwar in derselben Höhe mit diesen. Die<br />
oberen von ihnen entsprechen in ihrer Höhenanordnung dem<br />
Schlitz in der Eingangsfront unterhalb der neueingefügten<br />
hölzernen Wappentafel. An der Ostseite ist der untere<br />
Schießschlitz farblich umrahmt, jedoch ohne jegliches Beiwerk,<br />
jener darüber mit den bekannten Ranken der Frontpartie:<br />
weiß auf dem rötlich gehaltenen »Mauerwerk«, rot<br />
darunter auf dem weißen Putz. Auf der Oberkante der<br />
Einfassung haben wir wieder Arabesken, und in der Mitte der<br />
Ranken zeigt sich ein Jünglingswesen; halb knieend, halb<br />
sitzend, den Kopf in die rechte Hand gestützt.<br />
In der 3. Zone befindet sich eine Fensteröffnung in der<br />
gleichen Höhe wie an der Nordseite. Die Öffnung an der<br />
Ostseite beträgt aber nur die halbe Breite des Fensters in der<br />
Eingangsfront. Ein Sandsteinquader verringerte die Öffnung;<br />
die Malerei ist aber um die volle Breite ausgeführt. Umgebende<br />
Rundsäulen sind aufgetragen. Sie ruhen auf einem<br />
gebankten Sims und tragen auch einen solchen. Oben, in der<br />
Mitte des Sims, sehen wir den Kopf einer jungen Person.<br />
Lange Haare fallen zu beiden Seiten herab. Rechts und links<br />
auf dem Gesims ruhen zwei Zierformen; Hobelspänen ähnlich<br />
sind die Schmuckformen ausgeführt - und wie diese<br />
haben auch sie eingerollte Enden.<br />
Eine Überraschung brachte die Untersuchung des Tordurchganges<br />
nach irgendwelchen Bildresten. Das Kreuzgratgewölbe<br />
des Durchgangs war durch eine Rotbemalung hervorgehoben<br />
und ein Blütenwerk ersetzte den Schlußstein. Wichtig<br />
für die Geschichte des Schlosses und seiner Nutzung war<br />
die Entdeckung der aufgemalten Jahreszahl 1547. Und unter<br />
derselben fand sich, ca. 1 m lang, der kaiserliche Kammerherrenschlüssel.<br />
Er ist in schwarzer Farbe auf den weißen Grund<br />
aufgetragen, von links unten zu dem Schlüsselbart ansteigend.<br />
Schlüssel und Jahreszahl finden sich im Giebelfeld der<br />
rechten Wand.<br />
Im Hinblick auf die Baugeschichte des Schlosses und die<br />
Biographie Reinharts von Neuneck fällt es noch schwer, die<br />
Jahresangaben 1513 und 1547 zu verbinden. Was baulich in<br />
beiden Jahren geschah, kann nicht bestimmt gesagt werden.<br />
Die Jahreszahl 1513, die sich mit dem Wappen von Neuneck<br />
WALTER KEMPE<br />
über dem Torbogen befindet, könnte sich sowohl mit<br />
Umbauten am Schloß selbst oder nur mit Umgestaltungen am<br />
mittelalterlichen Torturm in Verbindung bringen lassen. Das<br />
Jahr 1513 ist vielleicht auch das Jahr, in dem Reinhart den<br />
Dienst als Marschalk des Pfalzgrafen Friedrich beendete 13 .<br />
Im Jahr 1547 war Reinhart vielleicht für immer in Glatt<br />
ansässig, denn für das folgende Jahr war er für das Ritterviertel<br />
am Neckar und Schwarzwald eingeschriebenes Mitglied H .<br />
Schlußüberlegungen:<br />
Unterweiler und seine Kapelle (Fortsetzung aus Nr. 1 /<strong>1989</strong>)<br />
II. KIRCHENBEHÖRDEN UND PFARREIEN<br />
Der politischen Veränderung nach 1806 folgte dann eine neue<br />
kirchliche Gliederung. Zuständig wurde nach einer Übergangszeit<br />
für die Orte des Königreichs Württemberg das<br />
Bistum Rottenburg bzw. der königliche katholische Kirchenrat<br />
in Stuttgart.<br />
Das hohenzollerische Ostrach gehörte bekanntlich seit 1811<br />
zum Kapitel Sigmaringen der katholischen Kirche, das dann<br />
1827 dem aus Baden und Hohenzollern gebildeten Erzbistum<br />
Freiburg unterstand.<br />
Diese Neuorganisation brachte eine Kontroverse über Unterweiler<br />
mit sich, die einige Jahrzehnte dauerte.<br />
30<br />
Wir fragen bei jeder Handlung nach dem Grund, hier können<br />
wir fragen, »Wozu diese Bildwerke an den Mauern des<br />
Wasserschlosses?« Wollte der Schloßherr die Besucher aufmuntern<br />
oder ihnen gar seine Launen vorführen, bevor diese<br />
über die Brücke in den inneren Schloßhof einzogen?<br />
Der Verfasser sieht sich nicht für kompetent an, über die<br />
Beschreibung der Bilder hinaus eine Deutung zu geben. Als<br />
Laie kann man die Symbole und Gestalten betrachten, weggehen<br />
und sagen: Welch ein Unsinn! Wenn die Bilder uns heute<br />
fremd sind, so waren sie den früheren Menschen vielleicht<br />
näher. Besaßen sie den Schlüssel, um zu begreifen, welche<br />
Interpretation der Welt hier gegeben wurde? Oder gehen die<br />
Bildwerke lediglich auf die persönliche Haltung und Weltsicht<br />
des Schloßherrn zurück, die Zeit im Narrenspiegel zu<br />
sehen?<br />
Die Fachleute mögen die Gelegenheit ergreifen, um aus ihrem<br />
Wissen heraus dem heutigen Betrachter »Lesehilfen« zu<br />
geben. Ernste Besucher könnten sich die Frage vorlegen, ob<br />
sich nicht doch hinter allen Bildern Wahrheiten verbergen,<br />
die unsere modernen Anschauungen in Zweifel ziehen.<br />
9<br />
Arabeske: (ital.) Ornament aus Blatt- und Rankenwerk, das<br />
plastisch aufgefaßt und in seiner Bewegung pflanzlichen Vorbildern<br />
nachgeformt ist.-Karl Busch und Hans Reuther, Welcher Stil<br />
ist das, Stuttgart 1964, S. 166<br />
10<br />
Heinrich Goertz, Bosch, Rowohlt Bildmonographien Nr. 237,<br />
Hamburg 1985. Dort findet sich noch eine ausführlich zitierte<br />
Literatur.<br />
11<br />
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die Brücke über den Graben<br />
noch als Zugbrücke ausgeführt. Dies ersieht man aus dem<br />
»Anschlag zu den Verkaufsverhandlungen mit dem Kloster Muri«<br />
vom 22. Febr. 1705. - DS-Glatt, 151, Nr. 75.<br />
12<br />
Intarsia, ursprüngl. in Holz eingelegte Arbeit. Vorzugsweise in<br />
der ital. Frührenaissance, vor allem im Chorgestühl in der Certosa<br />
bei Pavia oder Sta. Maria Novella in Florenz. Intarsienmalerei galt<br />
dann als Ersatz für die mühevolle Einlegearbeit. - Brockhaus<br />
Konversationslexikon Bd. 9, Leipzig 1894, S. 641 und Tafel davor.<br />
13<br />
Joh. Ottmar, Die Burg Neuneck und ihr Adel, Göppingen 1974,<br />
S. 225<br />
14<br />
Dieter Hellstern, Der Ritterkanton Neckar-Schwarzwald<br />
1560-1805, Tübingen 1971, S.210<br />
Wenn wir Professor Memmingers Beschreibung des Oberamts<br />
Saulgau aus dem Jahre 1829 aufschlagen, so finden wir<br />
unter Unterweiler: »katholischer Weiler... Filial von Wald<br />
(Königseggwald), Hoßkirch und Ostrach, deren Pfarrer sich<br />
auch in die Zehnten teilen...« 10 .<br />
Der katholische Kirchenrat in Stuttgart wollte nun nach 1811<br />
den Zehntanteil der hohenzollerischen Pfarrei für Unterweiler<br />
ablösen und die Höfe den württembergischen Pfarreien<br />
Hoßkirch oder Königseggwald zuschlagen. Dies mißlang, da<br />
die Pfarrei Ostrach nachweisen konnte, daß schon 1224 bzw.
1324 dieses Zehntrecht als Teil der Pfarrpfründe vom Kloster<br />
Salem zugewiesen worden war. Die Ausstattung war noch<br />
rechtsbeständig, zumal sie das Kloster Salem 1491 dem<br />
Pfarrer Georg Moriz und 1593 dem Pfarrer Georg Weiß<br />
bestätigt hatte.<br />
Ähnliche Argumente galten für das andere württembergische<br />
Filial Laubbach 24a+b .<br />
Im Handbuch der Erzdiözese Freiburg erschienen dann auch<br />
1863 Unterweiler, Laubbach und Jettkofen weiterhin als<br />
Filialen der Pfarrei Ostrach 24 .<br />
III. DIE KAPELLE VON UNTERWEILER<br />
In diesem Handbuch sind als Kapellen der Pfarrfilialen von<br />
Ostrach aufgeführt:<br />
St. Nikolai zu Laubbach<br />
St. Wendelin zu Kalkreute<br />
St. Michael zu Wangen<br />
St. Catharina zu Jettkofen<br />
früher: Unserer Lieben Frau,<br />
heute: St. Wolfgang<br />
Die Kapelle von Unterweiler fehlt.<br />
Auch in den Pfarrbeschreibungen von Hoßkirch und<br />
Königseggwald des Diözesanarchivs Rottenburg aus der<br />
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts wird die Kapelle nicht genannt.<br />
Lediglich im Realkatalog des Bistums Rottenburg von 1905<br />
ist unter Hoßkirch von einer Kapelle »bei Unterweiler« die<br />
Rede, mit dem Vermerk »bloß zur Privatandacht« 25 .<br />
Im neuen Gemeindearchiv Ostrach und im Pfarrarchiv<br />
Ostrach, das wir z. Zt. neu ordnen, fanden sich in Urkundenbüchern,<br />
Akten und Beschreibungen:<br />
1. unter Unterweiler aus dem Jahre 1840: »Eine Kapelle mit<br />
Plattendach und einem blechbedeckten Glockengestell.<br />
Ohne standesherrliche Bauleistung (Unterhaltsverpflichtung),<br />
Mauerstock und Eisenwerk. Brandkatasterwert 200<br />
Gulden. Inhaber: Ortsgemeinde 26 .<br />
2. Im Kirchenbuch der Ostracher Filialorte Jettkofen, Laubbach<br />
und Unterweiler liegt ein Fragment mit der Titelseite<br />
Weiler, 1808, 5 Bauern(höfe), 1 Capelle des Heiligen Johannes<br />
von Nepomuk - keine eigene Schule - zählt 32 Seelen 27 .<br />
Hiermit steht fest, daß im Jahre 1808 das Patrozinium des hl.<br />
Johannes von Nepomuk galt. Das Bild des Patrons hängt in<br />
der Kapelle neben dem Altar.<br />
In der amtlichen Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden<br />
des Landes Baden-Württemberg von 1978 ist unter Unterweiler<br />
vermerkt: Hochbarock-Kapelle zu den 14 Nothelfern<br />
(17./18. Jahrhundert).<br />
Ein weiteres Bild in der Kapelle stellt die 14 Nothelfer mit<br />
Gebetsanrufung dar und ist mit der Jahreszahl 1804 versehen.<br />
Ob 1804 das Patrozinium der 14 Nothelfer galt, ist noch<br />
offen. Die Jahreszahl 1803 trägt ein Bild des hl. Andreas mit<br />
Christkind. Das 4. Bild, Kreuzabnahme, unter Halbfiguren<br />
der hll. Andreas und Katharina, trägt die Inschrift: Katharina<br />
Duellin Müllerin aus Yeckofen, 1816<br />
Die Müllersfamilie Duelli-Köberle<br />
Es ist anzunehmen, daß die Müllers-Familie in Jettkofen<br />
etwas mit der Stiftung der Kapelle zu tun hatte, zumal der hl.<br />
Johannes von Nepomuk auch als Patron der Müller gilt.<br />
Wann die Kapelle erbaut wurde, konnte noch nicht ermittelt<br />
werden. Es muß jedoch vor 1803 gewesen sein.<br />
Wie wir gesehen haben, bestanden zumindest pfarrmäßige<br />
Verbindungen zwischen Jettkofen und Unterweiler. Im<br />
Familienregister des vorgenannten Kirchenbuches konnte<br />
dann unter Jettkofen Näheres über Katharina Duelli gefunden<br />
werden (die Endsilbe »in« beim Familiennamen wurde<br />
damals für weibliche Familienmitglieder verwendet).<br />
Sie heiratete 1773 in Jettkofen den dortigen Müller Bonifatius<br />
Andreas Köberle, der 1806 starb. Ihr Sohn Karl, geb. 1781,<br />
dürfte die Nachfolge als Müller angetreten haben. Er heiratete<br />
1815. Ein Jahr später, 1816, wurde das 1. Kind, Franz Joseph,<br />
geboren. Es starb nach neun Monaten 28 .<br />
Die Geburt des vermutlich kranken Enkels könnte mit der<br />
Jahreszahl und dem Namen der (Witwe) Katharina Duellin<br />
auf dem Bild zusammenhängen.<br />
Pfarrer Joseph Anton von Mader (von 1816-1858 in Ostrach)<br />
erneuerte laut Pfarrchronik von Ostrach 1819 die Familienregister<br />
29 . Er erstellte im Jahre 1835 auch einen Stammbaum der<br />
Familie Duelli, wie er damals bei Stiftern von Jahrtagen üblich<br />
war. Es war der Stammbaum der Abkömmlinge des Amtmanns<br />
Franz Ignat Duelli mit seiner zweiten Frau Barbara,<br />
geb. Braun. Die Ehe wurde am 1. 5.1740 geschlossen. Katharina<br />
war das dritte Kind dieser Verbindung 30 .<br />
Es stellte sich heraus, daß die Familie Braun, vermutlich<br />
gleichen Stammes, schon 1623 sowohl in Jettkofen als auch in<br />
Unterweiler (Königseggsche Herrschaft) wohnte: Georg,<br />
Christian, Maria, Waldtpurga und Barbara Braun verkauften<br />
am 6. Mai 1623 gemeinsam ein halbes Haus in Ostrach 31 . Dies<br />
gehörte wahrscheinlich rund 60 Jahre zuvor, am 22. September<br />
1564, dem Christa Broun (Braun) und lag neben der<br />
unteren Schmiede, unterhalb der Kaplanei 32 .<br />
Wie zu erwarten, hat es damals verwandtschaftliche Beziehungen<br />
zwischen Einwohnern von Jettkofen und Unterweiler<br />
gegeben.<br />
Eine Reihe von Fragen über Unterweiler konnten geklärt<br />
werden. Das genaue Alter und der Anlaß der Errichtung der<br />
Kapelle wird jedoch nur noch zu ermitteln sein, wenn es<br />
gelingt, diesbezügliche Urkunden oder sonstige alte Schriftstücke,<br />
eventuell in privater Hand, zu finden.<br />
Zum Schluß soll noch darauf hingewiesen werden, daß die<br />
Holzbildwerke<br />
1. Johannes Evangelist (2. Hälfte des 15. Jhs.)<br />
2. hl. Bischof (15./16. Jh.)<br />
3. Auferstehungschristus (1. Drittel des 16. Jhs.)<br />
4. hl. Rochus (spätes 17. Jh.) 33<br />
wahrscheinlich, wie damals öfters üblich, aus älteren, neu<br />
hergerichteten Kirchen der Umgebung übernommen wurden<br />
und keinen Anhaltspunkt für das Alter der Kapelle geben.<br />
24<br />
Kath. Pfarramt Ostrach, Realschematismus der Erzdiözese Freiburg,<br />
Freiburg 1863, S. 523, Pfarrei Ostrach.<br />
24a<br />
Kath. Pfarrarchiv Ostrach, Zehntablösung der Pfarrei Ostrach<br />
1853-1854.<br />
24b<br />
StA Sigmaringen, Ho 199, Pk79, OA Sigmaringen, Acta betr.<br />
Pfarrei Ostrach 1856 und Ho207, 1815-1820; 1854; 109 II 2866.<br />
25<br />
Persönliches Schreiben vom 6.2.1987 vom Diözesanarchiv Rottenburg.<br />
26<br />
Gemeindearchiv Ostrach, Abt. Laubbach-Unterweiler, Brandversicherungskataster,<br />
1815 und 1840, Königl. Bezirksamt Aulendorf,<br />
Unterweiler, Nr. 17.<br />
27<br />
Kath. Pfarrarchiv Ostrach, Familienregister.<br />
28<br />
Wie Anm.27.<br />
29<br />
Kath. Pfarrarchiv Ostrach, Beiträge zu der Pfarrchronik von<br />
Ostrach.<br />
30<br />
Dto., besondere Familiensachen.<br />
31<br />
Wie Anm. 17, Ho 158, 1623, 6. Mai.<br />
32<br />
Wie Anm. 17, Ho 158, 1564, 22. Sept.<br />
33<br />
v. Matthey, Die Kunstdenkmäler des Kreises Saulgau, Deutsche<br />
Verlagsanstalt, 1938, S. 102.<br />
31
Verlag: <strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Karlstraße 3, 7480 Sigmaringen<br />
M 3828 F<br />
Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt.<br />
Ein großer Bildhauer<br />
Z.um Tode von Josef Henselmann<br />
Einer der angesehensten Künstler unserer Zeit, der Bildhauer<br />
Josef Henselmann, ist am 19. Januar 1987 im gesegneten Alter<br />
von 88 Jahren von uns gegangen. Sein Name und sein Werk<br />
gehören mit in den großen religiösen Aufbruch, den die<br />
Kunst trotz aller Verweltlichung in diesem unserem Jahrhundert<br />
erfahren hat. Es ist eine Bewegung, die sich auch in<br />
unserer Zeit fortsetzt, Aufnahme bei den Jüngeren findet.<br />
Henselmann arbeitete gegenständlich und vor allem in Holz.<br />
Er war Schwabe (aus Laiz bei Sigmaringen), seine Eltern<br />
waren Bauern und Müller, die ihren Bub aber aufs Gymnasium<br />
schickten, offenbar, damit er einmal Theologie studiere.<br />
Doch zuerst mußte er als junger Soldat in den Ersten<br />
Weltkrieg. Zurückgekehrt, ging er nicht ins Priesterseminar,<br />
sondern nach München an die Kunstakademie, um Bildhauer<br />
zu werden. Es waren jene unruhigen zwanziger Jahre, als alt<br />
und neu heftig miteinander stritten. Der ruhig bedächtige<br />
Henselmann gehörte wohl eher zu den Konservativen, natürlich<br />
öffnete er sich auch dem expressionistischen Zug der Zeit.<br />
Schon früh wurde der Hochbegabte ausgezeichnet: 1925 mit<br />
dem Preußischen Staatspreis, 1930 mit dem Villa-Romana-<br />
Preis und im Alter von 38 Jahren war er schon Professor (an<br />
der Staatsschule für angewandte Kunst in München). An der<br />
Kunstakademie lehrte er dann von 1945 bis 1968, lange Jahre<br />
als deren Präsident.<br />
Die bedeutendsten Werke von Henselmann sind in Kirchen<br />
zu finden, am berühmtesten sind die monumentalen Hochaltäre<br />
in den Domen von Passau und Augsburg und das<br />
Triumphkreuz im Münchener Liebfrauen-Dom. Diese und<br />
viele Arbeiten in anderen Städten sind ohne Zweifel bedeutende<br />
Beiträge zur modernen christlichen Großplastik, wobei<br />
Henselmann zeigt, daß es durchaus möglich ist, in unbedingter<br />
moderner Formensprache, einen überzeugenden sakralen<br />
Ausdruck zu schaffen. Vor allem die harmonische Einfügung<br />
in die alten - wenn auch modernisierten - Sakralräume der<br />
Gotik und des Barock sind und bleiben bemerkenswert.<br />
Doris Schmidt schrieb in ihrem Nachruf in der »Süddeutschen<br />
Zeitung«: »Henselmanns bedeutendste Arbeiten sind<br />
aus der Geschichte der Nachkriegszeit nicht fortzudenken.«<br />
(Erschienen in Christ in der Gegenwart Nr. 6 1987)<br />
Mitgeteilt von Frau Hedwig Maurer, Lörrach<br />
HOHENZOLLERISCHE HEIMAT<br />
hrsggbn. vom Hohenz. <strong>Geschichtsverein</strong>.<br />
Die Zeitschrift »Hohenzollerische Heimat«<br />
ist eine heimatkundliche Zeitschrift. Sie will<br />
besonders die Bevölkerung in Hohenzollern<br />
und der angrenzenden Landesteile mit der<br />
Geschichte ihrer Heimat vertraut machen. Sie<br />
bringt neben fachhistorischen auch populär<br />
gehaltene Beiträge.<br />
Bezugspreis: 8.00 DM jährlich.<br />
Konto der »Hohenzollerischen Heimat«:<br />
803843 Hohenz. Landesbank Sigmaringen<br />
(BLZ 65351050).<br />
Druck:<br />
M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co.,<br />
7480 Sigmaringen, Karlstraße 10.<br />
32<br />
Die Autoren dieser Nummer:<br />
Prof. Dr. Eberhard Gönner<br />
Tailfinger Straße 39<br />
7000 Stuttgart 80<br />
Wolfgang Hermann<br />
Fischinger Straße 55<br />
7247 Sulz<br />
Walter Kempe, Apotheker<br />
Silcherstraße 11<br />
7965 Ostrach<br />
Pfr. Johann Adam Kraus<br />
Badstraße 2<br />
7800 Freiburg-Littenweiler<br />
Dr. Hans Dieter Lehmann<br />
In der Ganswies 1<br />
7457 Bisingen<br />
Dr. Herbert Rädle<br />
Veit-Jung-Straße 13 a<br />
8430 Neumarkt<br />
Leserbriefe<br />
Hunger jähre 1816/17<br />
Frau Margarete Stein aus Ringingen schreibt uns: In einer<br />
Rosenkranzbibel, gedruckt im Jahr 1715, ist ein handschriftlicher<br />
Eintrag enthalten von einem Zimmergesellen aus dem<br />
Jahr 1817. Dieser Eintrag lautet wie folgt:<br />
»Anno 1817habe ich in Mösskirch gearbeitet. Mein Lohn war<br />
34 Kreuzer davon hab ich müssen leben und ein Viertel<br />
Kernen hat 6 Gulden gekost und 1 Pfd. Brot 20 Kreuzer und<br />
ein Pfund Schmaltz 52 Kreuzer. Da ist grosse Noth gewest im<br />
ganzen Land. Nun habe ich nicht mehr können leben. Nach<br />
diesem bin ich nach Mengen, dort war es noch viel ärger. Dort<br />
hat das Viertel Kernen 11 Gulden und 45 Kreuzer kost und<br />
ein Viertel Gersten 8 Gulden und bey der Zeit sind viel Leut<br />
gestorben wegen dem grossen Hunger. Bitte Gott inständig,<br />
dass er uns nicht gar verlasse. Von dieser Zeit kann man noch<br />
sagen in vielen Jahren wann wir nicht mehr leben.<br />
Dieses habe ich geschrieben<br />
Johann Georg Heinzelmann, Zimmergesell<br />
Ich habe es wohl auch erfahren, man hat sich müssen an den<br />
Brinnesslen (Brennesseln) und anderen Kräuter ernähren.«<br />
Bildnis des Eitelfriedrich III.<br />
Zum Beitrag Herbert Rädles über das Bildnis des Eitelfriedrich<br />
III. von Zollern (HH 38 S. 61 f.) ist anzumerken, daß die<br />
Identifizierung des sogen. Meisters von Meßkirch mit Peter<br />
Strüb d. J., wie sie Chr. Altgraf Salm und Dr. Ingenhoff<br />
vertreten, keineswegs einwandfrei erwiesen ist. Rädle scheint<br />
auch die Abhandlung von Dr. Josef Hecht über dieses Bildnis<br />
im Hohenz. Jahresheft 7 (1940) nicht zu kennen. S. 69 weist<br />
Hecht auf Hermann Voß hin, der das Sigmaringer Bild auf die<br />
Vorlage im Vatikan zurückführt (1910!). Hecht und Feuerstein<br />
stimmen dieser Möglichkeit zu. 9.1.89 J.S.B. (Josef<br />
Schülzle, Burladingen)<br />
Schriftleitung:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth,<br />
7487 Gammertingen Telefon 07574/4211<br />
Die mit Namen versehenen Artikel geben die<br />
persönliche Meinung der Verfasser wieder;<br />
diese zeichnen für den Inhalt der Beiträge<br />
verantwortlich. Mitteilungen der Schriftleitung<br />
sind als solche gekennzeichnet.<br />
Manuskripte und Besprechungsexemplare<br />
werden an die Adresse des Schriftleiters erbeten.<br />
Wir bitten unsere Leser, die »Hohenzollerische<br />
Heimat« weiter zu empfehlen.
HÖH ENZOLLERISCHE<br />
HEIMÄT<br />
rrfAttl<br />
Herausgegeben vom<br />
Schloß Bergh nach seinem Wiederaufbau 1942<br />
M 3828 F<br />
Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
39. Jahrgang Nr. 3 / September <strong>1989</strong><br />
Über den niederländischen Besitz des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen und die Linie Hohenzollern-Sigmaringen-Bergh<br />
berichtet Dr. Otto H. Becker in diesem Heft.
OTTO H. BECKER<br />
Der ehemalige Besitz<br />
des Hauses<br />
Hohenzollern-Sigmaringen<br />
in den Niederlanden<br />
Ein historischer Rückblick unter<br />
Berücksichtigung der Partnerschaft<br />
zwischen Boxmeer und Sigmaringen<br />
1) Vorbemerkung<br />
Die unmittelbar wohl bedeutendste Auswirkung der französischen<br />
Revolution auf die deutsche Geschichte war die<br />
territoriale Umgestaltung Deutschlands und die daraus resultierende<br />
Auflösung des Alten Reiches im Zeitalter Napoleons.<br />
Wie Fritz Kallenberg herausgearbeitet hat, gelang es den<br />
Fürsten von Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-<br />
Sigmaringen vor allem dank der Rückendeckung des stammverwandten<br />
preußischen Königshauses und der guten Beziehungen<br />
der Fürstin Amalie Zephyrine von Hohenzollern-<br />
Sigmaringen (1760-1841) zum Hof Napoleons der damals<br />
drohenden Mediatisierung 1806 durch ihre Aufnahme als<br />
souveräne Fürsten in den Rheinbund zu entgehen.<br />
Grundvoraussetzung für die Rangerhöhung der hohenzollernschen<br />
Fürsten war ihre Einbeziehung in das Entschädigungsgeschäft<br />
der Säkularisation 1802/3, wozu der Verlust<br />
ihrer Feudalrechte in den Niederlanden die rechtliche Grundlage<br />
bot. So erhielt Fürst Hermann von Hohenzollern-<br />
Hechingen (1751-1810) im Reichsdeputationshauptschluß<br />
1803 für seine verlorenen Feudalrechte in der Grafschaft<br />
Geulle und in den Herrschaften Mouffrin und Baillonville die<br />
dem Stift Kreuzlingen gehörige Herrschaft Hirschlatt in<br />
Oberschwaben und das landsässige Kloster Stetten. Durch<br />
das Reichsgesetz wurde dem Hechinger Fürsten außerdem<br />
das Recht eingeräumt, die in seinem Territorium gelegenen<br />
Klöster Rangendingen und St. Luzen sowie das Hechinger<br />
Kollegiatstift einzuziehen.<br />
Noch günstiger fiel die Entschädigung des Fürsten Anton<br />
Aloys von Hohenzollern-Sigmaringen (1762-1831) aus. Dieser<br />
erhielt im Reichsdeputationshauptschluß für seine verlorenen<br />
Feudalrechte in den Herrschaften Boxmeer, Dixmuiden,<br />
Bergh, Gendringen, Etten, Wisch, Pannerden und Millingen<br />
die dem Kloster Muri in der Schweiz zugehörige<br />
Herrschaft Glatt, das Augustinerchorfrauenstift Inzigkofen,<br />
das Augustinerchorherrenstift Beuron und das Benediktinerinnenkloster<br />
Holzen bei Dillingen in Bayerisch Schwaben.<br />
Die niederländische Erbschaft begründete wie Fritz Kallenberg<br />
einmal wohl zurecht feststellte, den späteren Reichtum<br />
der bis dahin keineswegs wohlhabenden Sigmaringer Linie.<br />
Der Bedeutung der niederländischen Besitzungen für das<br />
Haus Hohenzollern-Sigmaringen und damit auch für die<br />
34<br />
Landesgeschichte Hohenzollerns eingedenk, soll im folgenden<br />
deren Erwerb kurz beleuchtet und danach ihre geschichtliche<br />
Entwicklung im Rahmen des Fürstl. Gesamtbesitzes bis<br />
zum endgültigen Verkauf im Jahre 1912 dargestellt und<br />
abschließend auf die bestehenden Beziehungen zwischen<br />
Boxmeer in Holland mit Sigmaringen eingegangen werden.<br />
2) Die niederländische Erbschaft des Hauses Hohenzollern-<br />
Sigmaringen<br />
Der Erwerb der Besitzungen in den Niederlanden war das<br />
Ergebnis einer geglückten dynastischen Heiratspolitik. 1666<br />
heiratete Fürst Maximilian I. von Hohenzollern-Sigmaringen<br />
(1636-1689) die Gräfin Maria Clara von Bergh (1644-1715),<br />
deren Bruder, Graf Oswald III. von Bergh, 1712 als letzter<br />
Sproß seines Geschlechts starb. Der Graf hatte in seinem<br />
Testament die Fürstin Maria Clara zu seiner Universalerbin<br />
mit der Auflage eingesetzt, daß sie ihre Rechte an ihren<br />
zweitgeborenen Enkel, den Grafen Franz Wilhelm von<br />
Hohenzollern-Sigmaringen (1704-1737), abtreten und dieser<br />
den Namen und das Wappen des gräflichen Hauses Bergh als<br />
»Graf zum Bergh und Hohenzollern« annehmen und in den<br />
Niederlanden residieren sollte.<br />
Graf Franz Wilhelm zog nach Bergh und begründete die<br />
Nebenlinie Hohenzollern-Sigmaringen-Bergh. Seine älteste<br />
Tochter, die Gräfin Johanna von Hohenzollern-Bergh<br />
(1727-1787), wurde 1749 mit ihrem Vetter, dem damaligen<br />
Erbprinzen Karl Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen<br />
(1724-1785) verheiratet. Die jüngere Tochter Maria Theresia<br />
war Stiftsdame in Remiremont (Vogesen); sie starb am 28.10.<br />
1800 in Sigmaringen.<br />
Die Nachfolge des Grafen Franz Wilhelm in Bergh trat 1737<br />
dessen Sohn, Graf Johann Baptist von Hohenzollern-Bergh<br />
(geb. 1728), an, der als »der tolle Graf« noch heute im<br />
Gedächtnis vieler Niederländer lebendig ist. Durch seine<br />
unglückliche Ehe mit der Gräfin Maria Benonia von Lodron<br />
endgültig aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht, zeichnete<br />
er sich eigentlich nur durch Untaten aus. So erstach er<br />
offensichtlich grundlos 1748 den Kaufmann Ansay in Boxmeer<br />
auf offener Straße. Seiner Gefangennahme durch den<br />
Rat von Brabant entzog er sich durch Flucht. Sein Vorhaben,
in preußischen Militärdiensten unterzutauchen, lehnte König<br />
Friedrich II. rundweg ab.<br />
Er lebte anschließend, von seiner Gemahlin getrennt, vornehmlich<br />
in seiner Herrschaft Boxmeer an der Maas. Dort<br />
schoß er 1757seinen Diener, den Husar Friedrich, mit dem er<br />
wegen der Politik in Streit geraten war, nieder. Er ergriff<br />
sofort die Flucht und nachdem sein Gesuch an das Kapuzinerkloster<br />
Rheinberg, ihm Asyl zu gewähren, abgelehnt<br />
wurde, ließ er sich vom Husarenkorps des französischen<br />
Partisanenobersten Fischer anwerben. Auch mit diesem<br />
Korps verübte der »tolle Graf« viele Gewalttätigkeiten.<br />
Schließlich wurde Graf Johann Baptist 1758 durch österreichische<br />
Truppen im Franziskanerkloster in Elten, wo er<br />
Unterschlupf gefunden hatte, verhaftet und auf die Feste<br />
Hohentwiel gebracht. Da sein Schwager, Fürst Karl Friedrich,<br />
auch dieses Gefängnis als zu unsicher wähnte, wurde der<br />
Graf schließlich nach Haigerloch übergeführt, wo er nach<br />
20jähriger Haft als letzter männlicher Abkömmling des Hauses<br />
Hohenzollern-Bergh 1781 an einem Herzschlag starb.<br />
Die Grafschaft Bergh mit Zubehörungen fiel an seine älteste<br />
Schwester, die nunmehrige Fürstin Johanna von Hohenzollern-Sigmaringen.<br />
Nach dem Tod der Fürstin 1787 gelangte<br />
diese an ihren Sohn, den Fürsten Anton Aloys (1762-1831),<br />
und damit an das Haus Hohenzollern-Sigmaringen.<br />
Den Mittelpunkt des ererbten Komplexes bildete die alte<br />
Grafschaft Bergh mit dem Hauptort 's Heerenberg und den<br />
dazugehörigen Herrschaften Wisch, Gendringen und Etten<br />
mit den Orten Pannerden, Millingen, Bylandt und Ogten in<br />
der Provinz Geldern am Niederrhein. Ferner gehörten dazu<br />
der Besitz der Freiherrlichkeit Boxmeer an der Maas und<br />
Herrschaft Dixmuiden in Flandern. Der Erbfall setzte das<br />
Haus Hohenzollern-Sigmaringen nach über 200 Jahren wieder<br />
in die Lage, bedeutendere Ankäufe zu tätigen. Es waren<br />
dies 1786 der Kauf der Herrschaft Bittelschieß bei Krauchenwies<br />
und 1789 der Erwerb der Herrschaft Hornstein mit dem<br />
halben Dorf Bingen.<br />
3) Der Besitz in den Wirren der französischen Revolution<br />
und in der Zeit Napoleons<br />
Die niederländischen Besitzungen, die übrigens niemals mit<br />
dem Fideikommiß des Fürstl. Hauses verbunden wurden,<br />
bereiteten Fürst Anton Aloys in der Folgezeit viele Sorgen<br />
und Probleme. So wurde der Komplex Grafschaft Bergh mit<br />
Zubehörungen infolge der Expansion des revolutionären<br />
Frankreichs auf dem linken Rheinufer beschlagnahmt und die<br />
mit den Gütern verbundenen Hoheitsrechte verstaatlicht.<br />
Der Diplomatie des Fürsten ist es dann aber nach größten<br />
Anstrengungen gelungen, 1801 von der Batavischen<br />
Republik, wie die Niederlande nunmehr genannt wurden, für<br />
325000 fl den größten Teil seines Besitzes in der Provinz<br />
Geldern aus der Beschlagnahme auszulösen und 1802 darüber<br />
hinaus, worauf eingangs schon hingewiesen wurde, für den<br />
Verlust der Feudalrechte in den Niederlanden mit Säkularisationsgut<br />
im Umkreis der gefürsteten Grafschaft entschädigt<br />
zu werden.<br />
Demgegenüber gelang es Fürst Anton Aloys nicht, die<br />
Beschlagnahme der Freiherrlichkeit Boxmeer rückgängig zu<br />
machen. Er überließ schließlich 1804 die Herrschaft mit dem<br />
Millinger Weerd kaufweise der Batavischen Republik. Im<br />
gleichen Jahr trat der Fürst die Herrschaft Dixmuiden an<br />
Frankreich ab. Die Güter zu Pannerden hatte der Fürst<br />
bereits 1801 für 230000 fl an den Rentmeister van Nispen und<br />
an den Generaladministrator van Hoevel verkauft.<br />
Diese Entwicklung beschrieb der Geheime Rat von Huber in<br />
einem Bericht aus dem Jahre 1819 mit den folgenden Worten:<br />
»Die Domainen des gräflichen Hauses Bergh, als selbe an das<br />
Fürstliche Haus Hohenzollern Sigmaringen gelanget, sind<br />
von bedeutendem Umfange, vielleicht der schönste und<br />
größte Güterbesitz in Holland gewesen. Die Stürme der<br />
Staatsumwälzung, beträchtliche in diesen Zeiten, und noch<br />
früher vorgenom[m]enen Veräußerungen haben dieses schäzbare<br />
Eigenthum wohl über einen 3 t[en] Theil verringert.«<br />
4) Die Organisation der Fürstl. Verwaltung in der 1. Hälfte<br />
des 19. Jahrhunderts<br />
Der bedeutende Besitz des Fürstl. Hauses Hohenzollern-<br />
Sigmaringen setzte sich aus einzelnen herrschaftlichen<br />
Gebäuden, aus ganzen Hofgütern, aus einzelnen Wiesen,<br />
Ackerfeldern, Weiden und Wäldern, aus Wind- und Roßmühlen,<br />
aus Groß-, Klein- und Blutzehnten, Jagden, Fischereien,<br />
Brückengefällen sowie aus einzelnen unablösigen<br />
Geldzinsen zusammen. Der Besitz war freies Eigen des<br />
jeweiligen regierenden Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen.<br />
Sein Wert wurde 1835 bei der Ermittlung der Erbschaftssteuer<br />
nach dem Ableben des Fürsten Anton Aloys 1831 mit<br />
1 185607fl angegeben.<br />
Die Bewirtschaftung der Güter erfolgte nach einem damals in<br />
Holland üblichen Pachtsystem. In der Regel wurden die<br />
Güter und Gefälle im Aufstreich für die Dauer von 6 Jahren<br />
verpachtet, worüber jeweils notariell beglaubigte Pachtverträge<br />
angefertigt wurden. Den Einnahmen standen freilich<br />
beträchtliche <strong>Ausgabe</strong>n gegenüber, die sich vornehmlich aus<br />
jährlichen staatlichen Steuern, Kapitalzinsen, <strong>Ausgabe</strong>n für<br />
Besoldungen und Pensionen, Kosten für die Unterhaltung<br />
der herrschaftlichen Gebäude, Mühlen, Brüche und Grabenöffnungen<br />
zusammensetzten. Dennoch erwirtschaften die<br />
Fürstl. Rentämter in Holland, wie wir aus den Jahresrechnungen<br />
entnehmen können, stets schwarze Zahlen. Im<br />
Rechnungsjahr 1823 beispielsweise betrug deren Überschuß<br />
insgesamt 37357fl 29 kr. Auf Wunsch des damaligen Erbprinzen<br />
Karl von Hohenzollern-Sigmaringen (1785-1853)<br />
wurden ihm 1830 anstelle der Einkünfte des Fürstl. Rentamts<br />
Wald die der Fürstl. Besitzungen in Holland als Apanage<br />
zugewiesen.<br />
Die Verwaltungsorganisation der ehemaligen Grafschaft<br />
Bergh wurde von Fürst Anton Aloys übernommen und bis<br />
1824 im wesentlichen beibehalten. An der Spitze der Verwaltung<br />
stand ein mit außerordentlichen Vollmachten ausgestatteter<br />
Generaladministrator, ein Amt, das seit den Tagen des<br />
Grafen Johann Baptist von Hohenzollern-Bergh in der Familie<br />
van Hoevel vererbt wurde. Dem Generaladministrator<br />
unterstanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts fünf Rentämter<br />
nämlich das sogen. Landrentamt 's Heerenberg und die<br />
Rentämter Millingen, Wisch, Gendringen und Etten (vereinigt)<br />
und Ogten. Ihre Zahl war 1819 auf die folgenden drei<br />
zusammengeschrumpft: das Landrentamt 's Heerenberg<br />
(vereinigt mit dem Rentamt Millingen), das Rentamt Gendringen<br />
und Etten (vereinigt mit dem Rentamt Wisch) und<br />
das Rentamt Ogten. Es wurden jedoch auch weiterhin fünf<br />
Rentamtsrechnungen geführt.<br />
Ferner unterstanden dem Generaladministrator vier Förster,<br />
die in Montferland, Bredenbroek, Varsseveld und Silleveld<br />
saßen, der Burggraf, der für das herrschaftliche Bauwesen,<br />
darunter vor allem für das Schloß Bergh, zuständig war, und<br />
die übrigen Subalternbediensteten. Eine klare Abgrenzung<br />
der Geschäftsbereiche gab es bei den Verwaltungsbehörden<br />
des Fürstl. Hauses in den Niederlanden nicht. Der Generaladministrator<br />
konnte alles an sich ziehen und, von der weit<br />
entfernten Fürstl. Regierung in Sigmaringen kaum kontrolliert,<br />
nach seinem Gutdünken entscheiden. Alle Beamten und<br />
Bediensteten, auch die Rentmeister, waren den Weisungen<br />
des Generaladministrators untergeordnet.<br />
Die Kritik der Fürstl. Verwaltung an der nachgeordneten<br />
Verwaltung in den Niederlanden entzündete sich vor allem an<br />
35
der umständlichen und schleppenden Rechnungsführung der<br />
Rentämter. Der Geheime Rat von Huber, der 1819 die Fürstl.<br />
Besitzungen in Holland inspizierte, machte in seinem ausführlichen<br />
Reisebericht vor allem die autokratische Stellung<br />
des Generaladministrators van Hoevel für die aufgetretenen<br />
Mißstände verantwortlich. 1824 wurde schließlich eine Kommission<br />
unter der Leitung des nunmehrigen Regierungspräsidenten<br />
von Huber gebildet, die die Verhältnisse in den<br />
Niederlanden analysieren und Vorschläge für eine Reorganisation<br />
der Fürstl. Verwaltung dort erarbeiten sollte.<br />
Nach ihren Ermittlungen in Holland berichtete die Kommission<br />
unterm 12.9. 1824 der Geheimen Konferenz u. a. folgendes:<br />
»Der Erfolg dieser bis ins kleinste Detail gehenden<br />
Untersuchung hat uns die Überzeugung gegeben, daß nur<br />
dan[n] eine geregelte Kontrolle herzustellen sey, wen[n] das<br />
Ganze in einer einzigen Verwaltung vereiniget, dabei aber die<br />
Administration von der Comptabilität auf das schärfste<br />
geschieden werde.<br />
Von dieser Grundlage ausgehend haben wir den Plan der<br />
ganzen Organisation entworfen mit dem Localbeamten, welcher<br />
uns dafür geeignet schien, besprochen und in Folge<br />
dieser Beratschlagung die Organisation in den beiliegenden<br />
Instruktionen für die Administration, den Rentmeister und<br />
die untergeordneten Bediensteten bearbeitet.«<br />
Die Vorschläge der Kommission wurden von der Geheimen<br />
Konferenz, der obersten Landesbehörde im Fürstentum<br />
Hohenzollern-Sigmaringen, im Oktober 1824 gebilligt. Das<br />
Gremium ernannte den bisherigen Rentmeister von Wisch,<br />
Ludwig Carl Jacob van Nispen, zum Administrator. Die<br />
noch bestehenden drei Rentämter wurden mit Wirkung zum<br />
1. Januar 1825 in dem neu errichteten Fürstl. Rentamt<br />
s'Heerenberg vereinigt und Wilhelm van Ditzhuizen zum<br />
Rentmeister bestellt.<br />
Durch die gleichzeitig erlassenen Instruktionen wurden die<br />
Geschäftsbereiche des Administrators und des Rentmeisters<br />
völlig voneinander getrennt und beide, Rentmeister wie<br />
Administrator, unmittelbar der Fürstl. Landesregierung in<br />
Sigmaringen unterstellt. Dem Administrator oblag fortan die<br />
Aufgabe, für den Erhalt der herrschaftlichen Domänen,<br />
Forste und Gebäude Sorge zu tragen. Ihm unterstellt waren<br />
die Förster und der Burggraf. Die Fürstl. Landesregierung<br />
behielt sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, in Fällen von<br />
Abstiftungen von Verpachtungen sowie bei Bauungen und<br />
Reparaturen selbst zu entscheiden. Der Administrator war<br />
ferner dazu verpflichtet, die Pächter anzuleiten und für die<br />
Bezahlung der Pachtzinse Sorge zu tragen. Das Rentamt war<br />
fortan für die Verrechnung aller herrschaftlichen Einkünfte<br />
zuständig und hatte die Jahresrechnungen zu führen.<br />
Die Reorganisation der Fürstl. Verwaltung in den Niederlanden<br />
verfehlte ihre Wirkung nicht. Doch auch in der Folgezeit<br />
erwies sich die Kontrolle dieser weit entfernten und außerhalb<br />
des Deutschen Bundes tätigen Verwaltung für die Sigmaringer<br />
Regierungskollegien als schwierig. Vor allem aber die<br />
jährlichen Steuern und nicht zuletzt die Erbschaftssteuern,<br />
die für den Komplex an das Königreich der Niederlande<br />
abzuführen waren, ließen in der Sigmaringer Zentrale immer<br />
wieder Pläne heranreifen, den niederländischen Gesamtbesitz<br />
zu veräußern. Tatsächlich ist es jedoch nur zum Verkauf<br />
einzelner Realitäten gekommen, die einzeln aufzuzählen, den<br />
Rahmen der Studie sprengen würde.<br />
5) Der Besitz von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum<br />
Verkauf im Jahre 1912<br />
Die Fürstl. Verwaltung in den Niederlanden unterstand von<br />
1817 bis 1832 unmittelbar der Fürstl. Landesregierung in<br />
Sigmaringen, die ihrerseits der Geheimen Konferenz als<br />
oberster Landesbehörde zugeordnet war. Noch vor der<br />
Verkündigung der Verfassung für das Fürstentum Hohenzol-<br />
36<br />
lern-Sigmaringen 1833 begann Fürst Karl damit, die Verwaltung<br />
des Fürstl. Fideikommißvermögens und den Allodialbesitz<br />
aus der allgemeinen Landesverwaltung herauszulösen<br />
und bestellte zu diesem Zweck 1832 die Fürstl. Hofkammer<br />
als eigene Mittelbehörde für die Verwaltung der Fürstl.<br />
Domänen und Forsten. Auch die Fürstl. Administration und<br />
das Rentamt 's Heerenberg in Holland waren seitdem dieser<br />
Mittelbehörde unterstellt.<br />
Diese Verwaltungsstruktur erfuhr infolge der Resignation<br />
des Fürsten Karl 1848 eine nachhaltige Veränderung. Der<br />
Fürst trat zwar die Regierung des Fürstentums und den<br />
Fürstl. Hausfideikommiß an seinen Sohn, den nunmehrigen<br />
regierenden Fürsten Karl Anton (1811-1885) ab, behielt sich<br />
aber neben einigen Objekten wie z.B. das Landhaus Krauchenwies<br />
die von ihm zwischen 1839 und 1842 erworbenen<br />
Güter in Böhmen und den niederländischen Allodialbesitz als<br />
persönliches Eigentum vor. Der abgetretene Fürst schuf als<br />
oberste Verwaltungsbehörde für seine Hofhaltung und für<br />
seine Domänen und Forsten die sogen. Allodialverwaltung<br />
Sr. Durchlaucht des Fürsten Karl von Hohenzollern mit Sitz<br />
in Milletitz in Böhmen. Für den Bereich der Domänen und<br />
Forsten schuf der Fürst als Mittelbehörde die Fürstl. Hohenzollernsche<br />
Domänendirektion mit Sitz im böhmischen<br />
Bistritz und unterstellte dieser die einzelnen Lokalverwaltungen<br />
in Böhmen und Holland.<br />
Diese Verwaltungsorganisation war freilich nur von kurzer<br />
Dauer. Nach dem Ableben des Fürsten Karl 1853 fielen auch<br />
dessen Eigengüter an Fürst Karl Anton von Hohenzollern-<br />
Sigmaringen, der diese dann alsbald wieder der Fürstl. Hofkammer<br />
unterstellte, wobei der Allodialbesitz in Holland aus<br />
der Direktion in Böhmen wieder herausgelöst wurde.<br />
Auch unter Fürst Karl Anton blieb das alte Problem der<br />
Kontrolle der niederländischen Verwaltung weiterbestehen.<br />
Da nach niederländischem Recht auch eine Einverleibung<br />
dieses Allodialbesitzes in den Fürstl. Verwaltung, die nach<br />
dem Anschluß der hohenzollernschen Fürstentümer an<br />
Preußen 1850 das Staatsgebiet des Königsreichs ohnehin für<br />
den Erwerb von Grund und Boden favorisierte, die mit<br />
Steuern belasteten holländischen Güter zu veräußern.<br />
Als diese Pläne nicht zu dem erwünschten Ergebnis führten,<br />
entschloß sich die Fürstl. Verwaltung dazu, ihre niederländische<br />
Verwaltung zu straffen. Mit Wirkung zum 1. Januar<br />
1864 wurde die bisherige Verwaltungsstelle des Administrators<br />
mit der des Rentamts 's Heerenberg vereinigt und der<br />
Fürstl. Finanzrat Freiherr von Godin zum Administrator<br />
ernannt. Zur besseren Rechnungsführung wurde außerdem<br />
die Stelle eines Kassiers geschaffen. Dieser Behörde blieb die<br />
Forstverwaltung unterstellt, die damals nur noch aus den<br />
Revierverwaltungen Wisch und Montferland bestand.<br />
Die Fürstl. Verwaltung in Sigmaringen hielt indes an ihren<br />
Verkaufsplänen fest. 1875 konnten schließlich die Fürstl.<br />
Güter in den Gemeinden Aalten, Borghees und im Amt<br />
Doetinchem sowie die Waldungen des Reviers Wisch verkauft<br />
werden. Seitdem bestand die Fürstl. Forstverwaltung in<br />
Holland nur noch aus der Revierverwaltung Montferland.<br />
Die weiteren Veräußerungen einzelner Realitäten bewirkten<br />
den weiteren Abbau der Fürstl. Verwaltung in den Niederlanden.<br />
Nach Übertragung der Funktion des Administrators<br />
auf den Rentmeister Steinberger 1876 firmierte die Fürstl.<br />
Verwaltung in Holland nur noch als Fürstl. Hohenz.<br />
Rentamt 's Heerenberg, der die Forstverwaltung resp.<br />
Revierverwaltung Montferland zugeordnet blieb. 1883<br />
schließlich wurden das Rentamt und die Revierverwaltung in<br />
Personalunion dem Forstbeamten Laurentius Meyer übertragen;<br />
er führte die Amtsbezeichnung Rentmeister und Forstverwalter.
Nach dem Handbuch der Hofkammer-Verwaltung wies der<br />
Fürstl. Allodialbesitz in Holland 1898 die folgenden Flächen<br />
auf:<br />
Grundfläche der Gebäude und Hofräume 3,4564 ha<br />
Gärten 6,9603 ha<br />
Äcker 204,1501 ha<br />
Wiesen 4,5775 ha<br />
Waldungen 1,343,7242 ha<br />
Weiden, Ödungen u.Wege 85,8612 ha<br />
1,648,7297 ha<br />
Fürst Wilhelm (1864-1927), seit 1905 Chef des Hauses<br />
Hohenzollern, trieb die Veräußerung des holländischen Allodialbesitzes<br />
konsequent weiter. So konnten in den Jahren von<br />
1905 bis 1906 der gesamte Fürstl. Besitz auf der Gemarkung<br />
Didam verkauft werden. Nach diesen und weiteren Veräußerungen<br />
umfaßte der Fürstl. Besitz 1911 in Holland noch die<br />
folgenden Flächen:<br />
Grundfläche der Gebäude und Hofräume 2,8367 ha<br />
Gärten 3,2129 ha<br />
Äcker 62,5901 ha<br />
Wiesen 4,5775 ha<br />
Waldungen 1,149,3461 ha<br />
Weiden, Ödungen u.Wege 31,2390 ha<br />
1,253,8023 ha<br />
Im Hinblick auf den projektierten Ausverkauf der Fürstl.<br />
Besitzungen in den Niederlanden wurde nach dem Tod<br />
des Fürstl. Domänenrats Meyer am 23. Januar 1911 das Rentamt<br />
's Heerenberg nur noch als Provisorium weitergeführt<br />
und die forstliche Verwaltung dem Förster Leo Le Mire<br />
und die Kassenverwaltung dem Buchhalter Jan Thuis übertragen.<br />
Nach langwierigen Verhandlungen mit holländischen und<br />
deutschen Kauflustigen konnte der noch verbliebene Besitz<br />
mit dem Schloß Bergh mit Kaufvertrag vom 1. November<br />
1912 für 825000 M an den niederländischen Textilfabrikanten<br />
Dr. Jan Herman van Heek verkauft werden. Dem Förster Le<br />
Mire war schon früher zum 31. Dezember 1912 gekündigt<br />
worden. Der Buchhalter Thuis schloß die Jahresrechnung des<br />
Fürstl. Rentamts 's Heerenberg für das Rechnungsjahr 1912<br />
im April 1913 ab.<br />
Mit dem Verkauf gingen übrigens auch das Archiv des Hauses<br />
Bergh und das Schriftgut der Fürstl. Hohenz. Behörden in<br />
den Niederlanden an den Erwerber über. Ins Fürstl. Hohenz.<br />
Haus- und Domänenarchiv sind wenige Unterlagen aus<br />
Holland gelangt. Ein Teil davon wurde dem Bestand Auswärtige<br />
Besitzungen einverleibt, wovon aber 1930 einige Archivalien<br />
an das Archiv im Schloß Bergh ausgefolgt wurden.<br />
Außerdem konnten in Sigmaringen die kleinen Bestände<br />
Fürstl. Forstverwaltung Montferland und Fürstl. Administration<br />
's Heerenberg gebildet werden. Der größte Bestand<br />
holländischer Provenienz wurde aus den Jahresrechnungen<br />
des Fürstl. Rentamts 's Heerenberg von 1825 bis 1912<br />
formiert; diese Unterlagen waren der Fürstl. Hofkammer zur<br />
Revision vorgelegt worden. Für Forschungen über das Haus<br />
Bergh und den Fürstl. Besitz des Hauses Hohenzollern-<br />
Sigmaringen sind im Fürstl. Archiv deshalb in erster Linie die<br />
einschlägigen Unterlagen der Bestände Hausarchiv Hohenzollern-Sigmaringen<br />
und Fürstl. Hohenz. Hofkammer Sigmaringen<br />
heranzuziehen.<br />
Der Käufer Dr. van Heek, der 1957 verstarb, ließ das 1939<br />
niedergebrannte Schloß Bergh im Zustand des 16. Jahrhunderts<br />
wieder aufbauen. 1946 wandelte er das Schloß mit dem<br />
dazugehörigen Grundbesitz von 1700 ha in eine Stiftung um,<br />
die das einzigartige Kulturdenkmal der Nachwelt erhalten<br />
soll.<br />
6) Die Partnerschaft zwischen Boxmeer und Sigmaringen<br />
Früher einmal bestandene herrschaftliche Zugehörigkeiten<br />
bleiben der Nachwelt oft erstaunlich lange im Gedächtnis.<br />
Besonders die Taten und auch Untaten einzelner Dynasten<br />
werden häufig von Generation zu Generation weitergegeben.<br />
So sind auch heute noch die Gewalttätigkeiten des »tollen<br />
Grafen« Johann Baptist von Hohenzollern-Sigmaringen-<br />
Bergh den Bürgern von Boxmeer gegenwärtig.<br />
In Boxmeer entstand denn auch Ende der 60er Jahre der<br />
Wunsch, die abgerissenen Beziehungen zum Fürstenhaus<br />
Hohenzollern und zu ihrem Stammsitz Sigmaringen wiederherzustellen.<br />
Gleichsam als Botschafter von Boxmeer<br />
besuchte das Boxmeer Vocaal Ensemble 1969 auf einer<br />
Konzertreise die Stadt Sigmaringen. Bei dem Besuch des<br />
berühmten Chores unter der Leitung seines Dirigenten Theo<br />
Lamée wurden auch erste freundschaftliche Bande zum Sigmaringer<br />
Gesangverein Frohsinn geknüpft, die dann bei<br />
einem Gegenbesuch 1971 in Boxmeer vertieft werden konnten.<br />
In der Zwischenzeit sind Konzerte des Gesangvereins<br />
Frohsinn in Boxmeer und des Boxmeer Vocaal Ensembles in<br />
Sigmaringen fast schon eine feste Einrichtung geworden.<br />
Im Sog dieser freundschaftlichen Beziehungen der beiden<br />
Chöre nahmen alsbald auch andere Vereine beider Städte<br />
Beziehungen untereinander auf. So kamen nach Sigmaringen<br />
die Handballer von Sambeck, die Kapellen von Beugen und<br />
Sambeck sowie die Freiwillige Feuerwehr Boxmeer. Auf<br />
Gegenbesuchen in Boxmeer weilten die Handballer, die<br />
Stadtkapelle und die Freiwillige Feuerwehr von Sigmaringen.<br />
Franz Prinz von Hohenzollern wurde als Vertreter des<br />
Fürstl. Hauses Hohenzollern in die Heiligblutgilde Boxmeer<br />
aufgenommen.<br />
Die Stadt Boxmeer war jedoch von Anfang an bestrebt, die<br />
aufkeimenden Beziehungen auf kommunale Ebene anzuheben.<br />
Bereits 1971 wurde den mit dem Gesangverein Frohsinn<br />
nach Holland mitgereisten Stadträten eine offizielle Partnerschaft<br />
zwischen beiden Städten vorgeschlagen. Die Partnerschaft,<br />
für die sich in Sigmaringen vor allem der verstorbene<br />
Stadtrat Hermann Döring eingesetzt hat, wurde in den<br />
folgenden Jahren durch eine Reihe von Besuchen und Gegenbesuchen<br />
der Bürgermeister Hillenaar und Kuhn mit ihren<br />
Stadträten besiegelt. Sie hat vor allem dank des Engagements<br />
der Vereine beider Städte, vor allem aber des Boxmeer Vocaal<br />
Ensembles und des Gesangvereins Frohsinn unter seinem<br />
Leiter Herbert Birmele ihre Bewährungsprobe auch ohne den<br />
Abschluß einer offiziellen Städtepartnerschaft bestanden.<br />
Quellennachweis<br />
StA Sigmaringen Depositum 39 (Fürstl. Hohenz. Haus- und Domänenarchiv):<br />
Auswärtige Besitzungen 75,2; 79,9; 75,11; 75,12; 140,1<br />
Auswärtige Besitzungen NZ 75,2; 75,3<br />
NVA 17.454; 17.476; 17.644; 17.776; 17.928; 19.259; 19.662; 20.255;<br />
23.325; 23.326<br />
F. H. Rentamt 's Heerenberg, Rechnungsband Nr. 54<br />
Kanzleiakten des Bürgermeisteramts Sigmaringen<br />
Mündliche Auskünfte von Herrn Birmele, Vorsitzender des Gesangvereins<br />
Frohsinn, Sigmaringen<br />
Abbildungsnachweis<br />
Schloß Bergh nach seinem Wiederaufbau 1942,<br />
StA Sigmaringen Dep. 39 Sa E g 35. Foto: Hauptstaatsarchiv<br />
Stuttgart<br />
Orientierungskarte der F.H. Besitzungen in den Niederlanden vom<br />
18. bis 19. Jh. innerhalb der heutigen Staatsgrenzen, angefertigt von<br />
H. Liebhaber.<br />
37
Literaturnachweis<br />
Handbuch der Fürstl. Hohenz. Hofkammer-Verwaltung 1898,<br />
Stuttgart 1898<br />
Dass, für 1911, Stuttgart 1911<br />
Fritz Kallenberg: Die Fürstentümer Hohenzollern am Ausgang des<br />
Alten Reiches. Ein Beitrag zur politischen und sozialen Formation<br />
des deutschen Südwestens, Masch. Diss. Tübingen 1962<br />
HERBERT RÄDLE<br />
Ein Bildnis des Grafen Christoph von Nellenburg<br />
J. A. Kraus hat in der letzten Nummer dieser Zeitschrift zwölf<br />
Urkunden aus Empfingen veröffentlicht, darunter eine, in<br />
welcher Graf Jos Nikiaus (II.) von Hohenzollern nach dem<br />
Tod seines Vaters Joachim von Zollern 1538 an den Abt<br />
Markus von Reichenau, seinen Lehnsherrn, schreibt, daß er<br />
»den Zehnten zu Empfingen samt Kirchsatz und neugebauter<br />
Scheuer und allen Rechten« aufsende mit der Bitte, alles an<br />
den Grafen Christoph von Nellenburg, Herrn zu Tengen 1 ,<br />
zu leihen, dem es zustehe (HH <strong>1989</strong>, S.23).<br />
Es ist nicht meine Absicht und steht auch nicht in mt iner<br />
Kompetenz, auf die hier angesprochenen und heimatgeschichtlich<br />
durchaus interessanten Rechtsverhältnisse näher<br />
einzugehen. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, daß in der<br />
Staatlichen Münzsammlung München ein eindrucksvolles<br />
Bildnis dieses Nellenburgers zu sehen ist, ein in Holz<br />
geschnitztes Medaillon von ca. 10 cm Durchmesser, von der<br />
Hand Friedrich Hagenauers 2 .<br />
Es zeigt den schwergewichtigen Grafen, bekleidet mit Mantel<br />
und federgeschmücktem Barett. Wie man aus der Zimmernschen<br />
Chronik weiß, war Christoph von Nellenburg - nicht<br />
zuletzt wegen seiner derben Scherze - eine volkstümliche<br />
Erscheinung in Schwaben und am Hofe Kaiser Karls V. Er<br />
starb 1539 3 .<br />
Anmerkungen<br />
1 Tengen, erstmals erwähnt 1112, war Stadt seit dem 13. Jh. Erhalten<br />
ist ein Torturm und der Turm der »Hinterburg«. Vgl. den alten<br />
Spruch aus der Heimatkunde: Engen, Tengen, Blumenfeld sind die<br />
kleinsten Städte der Welt.<br />
2 Friedrich Hagenauer, einer der bekanntesten deutschen Medailleure<br />
des 16. Jh., war gebürtiger Straßburger und lebte 1526-1531 in<br />
Augsburg, 1532 bis 1535 am Oberrhein. Damals dürfte das<br />
beschriebene Medaillon entstanden sein. 1536 zog Hagenauer nach<br />
Köln, wo er 1546 starb (vgl. auch HH 1988, S. 23, wo eine Medaille<br />
Christoph Friedrichs von Zollern von Friedrich Hagenauer aus<br />
dem Jahr 1528 abgebildet ist).<br />
3 Anzumerken ist noch, daß ein Nellenburger es war, der 1407/8 das<br />
Testament des letzten Veringers, Graf Wölfle, anfocht, da er selbst<br />
HERBERT RÄDLE und GERT FRÜHINSFELD<br />
Ders.: Die Fürstentümer Hohenzollern im Zeitalter der französischen<br />
Revolution und Napoleons, in: Zeitschrift für die Geschichte<br />
des Oberrheins 111 (1963), S. 357^172<br />
Paul-René Zander ter Maat: Bergh, ein holländischer Sitz der<br />
schwäbischen Hohenzollern, in: Archiv für Sippenforschung 35<br />
(1969), S. 102-108<br />
Christoph Graf von Nellenburg. Holzmedaillon von Friedr. Hagenauer,<br />
um 1535, Durchmesser 95 mm. München, Staatl. Münzsammlung.<br />
aufgrund eines Erbvertrages Anspruch auf die Herrschaft Gammertingen-Hettingen<br />
erheben zu können glaubte. Der Streit wurde<br />
entgegen dem Willen des Abtes von Reichenau, des Eigentümers<br />
der Stadt Gammertingen, 1408 in Stuttgart zugunsten Heinrichs<br />
von Rechberg entschieden, den Wölfle testamentarisch als Alleinerben<br />
eingesetzt hatte. Der Nellenburger erhielt aber eine Entschädigung<br />
von 500 Gulden. Vgl. H. Burkarth, Geschichte der Herrschaft<br />
Gammertingen-Hettingen, Sigmaringen 1983, S. 50 f.<br />
Die Zollernsche Hauschronik, wohl ein Werk von Jörg Ziegler<br />
Die Hauschronik der Grafen von Zollern ist, ebenso wie die<br />
etwa gleichzeitige Zimmernchronik, ein Kind der humanistischen<br />
Geschichtswissenschaft. Initiator der Chronik war<br />
Karl I. von Zollern (1516-1576), der dem Basler Humanisten<br />
Johannes Herold als Vorarbeit dazu den Auftrag erteilt hatte,<br />
einen Stammbaum der Zollern anzufertigen 1 .<br />
38<br />
Wie andere schwäbische Adelschroniken des 16. Jh. schildert<br />
auch die Zollernsche Hauschronik die Geschichte des Hauses<br />
von den Anfängen bis zur Gegenwart, d.h. von dem sagenhaften<br />
Stammvater Tassilo bis zu KarlL, der bekanntlich zum<br />
Begründer der Sigmaringer Zollernlinie wurde. Die Zollernsche<br />
Hauschronik »bringt durch Aufzählung auch von Ehe-
Verbindungen, Ämtern, Würden und Taten der Stammväter<br />
den Status des Hauses zum Ausdruck und dokumentiert<br />
somit das Selbstverständnis des Zollerngeschlechts, sein<br />
Gesamtbild von Vergangenheit und Gegenwart, gleichgültig<br />
wieviel davon auf Sage oder Legende beruhte!« 2<br />
Die Urschrift der Zollernchronik (46 Blätter, 33,5 x 26,5 cm,<br />
Pergament) wird in der Sigmaringer Hofbibliothek aufbewahrt.<br />
Sie enthält - neben einer Einleitung auf den ersten vier<br />
Blättern - auf jedem der folgenden Blätter jeweils auf der<br />
Vorderseite das Bild eines Zollerngrafen sowie einen Text von<br />
etwa zehn Zeilen über dessen Leben und Taten; auf der<br />
Rückseite sind in Medaillons jeweils die Kinder des vorne<br />
Abgebildeten dargestellt.<br />
Da die Federzeichnungen nicht signiert sind, ist man hinsichtlich<br />
ihrer Urheberschaft auf Vermutungen angewiesen.<br />
Es spricht jedoch alles dafür, daß der in den 60er und 70er<br />
Jahren in Rottenburg ansässige Jörg Ziegler Urheber der um<br />
1570 entstandenen Prachthandschrift war. Jörg Ziegler ist<br />
archivalisch 1547/48 in Hechingen als »Jörg Hofmaler« mit<br />
»12 Gulden Jahressold« 3 und 1561 als »Maler Georg Ziegler<br />
von Rottenburg, tätig im Hechinger Schloß« 4 nachgewiesen.<br />
Für seine Urheberschaft an der Zollernchronik sprechen<br />
Beobachtungen, die sich vor allem auf einen Vergleich der im<br />
Ulmer Stadtarchiv aufbewahrten, mit IZ signierten Miniatur<br />
des Botanikers Leonhard Fuchs (abgebildet in Hohenz. Heimat<br />
Nr. 2/<strong>1989</strong> S. 24) mit den Zeichnungen der Hauschronik<br />
(etwa Abb. A) stützen.<br />
Überzeugende Ähnlichkeiten zwischen dem Fuchs-Porträt<br />
und den Porträts der Hauschronik<br />
Das Fuchs-Porträt einerseits und die Porträts der Zollerngrafen<br />
andererseits weisen folgende Gemeinsamkeiten auf: In<br />
beiden Fällen ist der Abgebildete in einen mit Wappen<br />
gezierten Architekturrahmen gesetzt. Unterhalb des Dargestellten<br />
ist jeweils eine von Renaissanceornamenten<br />
geschmückte Schriftkartusche beigefügt (bei Fuchs ist das<br />
Feld freigeblieben). In beiden Fällen wird ferner der Architekturrahmen<br />
im unteren Bereich von jeweils zwei Tieren<br />
flankiert.<br />
Über diese Übereinstimmungen im Aufbau hinaus weisen<br />
auch einzelne Details auffallende Ähnlichkeiten auf: Die<br />
Gorgonenfratze auf dem Brustpanzer Eitelfriedrichs I.<br />
(Abb. A) z.B. kehrt sozusagen »wörtlich« oberhalb bzw. -<br />
wenn auch weniger deutlich - seitlich der Kartusche des<br />
Fuchs-Bildes wieder; auch die die Kartuschen zierenden<br />
Rollwerkvoluten weisen eine ähnliche Gestaltung auf.<br />
Deutliche Übereinstimmungen sind aber auch an den Porträts<br />
selber zu beobachten (obwohl es sich um verschiedene<br />
Personen handelt): Hände mit langen, kräftigen Fingern; sehr<br />
ähnliche Physiognomie (Augen, Bärte, selbst die Nasen -<br />
zwischen denen noch am ehesten Unterschiede bestehen).<br />
Daneben muß auch auf große Ähnlichkeiten bei der Gestaltung<br />
der Wappen hingewiesen werden. Wenn wir nämlich das<br />
Fuchs-Wappen etwa mit dem Wappen rechts oben auf dem<br />
Bild Eitelfriedrichs I. (Abb. A, Wappen seiner Frau Martha<br />
zu Habsburg) vergleichen, stellen wir Übereinstimmungen<br />
fest in bestimmten Details, z. B. in der Haltung der hochaufgerichteten<br />
Wappentiere der Helmzier und in den sehr<br />
ähnlich gestalteten, leicht von seitwärts gesehenen Wappenhelmen<br />
mit durchbrochenem Visier. Zudem ist die sehr<br />
ähnliche Gestaltung der »Wappendecke« aus stilisierten<br />
Akanthusblättern hervorzuheben, prachtvoll plastisch wiedergegeben<br />
durch Hell-Dunkel- bzw. Farbkontrast der Vorder-<br />
bzw. Rückseiten; die Blätter laufen unten in im gleichen<br />
Farbkontrast sich schlängelnden Bändern aus.<br />
Wenn auch eingewendet werden kann, daß Ähnlichkeiten in<br />
der Gestaltung von Heraldik und Architekturelementen (einschließlich<br />
der Sockel-, Kartuschen- und Rollwerkmotive,<br />
Graf Eitelfriedrich I. von Zollern. Hauschronik der Grafen von<br />
Zollern. Wahrscheinlich Rottenburg um 1570 bis 1575. Fol. 18r.<br />
33,5 x 26,5 cm. Federzeichnung, nicht signiert. Wahrscheinlich von<br />
Jörg Ziegler.<br />
selbst der Tierhaltungen) teilweise auch durch die stark<br />
normierten Traditionen in diesen Bereichen erklärbar sind<br />
und allein nicht zur Gleichsetzung von Bildautoren hinreichen,<br />
so sprechen sie jedenfalls nicht dagegen.<br />
Vor allem aber folgende Beobachtungen im rein darstellungstechnischen<br />
Bereich scheinen die Annahme einunderselben<br />
Hand für beide Bilder schon fast zwingend nahezulegen:<br />
Zum einen stellt man große Gemeinsamkeiten bei der Schattenbehandlung<br />
fest: Betontes Durchbrechen der von der<br />
Architektur bestimmten Symmetrien durch breite und kräftige,<br />
nach rechts fallende Schattenränder. Dabei treten auch<br />
ähnliche Schattenfehler auf (Abb. HH. S. 24: Ovalinnenkante<br />
oben rechts; Abb. A: Schwertschatten links statt rechts vom<br />
Schwert, doppelter Lanzenschatten auf Rückseite und auf<br />
Fliesenboden; es sind also jeweils zweierlei Lichtrichtungen<br />
im Widerstreit). Leicht zu übersehen, aber besonders bemerkenswert:<br />
Jeweils an der (vom Betrachter aus) linken Kante<br />
der Kopfbedeckung ist ein Schatten gegeben, der der sonst<br />
vorherrschenden Lichtrichtung widerspricht, aber offenbar<br />
zur räumlichen Trennung vom Hintergrund bewußt so<br />
gewählt worden ist.<br />
Zum anderen weisen beide Bilder ähnliche perspektivische<br />
Darstellungsmittel, aber auch -fehler auf: Innerhalb des<br />
Rahmenmotivs (Bogen bzw. Oval), in das die Figur jeweils<br />
gestellt ist, wurde mit linearperspektivischen Mitteln eine<br />
kühne Tiefenwirkung angestrebt: (Abb. 1: zu einem Fluchtpunkt<br />
nach rechts außen laufende Buchkanten; Abb. 2: zur<br />
Mitte fluchtende Fliesenfugen am Boden). In beiden Fällen ist<br />
aber außerhalb der genannten eingerahmten »Räume« eine<br />
andere Perspektive gewählt (Abb, HH. S. 24: Fluchtpunkt[e]<br />
der Architektur in der Mittelachse; Abb. A: Fluchtpunkt der<br />
Fliesenfugen nicht maßgeblich für Säulenplinthe und -abacus,<br />
d. h. die rechtwinkligen Platten an Fuß und Kopf der Säulen.)<br />
39
Schließlich besteht in beiden Darstellungen ein Widerspruch<br />
zwischen der durch die linearperspektivischen Mittel erreichten<br />
sogartigen Tiefe und der durch die Schattenränder nah<br />
herangeholten Rückwand (Abb. A: So nah kann der Schwertschatten<br />
nicht sein, wenn die Fliesenreihen - es sind nur drei -<br />
sich so stark verkürzen! Abb. HH.S.24: Die Rückwand<br />
wirkt durch den Schatten so nah, daß, gemessen am Buch, die<br />
Figur papierdünn erscheint). Auch diese Unvereinbarkeit<br />
zwischen Licht/Schatten- und Raumdarstellung ist bei beiden<br />
Abbildungen die gleiche.<br />
Die angeführten Beobachtungen dürften, in Kombination<br />
mit den archivalischen Nachrichten (vgl. Anm. 3 und 4) über<br />
die Beschäftigung Jörg Zieglers (des Jüngeren?) im Dienste<br />
der Zollern, ausreichen, um die Zollernchronik mit hoher<br />
Sicherheit dem Rottenburger Maler Jörg Ziegler zuzuweisen.<br />
5<br />
BRUNO REISER<br />
Nicht weit von Württemberg und Baden...<br />
Anmerkungen<br />
Zollernlied vor 140 Jahren in Tübingen entstanden / Ein Hechinger der Verfasser<br />
Hechingen. Das Hohenzollern-Lied »Nicht weit von Württemberg<br />
und Baden...« ist in Württemberg, in Tübingen<br />
geschrieben worden, und zwar vor 140 Jahren. Es verdankt<br />
seine Entstehung einem militärischen Tagesbefehl »Treue<br />
ohne Wanken«, der den Hechinger Hermann Vitallowitz so<br />
angesprochen hatte, daß er ihn in Verbindung mit seiner<br />
zollerischen Heimat zu bringen versuchte. So entstanden die<br />
beiden ersten Strophen, denen im Verlauf der Jahre 18 weitere<br />
folgen sollten. Indessen war der Autor längst vergessen und<br />
auch vom Komponisten wußte man bald nichts mehr.<br />
Vergessen wurden auch die meisten Strophen; gesungen<br />
wurden immer nur die beiden ersten, höchstens aber drei oder<br />
vier. Und die beiden ersten hießen in ihrer Urfassung: »Nicht<br />
weit von Württemberg und Baden und von der wunderschönen<br />
Schweiz, da liegt ein Berg so hoch erhaben, den man den<br />
Hohenzollern heißt. Er schaut herab so stolz und schön auf<br />
alle, die Vorübergehn. - Auf Hohenzollerns steilem Felsen,<br />
wo unverzagt die Eintracht ruht. - Von diesem Berg da geht<br />
die Sage, die sich ins ferne Land erstreckt und mancher Vater<br />
hat die Klage, die sich auf seinen Sohn erstreckt: man nimmt<br />
ihn fort ins ferne Land, sein Liebchen glaubt, er sei verbannt.<br />
- Auf Hohenzollerns steilem Felsen, wo unverzagt die Eintracht<br />
ruht«.<br />
Soweit die beiden ersten Strophen. Wie oft wurden sie<br />
gesungen und gehört; eigentlich bei allen lokalbezogenen<br />
zollerischen Festen und Gegebenheiten und bei geselligen<br />
Zusammenkünften mannigfacher Art, auch beim Hechinger<br />
Irma West-, Kinder- und Heimatfest. Gewiß, den Jüngeren<br />
und Jungen bedeutet es nicht mehr soviel. Aber wenn sie »in<br />
der Fremde« sind und wenn sich dort einige aus dem Ländle<br />
zusammenfinden, dann überkommt viele auch heute noch -<br />
obwohl es kein Hohenzollern mehr gibt - ein starkes Heimatbewußtsein<br />
und sie stimmen mit Enthusiasmus das Zollern-<br />
Lied an.<br />
Lange Jahre wußte man vom Zollern-Lied nicht, woher es<br />
kam, wer es verfaßte und wer es vertonte. Man wußte nur,<br />
daß es zum erstenmal öffentlich um das Jahr 1870 herum in<br />
Tübinger Studentenkneipen gesungen wurde. So auch in der<br />
40<br />
1 Vgl. Rudolf Seigel, Zur Geschichtsschreibung beim schwäbischen<br />
Adel zur Zeit des Humanismus. In: Ztschr. f. württ. Landesgeschichte<br />
40, 1981, S. 112 f.<br />
2 Seigel, S. 104 f.<br />
3 Er stand im Dienst von Jos NiklasII. von Zollern. Urkundlich<br />
belegt im Fürstl. Archiv Sigmaringen, Signatur: Hechingen, Rubrik<br />
128, Nr. 41a. Zitiert nach Josef Hecht, Der wahre Meister von<br />
Meßkirch, in: Hohenz. Jahreshefte 7, 1940, S. 79.<br />
4 »im Schloß alhier... insonderhait auch das Wappen über dem<br />
Schloßtor einzufassen und anderes auszubessern.« Fürstl. Archiv<br />
Sigmaringen, Signatur: Hechingen, Rubr. 128, Nr. 45. Zitiert nach<br />
Hecht, S. 81.<br />
5 Vgl. auch Anton von Euw / Joachim M. Plotzek, Die Handschriften<br />
der Sammlung Ludwig, Bd. 3, Köln 1982, S. 282-290, denen wichtige<br />
Anregungen zu verdanken sind.<br />
»Sonne«, dem Versammlungslokal der »Janitscharia«. In der<br />
»Sonne« verkehrten aber auch die Hechinger Rekruten, wenn<br />
sie auf ihrer langen Fußreise von der Garnisonstadt Saarlouis<br />
in Tübingen letzte Rast einlegten. Ihnen gefiel das Lied<br />
natürlich besonders gut, war es doch Balsam gegen ihr<br />
Heimweh, das in der fremden Kaserne besonders groß war.<br />
So wurde das Zollern-Lied bald auch in der Saarlouiser<br />
Kaserne gesungen und war eine geistige Brücke zur Heimat.<br />
Und dann kam das Unerwartete: das Zollern-Lied wurde<br />
bald auch von »eingefleischten« Württembergern gesungen,<br />
besonders von jenen nahe der Grenze, über die die Zollerburg<br />
ja auch in ihre Heimat heruntergrüßte.<br />
Niemand forschte nach dem Quell. Allen, die das Lied<br />
sangen, genügte es, daß es da war, daß man mit ihm umgehen<br />
konnte, wie mit seinem Eigentum. Und so kam es dann zu<br />
vielen mundgerechten Veränderungen von Text und Melodie,<br />
so daß aus der Urfassung schließlich »das Volkslied« wurde.<br />
Die Nachforschung, die Professor Nägele in den neunziger<br />
Jahren anstellte, wer Texter und Komponist des Zollernliedes<br />
sei, verliefen negativ. Fünfzig Jahre später vertrat der Hechinger<br />
Bürgermeister Mayer die Auffassung, Konstantin Killmaier<br />
aus Hechingen sei der Verfasser. Aber diese Meinung<br />
ließ sich bei eingehender Nachforschung ebenso wenig halten<br />
wie jene, die in einem Tübinger Metzgereimeister namens<br />
Späth den Autor des Liedes sehen wollte. Und so wäre man<br />
dem wirklichen Verfasser mit großer Wahrscheinlichkeit nie<br />
auf die Spur gekommen, wenn sich dieser 1908 nicht selber<br />
gemeldet hätte: Hermann Vitallowitz.<br />
Dieser Hermann Vitallowitz wurde 1825 in Hechingen geboren<br />
und wurde Postbeamter. Seine Freizeit widmete er der<br />
Musik und er eignete sich durch umfassendes Studium ein<br />
beachtliches Fachwissen an. Mit Vorliebe sang er Volkslieder,<br />
aber auch Balladen; ja er übernahm sogar Oratorien-Rollen<br />
bei Konzerten in Tübingen und Hechingen. In Tübingen<br />
gehörte er bald aktiv der damals blühenden »Janitscharia« an.<br />
Im August 1849 kamen preußische Truppen nach Hechingen,<br />
das zusammen mit ganz Hohenzollern - im Ergebnis der 48er
Revolution - dem preußischen Staat einverleibt wurde. Und<br />
in diesen Tagen wurde beim Militär ein Tagesbefehl mit den<br />
Worten »Treue ohne Wanken« ausgegeben. Dieser Befehl<br />
drang über die Mauern der Kasernen und wurde auch in der<br />
Öffentlichkeit, besonders aber in den Tübinger Studenten-<br />
Kneipen diskutiert und Vitallowitz fühlte sich dabei so stark<br />
angesprochen, daß er die »Treue ohne Wanken« in einem<br />
Liede, und zwar in Verbindung mit seiner Heimat, besingen<br />
HANS-DIETER LEHMANN<br />
wollte. So entstanden die ersten beiden Strophen des Hohenzollern-Liedes.<br />
Bald darauf schrieb Vitallowitz zwei weitere Strophen, in<br />
denen er auch die neue Heerespflicht würdigte. Und im<br />
Verlauf der Jahre kamen - man weiß nicht von wem - immer<br />
neue Strophen dazu, bis es 20 waren. Aber wie gesagt,<br />
gesungen wurden immer nur zwei, höchstens drei bis vier.<br />
(Schwarzwälder Bote 11.2. 89)<br />
Zur älteren Vorgeschichte von Kloster Beuron an der Donau (Schluß)<br />
Xu den Patrozinien der Beuroner Kirchen im Tal und auf dem<br />
Berg<br />
Anno 1077 bestätigt Urban II. den päpstlichen Schutz über<br />
ein von dem Adligen Peregrin gegründetes und dem heiligen<br />
Petrus übertragenes Stift. Es war eine Gründung auf eigenem,<br />
bislang unbesiedeltem Jagdgrund im Donautal. Die Kirche<br />
dort ist der Jungfrau Maria geweiht und trägt den Namen<br />
St. Martin. Diese merkwürdige Angabe wird mit einer Trennung<br />
von Stifts- und Pfarrkirche zu begründen versucht.<br />
Ohne Angabe eines Patroziniums wurde bereits im 9. Jahrhundert<br />
in St. Galler Urkunde eine Kirche in »Beuron«<br />
erwähnt. Schöntag nimmt an, daß das Martins-Patrozinium<br />
von einer auf der Höhe südlich der Donau abgegangenen<br />
Siedlung in das Tal übertragen worden ist. Nahe dem heutigen<br />
Steighof vermutet er diese Wüstung samt einstiger<br />
Pfarrkirche.<br />
Wegen der in diesem Raum nach Süden abfallenden Gesteinsschichtung,<br />
d.h. aus hydro-geologischen Gründen, liegen die<br />
älteren dörflichen Siedlungen in beträchtlichem Abstand vom<br />
südlichen Rand des Donautales. Flurnamen wie »Altstadtäcker<br />
oder -fels« beweisen in dieser wasserarmen und somit<br />
siedlungsfeindlichen Umgebung kein früheres Pfarrdorf. Erst<br />
recht kann dies nicht aus einer Beschreibung von Pfarr- und<br />
Zehntrechten abgeleitet werden, die wohl nach der Gründung<br />
der hochmittelalterlichen Burg Wildenstein und ihrer<br />
Abgrenzung vom benachbarten Leibertingen datiert.<br />
Den Vermutungen Schöntags gegenüber steht die Beuroner<br />
Tradition vom Bergkloster über dem nördlichen Donautalrand,<br />
Alt-Beuron auf dem Kirchberg bei Fridingen. In eine<br />
karolingerzeitliche Gründung, wie sie in Beuron behauptet<br />
wurde, würde das Martins-Patrozinium durchaus passen.<br />
Eine Begründung für die für ein Kloster ungewöhnliche<br />
Platzwahl auf dem ebenfalls siedlungsfeindlichen Kirchberg<br />
bleibt uns die Überlieferung allerdings schuldig. Gibt es hier<br />
eine Erklärungsmöglichkeit?<br />
Zur Platzwahl für ein Bergkloster Pussen-Buron oder Montburon<br />
Der Kirchberg hoch über dem Donaudurchbruch ist für eine<br />
klösterliche Niederlassung tatsächlich ein ungewöhnlicher<br />
Ort. Der Platz wäre allenfalls akzeptabel für eine Eremitage,<br />
wie sie hier in jüngerer Zeit noch bestanden hat. Wassermangel<br />
und fehlende Anbindungen der Örtlichkeit an den Verkehr<br />
machen eine klösterliche Gemeinschaft hier schwer<br />
verständlich. Wenn hier dennoch ein Bergkloster bestanden<br />
haben sollte, müssen für seine Gründung an diesem Platz<br />
besondere Voraussetzungen bestanden haben.<br />
Diese Voraussetzung bietet gerade die überlieferte Lage Alt-<br />
Beurons: nicht durch ihre Weltabgeschiedenheit, sondern<br />
durch die hier erfüllbare Aufgabe als christliche Kontrollstation<br />
in karolingischer Zeit. Das »Kloster« auf dem Kirchberg<br />
war eine Missionszelle, gegründet einzig und allein mit der<br />
Funktion, in diesem Raum das Verbot heidnischer Umtriebe<br />
durchzusetzen und zu kontrollieren. Diese Behauptung läßt<br />
sich durch Parallelen in spätkarolingischer Zeit belegen<br />
(Matthes 1982, Lehmann 1988). Als Beispiel dafür sei die<br />
älteste Klostergründung in Alt-Sachsen angeführt: Hethis,<br />
die Vorläufergründung für Corvey. Hethis wurde - wie auch<br />
für Alt-Beuron behauptet - von Angehörigen des karolingischen<br />
Herrscherhauses gegründet. Die Fehlgründung im<br />
Waldgebirge des Sollings wurde nach wenigen Jahren unter<br />
Mitwirkung Ludwigs des Frommen in das Wesertal verlegt,<br />
neben die Ortschaft Höxter, in eine siedlungsgünstige Lage.<br />
In seinem Nachruf auf den Gründer von Hethis und Corvey<br />
schreibt der Corveyer Mönch Radpert: »...hat er die Kultstätte<br />
zunichte gemacht und zu Schafställen für die Herde<br />
Christi geweiht. Darauf errichtete er, nachdem der heidnische<br />
Hain bis auf die Wurzeln beseitigt war, für die Mönche<br />
weitab von diesem Ort von Grund auf und in vollkommener<br />
Weise die geheiligten Klostergebäude« (zitiert nach Matthes<br />
1982). Die hier gebrauchte und durchaus übliche Redewendung<br />
von den »Schafställen für die Herde Christi«, zusammen<br />
gesehen mit der von Walter (1948) gegebenen Namensdeutung<br />
für -beuren und den Ortsnamen »Betbur«, gibt<br />
vielleicht den Hintergrund ab für die zahlreichen klösterlichen<br />
Niederlassungen mit Namen wie Benedikt-, Michael-,<br />
Jacobs-, Otto-, Blau- und Klosterbeuren, Gottsbüren,<br />
Monequeberre und anderen.<br />
An anderen Stellen in Alamannien wird die für Hethis belegte<br />
und für Alt-Beuron anzunehmende Funktion in karolingischer<br />
Zeit ebenfalls wahrscheinlich. Beispiele dafür sind<br />
Mariazell bei Hechingen, die Zelle im Besitz Fulrads in<br />
Herbrechtingen auf der Ostalb oder Zellen im Schwarzwald,<br />
etwa Zell im Wiesental unter dem Zeller Blauen, und Marzeil<br />
am weiter westlich gelegenen Blauen. Diesen frühen kirchlichen<br />
Institutionen in Südwestdeutschland ist gemeinsam, daß<br />
sie bei sogenannten »Kapf-Systemen« liegen. Dies sind kleinräumige<br />
Einrichtungen altalamannischer heidnischer Kultverbände.<br />
Mehrere Dutzend solcher Systeme von Warten mit<br />
wahrscheinlich kalendarisch bestimmten Lagebeziehungen<br />
untereinander ließen sich bislang zwischen dem mittleren<br />
Neckar und dem Hochrhein aus Flurnamen erschließen. Im<br />
alamannischen Kerngebiet ist der Leitname dafür »Kapf«,<br />
d.h. Warte. Er ist mit bestimmten anderen Flurnamen vergesellschaftet<br />
und in den Randgebieten Alamanniens oft durch<br />
»Hölle« oder »Schanze« ersetzt. Früh- und vorgeschichtliche<br />
Wallanlagen, aber auch Feldkirchen, stehen damit in einem<br />
Zusammenhang, der sich in den erwähnten regelhaften Lagebeziehungen<br />
erkennen läßt.<br />
41
Für die heidnischen Alamannen belegt Agathias von Myrina<br />
(Hist. 1.6) einen Naturdienst noch im späten Ö.Jahrhundert<br />
(vgl. Gottlieb 1969). Wenn der byzantinische Geschichtsschreiber<br />
von Flußläufen und Schluchten gehört hat, die<br />
neben Bäumen und Höhen in der Religion der Alamannen<br />
eine Rolle gespielt haben sollen, dann ist hier an die Gegebenheiten<br />
im Donaudurchbruch bei Beuron zu denken. Wenn es<br />
im 8. Jahrhundert - trotz des von Agathias gerühmten guten<br />
Beispiels der christlichen Franken - in Alamannien noch<br />
Heiden gab, die ihren alten Gepflogenheiten noch nachgingen,<br />
dann war der Kirchberg über dem Donautal zu ihrer<br />
Überwachung bestens geeignet: er liegt genau über dem<br />
Zentrum »Schänzle«, ein kleines Kapf-System im Donaudurchbruch,<br />
gegenüber von Wirtenbühl und Heidenkapf, als<br />
dem Mittelpunkt eines großen, beide Talseiten überspannenden<br />
Systems.<br />
Auch wenn eine solche Kontrollfunktion ursprünglich eine<br />
Klostergründung gerechtfertigt haben mag, blühende<br />
Gemeinschaften konnten in diesen extremen Lagen nicht<br />
daraus entstehen. Aus der Fehlgründung Hethis erwuchs<br />
nach der Verlegung ins Wesertal das mächtige Corvey in der<br />
Gunst Ludwigs des Frommen und späteren Kaisers. Das<br />
wenige Jahrzehnte ältere Alt-Beuron dagegen verkümmerte<br />
auf seinem Berg. Zu einer Zeit, in welcher sich der ursprüngliche<br />
Anlaß zur Gründung längst erledigt hatte, lag es deshalb<br />
nahe, seine Insassen wie den Namen und das Kirchenpatrozinium<br />
ebenfalls auf eine lebensfähige Neugründung im Tal zu<br />
übertragen. Diese Neugründung der Kirchenreform verfolgte<br />
andere Ziele. Mit dem Rauhen Stein, dem Hornfels und<br />
dem Käpfle samt seinen undatierten Scherben und Wällen<br />
(Biel 1987) gibt es auch nahe dem jüngeren Beuron donauabwärts<br />
Anzeichen für das ältere alamannische Heidentum; für<br />
die Gründung des 11. Jahrhunderts dürften sie schon lange<br />
nicht mehr von Belang gewesen sein.<br />
Es ist sehr unwahrscheinlich, daß sich in Schriftquellen noch<br />
erhärtende Belege für die ältere Geschichte Beurons auffin-<br />
HANS-DIETER LEHMANN<br />
den lassen werden. Wegen der für Beuron mageren Quellenlage<br />
ist allen sonstigen Hinweisen nachzugehen. Die Parallelen<br />
hier zu anderen Örtlichkeiten machen es aber zumindest<br />
wahrscheinlich, daß in den angezweifelten Beuroner Traditionen<br />
ein echter Kern steckt. Alt-Beuron dürfte aber allenfalls<br />
als eine karolingische Missionszelle, nicht aber als die<br />
dem 18. Jahrhundert zum Wunschtraum gewordene<br />
Reichsabtei auf dem Kirchberg gelegen haben.<br />
Literatur<br />
Biel (1987): /. Biel, Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in Südwürttemberg-Hohenzollern,<br />
Stuttgart 1987, S.224<br />
Dertsch (1964): R. Dertsch, Ottobeuren und die Ortsnamen auf<br />
-beuren, in: Ottobeuren 764-1964, Beiträge zur Geschichte der<br />
Abtei, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens<br />
und seiner Zweige, Bd. 73 (1962), Augsburg 1964, S. 24-31<br />
Gottlieb (1969): G. Gottlieb, Die Nachrichten des Agathias aus<br />
Myrina über das Christentum der Franken und Alamannen, Jahrb.<br />
Rom.-German. Zentralmus. Mainz 16 (1969), S. 149-158<br />
Herberhold (1955): F. Herberbold, Die auf den Namen Karls des<br />
Großen gefälschte Urkunde für Beuron, in: Festschrift A.Hofmeister<br />
zum 70. Geb., Halle 1955, S. 80-112<br />
Lehmann (1988): H.-D. Lebmann, Wo lag Hethis - im Solling oder<br />
im Osning? Northeiner Heimatblätter 53 (1988), S. 53-61<br />
Matthes (1982): W. Matthes, Corvey und die Externsteine - Schicksal<br />
eines vorchristlichen Heiligtums in karolingischer Zeit, Stuttgart<br />
1982<br />
Schöntag (1988): W. Schöntag, 250 Jahre Abteikirche Beuron.<br />
Geschichte, geistliches Leben, Kunst. Beuron 1988<br />
Ders.: Die Augustinerchorherrenabtei Beuron, Beilage zum Staatsanzeiger<br />
Baden-Württemberg <strong>1989</strong>, S. 10-16<br />
Stierle (1987): L. Stierle, Bartholomäus Pirzschelin, der umstrittene<br />
Augustiner-Chorherr von Beuron und Pfarrherr in Egisheim,<br />
Zschr. für Hohenz. Geschichte 23 (1987), Sigmaringen <strong>1989</strong>,<br />
S. 217-228<br />
Walter (1948): M. Walter, Der Name Beuron, Schwäbisches Tagblatt<br />
(Hechingen) 1948, Nr. 12 und 16 (13. und 27. Febr. 1948), s.<br />
Hohenz. Heimatbibl. Hechingen, Nr. 4073.<br />
Wikinger am Vierwaldstätter See und auf der Schwäbischen Alb ?<br />
Vor wenigen Jahren hat Schneider 1 in einer verdienstvollen<br />
Zusammenstellung der Literatur den Wahrheitsgehalt der<br />
schweizerischen und der schwäbischen Stammestradition<br />
überprüft. Die in dem »Herkommen der Schwyzer und<br />
Oberhasler«, in der nordschwäbischen Herkunftssage und im<br />
Anno-Lied erhaltenen Reste konnte er durch wahrscheinlich<br />
hier zugehörige Zeugnisse aus dem Voralbland und aus der<br />
Baar erweitern. Alles Wesentliche enthält seine Zusammenfassung:<br />
1. Die auf eine Herkunft aus Skandinavien hinweisende und<br />
unsoweit mit den Abstammungstraditionen der Goten und<br />
Langobarden übereinstimmende Herkunftssage ist nicht nur<br />
in dem »Herkommen der Schwyzer und Oberhasler«, der<br />
nordschwäbischen Origo gentis Sweworum und dem Anno-<br />
Lied erhalten geblieben, sondern höchstwahrscheinlich auch<br />
in einer Reihe von örtlichen Überlieferungen Südwestdeutschlands.<br />
2. Für die Glaubwürdigkeit der swebischen Herkunftssage<br />
spricht, daß die genannten Überlieferungen verschiedene<br />
historische Einzelheiten enthalten, so etwa, daß die Alamannen<br />
ein nach Art einer Wanderlawine entstandener Stamm<br />
42<br />
sind (Herkommen, Annolied) oder daß die Vorfahren berittene<br />
Krieger, also die Oberschicht des Volkes gewesen sein<br />
sollen (Origo, örtliche Überlieferung Betzingens und des<br />
Steinlachtals).<br />
4. Auch die Verwandtschaft des alamannischen und des altnordischen<br />
Rechts, namentlich aber die Übereinstimmung<br />
vieler nur im alamannischen Gebiet vorkommenden Wörter<br />
mit dem Wortgut der nordischen Sprachen ist ein Beweis<br />
dafür, daß die Vorfahren der Alamannen einst in Skandinavien<br />
gewohnt haben.<br />
Punkt 3 bei Schneider ist zu streichen. Er setzt die skandinavische<br />
Einwanderung in die frühe Eisenzeit. Die Stammesüberlieferungen<br />
berichten aber eine viel spätere Zuwanderung aus<br />
»Schweden«: die Vorgänge sind wie die Abwanderung der<br />
Langobarden an das Ende der Völkerwanderung zu datieren.<br />
Die alten Sitze der Semnonen werden im Ö.Jahrhundert<br />
geräumt 2 - unter dem Einfluß früher Wikinger, die die Elbe<br />
aufwärts vordrangen.<br />
Dieser Schluß ist eine Parallele zu neueren Erkenntnissen<br />
über die Stammesbildung der Sachsen. Hauck 3 hat aus der
Übereinstimmung der sächsischen Stammestradition bei<br />
Widukind von Corvey und Rudolf von Fulda mit Funden<br />
heidnisch-nordischer Brakteaten an der Wesermündung<br />
gezeigt, daß sich von hier aus der neue Stamm erobernd in das<br />
Landesinnere ausgebreitet hat. Unter der Führung der im<br />
Land Hadeln gelandeten frühen Normannen nahmen an<br />
diesem Vorstoß sogar sächsische Rückwanderer aus Britannien<br />
teil. Unverkennbar sind Parallelen aus späterer Zeit an<br />
den Küsten Westeuropas wie in den Flußsystemen Osteuropas.<br />
Es ist sicher, daß frühe Wikinger nicht nur in die Weser<br />
sondern auch in das Stromgebiet der Elbe eindrangen. Hier<br />
stoßen sie die letzte Wanderwelle der Elbgermanen an, die der<br />
Langobarden und die der Schwaben. Sie werden für die<br />
wanderwilligen Stammesteile zur treibenden Kraft, zur neuen<br />
Führungsschicht. Von ihnen wird nordisch-heidnisches Kulturgut<br />
nach dem Süden getragen 4 , sie bringen Runen nach<br />
dem Süden mit wie das Wortgut, für das Maurer 5 Parallelen<br />
zwischen Alamannien und Skandinavien festgestellt hat. Die<br />
»nordische Phase« der Alamannen« ist nach Christlein 6<br />
allerdings nur kurz, etwa zwei Generationen. Ihr geistiger<br />
Inhalt wird im Süden ohne rechtes Verständnis rezipiert.<br />
Die Origo bezeugt die Landung der Skandinavier im dänischen<br />
Schleswig, bei Haithabu als der Verkehrszentrale des<br />
Nordens. Wenn der Weg zur Elbe entlang der Westküste<br />
genommen wurde und hier schon die Wanderlawine zu<br />
wachsen begonnen hat, erklärt dies zwanglos, daß später -<br />
nach dem »Herkommen« - in der Schweiz »Schweden und<br />
Friesen« gemeinsam hängen geblieben sein sollen. Mit Sachsen<br />
und Schwaben gemeinsam hatten die Franken das Thüringerreich<br />
zerschlagen. Aus der Beute erhielten die Sachsen den<br />
Norden bis zum Harz. Die besitzend-konservative Oberschicht<br />
der Schwaben - die Reiter der Origo - findet neue<br />
zusagende Wohnsitze im Nordschwabengau zwischen Elbe,<br />
Harz und Unstrut. Der Großteil des Volkes aber bricht unter<br />
neuer, skandinavischer Führung in den Süden auf - ins<br />
gelobte Land Italien.<br />
Die gewählte Route - über Südwestdeutschland und über die<br />
Alpen - mußte zu Konflikten mit den Franken führen. Das<br />
»Herkommen« berichtet davon. Die Langobarden - schon im<br />
oberen Leinetal beim Vorstoß nach Süden abgewehrt - hatten<br />
deshalb den freigewordenen Weg elbaufwärts gewählt, um<br />
die Alpen im Osten zu umgehen. Mit ihnen zogen sächsische<br />
Kontingente, die zuvor im Nordschwabengau ansässig gewesen<br />
waren.<br />
Den Franken dürfte - über die Probleme des Durchmarsches<br />
hinaus - das Wanderziel der Schwaben durchaus ins politische<br />
Konzept gepaßt haben. Italien war in ostgotischer Hand.<br />
JÜRGEN SCHMIDT<br />
In fränkischem Auftrag, mit unklarem Ziel, mehr auf eigene<br />
Interessen aus, operierten dort wenig später die Alamannen<br />
unter Butilin und Leuthari. Da der erste Landnahmeversuch<br />
der Schwaben in Italien von den Ostgoten noch abgewehrt<br />
werden konnte, ist es verständlich, daß man bei Stammesverwandten<br />
hängen blieb - bei den sich in den burgundischen<br />
Bereich in der Nordschweiz ausdehnenden Alamannen.<br />
Auch dies dürfte die Franken kaum gestört haben.<br />
Aber auch nördlich vom Hochrhein machten sich nach der<br />
Origo die Schwaben breit: sie besetzten die Lande der<br />
»Wilhari«, die Baar, die Westalb und das Land am oberen<br />
Neckar. Sie beenden hier die Selbstisolation 6 der »frühen<br />
Alamannen«. Dies kann nur im Einverständnis mit den<br />
Franken geschehen sein. Die »frühen Alamannen« in diesem<br />
Gebiet waren mit den Sueben nicht stammverwandt. Die<br />
Abgrenzung von den unterworfenen Wilhari, den Gallovari<br />
der Veroneser Völkertafel 7 wird hier aus den Berichten von<br />
»schwedischen« Berittenen erkennbar. Genau in diesen Räumen,<br />
im Albvorland, auf der Westalb und in der Baar läßt sich<br />
bis zur späten Christianisierung hier ein in der Unterschicht<br />
zäh behauptetes autochthones Heidentum fassen 8 . Das Christentum,<br />
dessen Symbole schon auf einigen Funden der<br />
»nordischen Phase« als magische Abwehrzeichen auftauchen,<br />
wird hier über die neue Oberschicht eingeführt.<br />
Aus der Parallele zur sächsischen Stammesbildung lassen sich<br />
somit noch offene Fragen der schwäbischen und schweizerischen<br />
Tradition erklären. Diese sind geschichtliche Überlieferung<br />
der späten Landnahme und stehen in Einklang mit<br />
bekannten historischen Abläufen.<br />
Literatur<br />
1<br />
W. Schneider, Arbeiten zur frühalamannischen Geschichte, Heft<br />
III/IV, Tübingen 1976, S. 1 ff.<br />
2<br />
B. Krüger, Zum germanischen Siedlungswesen im Spree-Havel-<br />
Gebiet, EAZ Ethnogr.-Archäol. Z.28 (1987), S.249ff.<br />
3<br />
K. Hauck, Goldbrakteaten aus Sievern - spätantike Amulettbilder<br />
der »Dania Saxonica« und die Sachsen-Origo bei Widukind von<br />
Corvey, München 1970<br />
Ders., Das Wissen Widukinds von Corvey von der Neubildung des<br />
sächsischen Stammes im 6. Jahrhundert, Ostwestfälisch-weserländische<br />
Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde, Münster/<br />
W. 1970<br />
4<br />
K. Hauck, Alemannische Denkmäler der vorchristlichen Adelskultur,<br />
Z. für Württ. Landesgeschichte 16 (1957), S. lff.<br />
5<br />
F. Maurer, Nordgermanen und Alemannen, Bern/München 1952<br />
6<br />
R. Christlein, Die Alamannen, Stuttgart 1979, S. 112-124<br />
7<br />
Notitia Dignitatum et Latercula Provinciarum, O.Seeck ed.,<br />
Nachdruck Frankfurt/M. 1962, S.251<br />
8<br />
H.-D. Lehmann, O. Bogenschütz, Von den Kapfen der Alaman-<br />
nen, in Vorbereitung<br />
Der Wald Weithart aus forstwissenschaftlicher Sicht, gestern und heute (i. Teil)<br />
Wer von Pfullendorf auf der gut ausgebauten Landesstraße<br />
Nr. 268 nach Mengen fährt, kommt kurz hinter Mottschieß in<br />
einen Wald, der erst kurz vor Mengen endet.<br />
Dieses große Waldgebiet, das man in Längsrichtung durchquert,<br />
heißt Weithart.<br />
Der aufmerksame Autofahrer bemerkt, daß ein Großteil der<br />
Straße durch den Weithart von alten Eichen gesäumt wird.<br />
Die erste Eiche, auf die er trifft, trägt eine kleine weiße Tafel<br />
mit der Aufschrift »Stadt Pfullendorf, Distrikt VII/2 Weithart«.<br />
Der Weithart ist eines der größten zusammenhängenden<br />
Waldgebiete und der größte zusammenhängende Gemeindewaldkomplex<br />
im Forstbezirk Pfullendorf. Insgesamt umfaßt<br />
er 816 ha Wald (ohne den Mengener Distrikt »Innerer<br />
Weithart«). Die Orte, die Besitzanteil am Weithart haben,<br />
liegen ringsum. Es sind dies: Pfullendorf, Schwäbiishausen,<br />
Hausen a.A., Krauchenwies, Rulfingen, Mengen, Rosna,<br />
Habsthal, Levertsweiler, Lausheim/Magenbuch, Mottschieß.<br />
43
Die naturräumlichen Daten des Waldes Weithart<br />
Geologie, Böden<br />
Der Weithart gehört landschaftlich dem Wuchsgebiet »Südwestdeutsches<br />
Alpenvorland« an. Innerhalb dieser Großlandschaft<br />
trennt man zwischen der Jungmoräne und der<br />
Altmoräne. Der gesamte Weithart liegt im Bereich der Altmoräne,<br />
d.h. das Ausgangsmaterial zur Bodenbildung entstammt<br />
der Rißeiszeit, in der große Gletscherströme unser<br />
Gebiet überzogen und am Grund sehr viel Erdmaterial<br />
mitführten. Nach dem Rückzug des Eises entwickelten sich<br />
die Böden, die heute schon bis zu 200000 Jahre alt sind. Die<br />
Böden der Jungmoräne dagegen sind wesentlich jünger. Sie<br />
entstammen der Würmeiszeit und sind ca. 20000 Jahre alt.<br />
Die Grenze läuft etwa durch Pfullendorf. Innerhalb dieser<br />
200000 Jahre ist die Bodenentwicklung weit fortgeschritten.<br />
Die feinen, tonigen Bodenbestandteile haben sich vielfach<br />
nach unten verlagert und zu wasserstauenden Schichten<br />
zusammengetan. Das bedeutet, daß im Weithart großflächig<br />
Stauwasserböden vorhanden sind.<br />
Auf sogenannten Standortskarten wird für alle Waldungen,<br />
die durch Bohrungen im Abstand von 50 x 50 m ermittelte<br />
Bodenbeschaffenheit ausgewiesen. Diese Karte zeigt dem<br />
Forstmann, welche Bedingungen der Baum im Boden vorfindet.<br />
Auffallend bei der Standortskarte für den Weithart sind<br />
die vielen Wellensignaturen. Diese bedeuten: Wasserstau.<br />
Tatsächlich überwiegen im Weithart vernässende, lehmigtonige<br />
Böden, in denen die Fichte sehr flach wurzelt und<br />
deshalb stark sturmgefährdet ist.<br />
Lage, Klima<br />
Der Weithart liegt zwischen 620 und 640 m ü.d.M. und zeigt<br />
ausschließlich ebene Lagen. Die Jahresmitteltemperatur<br />
beträgt 7,1° C (Station Mengen) und im Durchschnitt der<br />
letzten 80 Jahre fielen 750 mm Niederschlag. Das ist relativ<br />
wenig. Hier macht sich der Regenschatten der Schwäbischen<br />
Alb deutlich bemerkbar. Insgesamt handelt es sich um ein<br />
kontinental getöntes Klima mit hoher Neigung zu Früh- und<br />
Spätfrösten.<br />
Verschiedene Veränderungen in den Besitzverhältnissen,<br />
sowie der Wald/Feldverteilung seit 1740 (soweit bisher ermittelt)<br />
Wir beginnen unsere Betrachtung im Jahre 1740. Der seither<br />
gemeinschaftlich benutzte Weithart wurde am 30. Mai 1740<br />
auf die 2 Städte und die 10 Anliegergemeinden nach der<br />
Anzahl der Haushaltungen aufgeteilt. Verantwortlich für ihre<br />
Gemeinden zeichneten hierbei die Fürstenhäuser Hohenzollern-Sigmaringen<br />
und Fürstenberg, sowie das Reichstift<br />
Salem und das Kloster Habsthal.<br />
Die Waldbesitzverteilung des Vertrages von 1740 wurde in<br />
einer Karte aufgezeichnet. Der Wald war damals insgesamt<br />
2374 Jauchert groß, was etwa 875 ha (1 Jauchert = 0,37ha)<br />
entspricht.<br />
Was geschah seither f<br />
Oberes Stückle (Krauchenwies)<br />
Bereits 1743 hatten die beiden Städte Pfullendorf und Mengen<br />
je 15 Jauchert (5,6 ha) an die Gemeinde Krauchenwies abgeben<br />
müssen. Krauchenwies hatte nachträglich einen größeren<br />
Waldan teil reklamiert und Recht bekommen. Hierauf kommen<br />
wir gelegentlich zurück.<br />
Während Mengen einen Streifen längs der Nordwestgrenze<br />
an Krauchenwies abtrat, blieb Pfullendorf nichts anderes<br />
übrig, als ein Waldstück inselartig aus dem Pfullendorfer<br />
Weithartanteil herauszulösen und an Krauchenwies abzugeben.<br />
So entstand der Krauchenwieser Gemeindewalddistrikt<br />
IX »Oberes Stückle« als Exklave weitab vom Hauptkomplex<br />
44<br />
des Krauchenwieser Waldes zwischen dem Mottschießer und<br />
dem Pfullendorfer Weithart gelegen.<br />
Kompromißplätze<br />
Auf der Karte von 1740 sind waldlose Flächen ausgespart, die<br />
über den ganzen Weithart verstreut sind. Das waren die<br />
sogenannten »Öden Plätze«, die für eine Baumbestockung<br />
nicht tauglich erschienen. Diese »Öden Plätze« im Umfang<br />
von 74 Jauchert und 15 Ruten (27 ha) wurden bei der<br />
Abteilung des Waldes im Jahre 1740 gesondert ausgewiesen<br />
und nicht aufgeteilt. Sie mußten zur gemeinsamen Weidebenutzung<br />
offen bleiben. Was mehrere hundert Jahre im gesamten<br />
Weithart stattgefunden hatte, - die gemeinsame Weidebenutzung<br />
-, war nun auf diese »Öden Plätze« oder auch<br />
»Kompromißplätze« beschränkt.<br />
Auf der Standortskarte erkennt man sie als nasse, sumpfige<br />
Lagen, auf denen die Nadelbäume Probleme aller Art haben<br />
und hatten. Auch die Namen der Kompromißplätze deuten<br />
auf ständigen starken Wassereinfluß hin, z.B. Schwarzes<br />
Moos, Im Herzenmösle, Im Altweiherteich.<br />
Nach Aufhebung der Waldweide zwischen 1820 und 1840<br />
(Mengen 1827) wurden die Kompromißplätze zwecklos. Sie<br />
sind 1845 größtenteils an die Gemeinden verkauft, zum Teil<br />
versteigert, danach zum überwiegenden Teil aufgeforstet<br />
worden. Heute noch erkennt man sie an den schlechteren<br />
Bodenvegetationstypen. Auf einer Karte über die Markung<br />
Weithart von 1881 sind mit Ausnahme des Schwarzen Mooses<br />
alle Kompromißplätze aufgeforstet.<br />
Das Schwarze Moos war mit rund 25 Jauchert (ca. 10 Hektar)<br />
der größte Kompromißplatz. Er ist der einzige heute noch<br />
erhaltene. Die »unfruchtbare, sumpfige Öde« wurde 1845 an<br />
die Gemeinde Levertsweiler billig verkauft. Im gleichen Jahr<br />
erfolgte eine Begradigung und die Festlegung der Grenzen<br />
gegen den Wald. Hierbei entstand die heutige rechteckige<br />
Form. Später wurde das Moor entwässert und kultiviert.<br />
Bereits 1870 bezahlte man 300 Gulden für einen Morgen des<br />
Grundstücks.<br />
Heute ist das Schwarze Moos in 52 Flurstücke eingeteilt, die<br />
22 verschiedenen, meist Levertsweiler Bürgern gehören. Die<br />
Vorstellungen der Eigentümer über die künftige Bodennutzung<br />
ihres Anteils sind sehr unterschiedlich. Einige wollen<br />
ihren Anteil aufforsten, andere weiter Landwirtschaft betreiben.<br />
Ein gemeinsamer sinnvoller Weg wird in nächster Zeit<br />
gefunden werden müssen. Es wäre schade, wenn das<br />
Schwarze Moos, als letzter Zeuge der ehemaligen gemeinsamen<br />
Weithartbenutzung, völlig verschwände.<br />
Der »Öde Platz gegen Krauchenwies«, einst 16 Jauchert 48<br />
Ruten (= ca. 6 ha) groß, wurde an Krauchenwies, Rulfingen<br />
und das Haus Hohenzollern-Sigmaringen verteilt. Die<br />
Gemeinde Krauchenwies benutzte den Platz lange Zeit als<br />
Fäkaliengrube und als Kadaverplatz. In den ehemaligen<br />
Tongruben wurden u. a. Pferdekadaver vergraben. Im Volksmund<br />
hieß er »Roßhimmel«. Der öde Platz »Im Herzenmösle«•<br />
war schon immer ein sehr feuchtes Gebiet. Vor<br />
einigen Jahren gestaltete hier die Gemeinde Krauchenwies<br />
eine landschaftlich reizvolle Wasserfläche.<br />
An allen aufgeforsteten Kompromißplätzen finden sich alte<br />
Eichen. Diese Baumart war wegen der Eicheln für Futterzwecke<br />
bei der Weidenutzung wichtig.<br />
Sonstige Veränderungen im Besitz und der Wald/Feldverteilung<br />
im Weithart<br />
Besitzveränderungen im Zuge der Säkularisation<br />
1803 bestimmte der Reichsdeputationshauptschluß zu<br />
Regensburg: »Alle Güter der Stifte, Abteien und Klöster<br />
werden zur freien Verfügung den entsprechenden Landesherren<br />
überlassen.«
Für die Besitzverteilung im Weithart bedeutete das:<br />
a. Der Weithartanteil des Klosters Salem (22,2 ha) ging an das<br />
Fürstenhaus Thum und Taxis über.<br />
b. Der Weithartanteil des Klosters Habsthal (20,3 ha) ging an<br />
das Haus Hohenzollern-Sigmaringen über.<br />
In der Folgezeit wurde dieser ehemalige Habsthaler Anteil<br />
ausgestockt, an Privathand verkauft und landwirtschaftlich<br />
genutzt. Heute sind bereits wieder Aufforstungen im<br />
Gange.<br />
Tausch Levertsweiler - Pfullendorf<br />
Noch vor 1881 hatten Levertsweiler und Pfullendorf einen<br />
Flächentausch vorgenommen. Levertsweiler gab seinen<br />
ehemals ganz im Süden des Weitharts gelegenen Anteil an<br />
Pfullendorf und erhielt dafür einen ortsnäheren Anteil des<br />
Pfullendorfer Weitharts.<br />
Ausstockung im Westteil des Pfullendorfer Weitharts<br />
Zwischen 1849 und 1858 wurden ca. 21ha des Pfullendorfer<br />
Weitharts ausgestockt und verkauft.<br />
Besitzübergang an Spital Pfullendorf<br />
1906 ging die Abteilung VII/9 des Pfullendorfer Weitharts<br />
im Wege eines Tausches an das Spital Pfullendorf über.<br />
Bundeswehrgelände Mottschieß<br />
1961 kaufte der Bund den Distrikt VII/5 des Pfullendorfer<br />
Weitharts mit 34,1 ha und rodete ihn.<br />
Gemeindereform<br />
Die bisher letzte größere Veränderung in den Besitzverhältnissen<br />
brachte die Gemeindereform der 70er Jahre.<br />
Durch die Eingemeindungen wurden die Weithartanteile<br />
von<br />
a. Mottschieß, Schwäbiishausen und Pfullendorf<br />
b. Hausen und Krauchenwies<br />
c. Rulfingen, Rosna und Mengen<br />
d. Lausheim und Levertsweiler<br />
innerhalb des jeweiligen Gesamtgemeindewaldes vereinigt.<br />
Durch die Eingemeindungen und die Vergrößerung<br />
der Gemeindewaldungen hat der jeweilige Waldanteil im<br />
Weithart an Bedeutung verloren. Von dem heute rund<br />
900 ha großen Stadtwald Pfullendorf liegt 'A der Fläche im<br />
Weithart. Der Weithart stellt Vi des heutigen Krauchenwieser<br />
Waldes. Für den Gemeindewald Ostrach erscheint<br />
der heutige Weithart-Anteil von 11% gar unbedeutend.<br />
Vor der Gemeindereform hatte der Wald im Weithart für<br />
die Gemeinden einen wesentlich höheren Stellenwert. So<br />
hatten Schwäbiishausen, Mottschieß und Levertsweiler<br />
ausschließlich im Weithart Waldbesitz.<br />
Zieht man für die letzten 140 Jahre eine Waldflächenbilanz,<br />
so stehen 76 ha Rodungen (Straßenbau, Bundeswehrgelände,<br />
Ausstockung im Westteil des Pfullendorfer Weitharts,<br />
Ausstockung des ehemaligen Habsthaler Anteils)<br />
Aufforstungen im Umfang von 16 ha (einstige »Ode<br />
Plätze«) gegenüber. Insgesamt gingen also 60 ha verloren -<br />
pro Jahr nahezu Vi Hektar.<br />
Die Entwicklung der Waldbewirtschaftung und des Waldzustandes<br />
unter dem Einfluß des Menschen.<br />
Der Zustand jedes Waldes hängt im wesentlichen von 2<br />
Komponenten ab:<br />
a. von den natürlichen Gegebenheiten, wie z.B. Klima und<br />
Boden und den Veränderungen<br />
b. vom Einfluß des Menschen<br />
Südlicher Weithart bei Mottschieß<br />
Wie sah der Wald Weithart aus, bevor der Mensch Einfluß<br />
nahm?<br />
Aus der Siedlungsgeschichte ist bekannt, daß der Wald bis<br />
etwa ins 8./12. Jahrhundert unberührt blieb. Die frühe Siedlungsperiode<br />
durch die Alemannen erfolgte zwischen<br />
250-500 n. Ch. von der Alb her entlang der Wasserläufe (vor<br />
allem Donau und Bodensee). Ortsnamenendungen mit<br />
-ingen und -heim zeugen von dieser ersten Siedlungsperiode.<br />
Trägt man die -ingen und -heim-Orte auf einer Karte ein,<br />
erkennt man eine Grenzlinie Oberteuringen, Untersiggingen,<br />
Denkingen, Göggingen. Die großen Waldgebiete Wagenhart,<br />
Magenbuch und Weithart blieben dagegen lange unberührt.<br />
Mit großer Wahrscheinlichkeit war damals ein großer<br />
Urwaldblock vorhanden, der erst zwischen dem 8. und<br />
12. Jahrhundert im Zuge der von Donau und Bodensee<br />
einsetzenden Besiedlung »aufgehackt« wurde. Aber auch die<br />
verbliebenen geschlossenen Waldungen machen noch einen<br />
gewaltigen Eindruck.<br />
Wie setzte sich der damalige Urwald zusammen f<br />
Die Antwort gibt uns die sogenannte Pollenanalyse. Alle<br />
Blütenpflanzen, zu denen auch unsere Waldbäume gehören,<br />
besitzen Blütenstaub, den sogenannten Pollen. Findet man<br />
ein Pollenkorn, kann man mikroskopisch bestimmen, welcher<br />
Pflanzenart es entstammt. In Mooren wird Blütenstaub<br />
konserviert. Andererseits weiß man, wie schnell ein Moor<br />
wächst. Untersucht man also die Moorsubstanz in bestimmter<br />
Tiefe auf Pollen, läßt sich rekonstruieren, wie sich der<br />
Wald damals zusammensetzte.<br />
Mitten im Weithart liegt das sogenannte Hirschsoppenmoor.<br />
Dort wurde 1948 von Hauff eine Pollenanalyse durchgeführt.<br />
45
Danach setzte sich der Urwald vor Einflußnahme durch den<br />
Menschen wie folgt zusammen:<br />
Fichte 5% Buche 13%<br />
Tanne 3% Eiche 9%<br />
Kiefer 23% sonstige Laubbäume 47%<br />
Sa. Nadelbäume 31% Sa. Laubbäume 69%<br />
(+ Erle, Esche, Weide, Birke etc.)<br />
Die Entwicklung der Baumartenanteile bis heute zeigt eine<br />
rasante Zunahme des Fichtenanteils, vor allem auf Kosten der<br />
Laubbäume. Wie konnte das geschehen ? Die Betrachtung der<br />
Waldwirtschaft von 1200 bis heute soll die Antwort darauf<br />
geben.<br />
Die Waldwirtschaft zwischen 1200 und 1740<br />
Wie bereits erwähnt, wurde der Weithart zwischen 1200 und<br />
1740, also über 500 Jahre lang, gemeinsam benutzt. Jeder<br />
bediente sich nach seinem Gutdünken. Waldweide, Streunutzung,<br />
Gras- und Moosnutzung, Harzgewinnung, Köhlerei,<br />
Rindengewinnung, waren die wichtigsten sogenannten<br />
Nebennutzungen, auf die später noch näher eingegangen<br />
wird. Die damalige Hauptnutzung war die Brennholznutzung,<br />
untergeordnet die Bauholznutzung.<br />
Der Brennholzbedarf der Städte Mengen und Pfullendorf war<br />
sehr groß und so griff man von Anfang an die Bestände der<br />
Rotbuche, aber auch die der Esche, Birke und Hainbuche an.<br />
OTTO WERNER<br />
Wir können davon ausgehen, daß die im Urwald mit 13%<br />
beteiligte Rotbuche nach 200-300 Jahren weitgehend verschwunden<br />
war. Zur Zeit der Aufteilung im Jahre 1740 wurde<br />
sie nicht mehr erwähnt.<br />
Nach Holzeinschlägen im Weithart blieben meist große<br />
baumlose Platten übrig. Die natürlich aufschlagenden Laubbäume<br />
hatten bei der damaligen intensiven Waldweide keine<br />
Chance.<br />
Andererseits war es nicht üblich, wieder aufzuforsten. Heute<br />
ist dies gesetzlich vorgeschrieben. Hier fand die Fichte die<br />
besten Voraussetzungen. Als Lichtbaumart mit weittragendem<br />
Samen, drang sie von den Moorrändern her auf die<br />
holzlosen Platten vor. Offensichtlich konnte sie auch der<br />
Weidebetrieb nicht aufhalten. Daß die Fichte bereits im<br />
16. Jahrhundert stark in den Weithart eingedrungen war, geht<br />
aus Rechnungen für das Harzen des Spitals Pfullendorf von<br />
1597/98 hervor.<br />
Die Eiche wurde als wertvoller Mastbaum für die Waldweide<br />
frühzeitig geschont. Bereits 1521 existierte eine Eichelordnung<br />
für den Weithart.<br />
Während des 30jährigen Krieges 1618-1648 muß man besonders<br />
schlimm im Weithart gehaust haben, so daß sich die<br />
Kiefer, die überall da wächst, wo sonst nichts mehr gedeiht,<br />
weiter ausbreiten konnte. Einige Waldbezeichnungen zeugen<br />
noch von der einst vorherrschenden Kieferdominanz, (z. B.<br />
Fohrenstock bei Rosna). (Fortsetzung in Heft 4)<br />
»Hochzeit Conto« (1830) für Johannes Gfrörer, Bürger von Hechingen<br />
Im Wonnemonat Mai des Jahres 1830 heiratete der Hechinger<br />
Bürger Johannes Gfrörer die Hechinger Bürgerstochter Theresia<br />
Stotz. Aus dem Besitz Ludwig Eglers ist uns von dieser<br />
Hochzeit eine Rechnung des Wirts »Zum goldenen Adler«<br />
erhalten geblieben. Die Tavernwirtschaft »Zum goldenen<br />
Adler« lag am Marktplatz (und brannte am 17. September<br />
1901 ab). Der Wirt Joseph Schmid war übrigens auch Goldund<br />
Silberarbeiter. Das Blatt ist überschrieben: »Hochzeit<br />
Conto vor (=für) Johannes Gfrörer, was verzört worden<br />
ist« '. Die Brautleute mußten vor der Trauung in der Pfarrkirche<br />
St. Jakobus in Hechingen »verkündigt« werden; dies<br />
geschah am Palmsonntag (4.4.) 2 , am Ostermontag (12.4.)<br />
und am Weißen Sonntag (18. 4.) 3 .<br />
Schon vor dem Hochzeitstag waren etliche Personen auf die<br />
Rechnung des Bräutigams gesetzt worden. »Beym Hochzeit<br />
Einschreiben« schickte der Wirt »Zum goldenen Adler«<br />
1 Maas 4 Sechs-Batzen-Wein 5 in den Pfarrhof. Sehr nüchtern<br />
und trocken scheint es dort nicht zugegangen zu sein. Warum<br />
auch? Heiraten ist zwar eine ernste, aber keine triste Angelegenheit.<br />
Am 2. Mai (Sonntag) ließ der Bräutigam wieder VA<br />
Maas Wein gleicher Qualität und für 3 Kreuzer Brot anschreiben.<br />
Am 7. Mai (Freitag) wurden von den beiden Gespielinnen<br />
der Braut 1 Schoppen 6 Wein getrunken und für 1 Kreuzer<br />
Brot verzehrt. Einige Tage vor der Hochzeit erfolgte die<br />
Einladung der Gäste durch die beiden von Haus zu Haus<br />
gehenden Brautjungfern; dabei haben sie sich einen Trunk<br />
genehmigt. Am Sonntag, dem 9. Mai - zwei Tage vor der<br />
Hochzeit -, wurden 4 Maas und 1 Schoppen Sechs-Batzen-<br />
Wein und Brot für 9 Kreuzer angeschrieben. Das müssen<br />
wohl die trinkfesteren Gesellen des Bräutigams gewesen sein,<br />
die mit dem Hochzeiter Abschied vom Junggesellendasein<br />
feierten. Dies ging alles auf die Rechnung des Bräutigams,<br />
46<br />
und noch vor dem Hochzeitstag stand er mit 3 Gulden und<br />
1 Kreuzer beim Wirt Joseph Schmid in der Kreide. Aus dem<br />
»Ehebuch 1807-1895« der Pfarrei St. Jakobus Hechingen<br />
geht hervor, daß der Bräutigam als ehrbarer Jungmann, die<br />
Braut als ehrbare Jungfrau in die Ehe gingen. Die Hochzeit<br />
war am Dienstag, dem 11. Mai 1830. »Ehrliche« jungfräuliche<br />
Hochzeiten wurden an Sonntagen, Montagen oder Dienstagen<br />
abgehalten, andere zur Unterscheidung am Mittwoch 7<br />
(J. Cramer schreibt, daß seit 1692 an Sonn- und Feiertagen<br />
nicht mehr geheiratet werden durfte) 8 .<br />
Eine standesamtliche Trauung gab es damals noch nicht. Die<br />
Regierung richtete aber insofern ein wachsames Auge auf die<br />
ehelichen Verbindungen, als der Ehekonsens des Landesherrn<br />
erst nach Vollendung des 24. Lebensjahres und nur<br />
dann erteilt wurde, wenn die Brautleute ein Vermögen von<br />
700 Gulden mit in die Ehe brachten. Sie sollten den Gemeinden<br />
(der Armenfürsorge) nicht zur Last fallen.<br />
Der Priester, der den beiden das Ja-Wort abnahm, war<br />
Kooperator Joseph Reiner. Als Trauzeugen bestätigten das<br />
Versprechen Joseph und Friedrich Blumenstetter. Schon<br />
J.Cramer teilte mit, daß »bürgerliche Hochzeiten« 9 und<br />
sonstige die Bürgerschaft berührende Lustbarkeiten im Rathaus<br />
abgehalten wurden. 1799 wurde dies abgeschafft, außer<br />
der Wirt, der die Hochzeit ausrichtete, zahlte eine festgesetzte<br />
Taxe 10 ; im Jahre 1830 war diese auf 6 Gulden 30 Kreuzer<br />
festgesetzt, wovon der Hochzeiter die Hälfte zahlen<br />
mußte. Von Cramer erfahren wir auch, es sei bestimmt<br />
worden, daß »bei den Mählern mehr Gäst nit, dann was an<br />
zweien, oder auf's mehrist an dreien Tischen sitzen<br />
mögen« 11 , teilnehmen durften.<br />
Beim Hochzeitsmahl saßen der Hochzeiter mit den Männern
und die Hochzeiterin mit den Frauen an getrennten Tischen.<br />
Am Tisch des Bräutigams nahmen fünf Personen das Mahl<br />
ein: der Hochzeiter, zwei Gesellen, die namentlich nicht<br />
genannt sind, ein Herr Wannenmacher und ein Herr Zoll. Sie<br />
verzehrten je für 24 Kreuzer Speisen, was 2 Gulden ausmachte.<br />
Am Tisch der Braut speisten vier Personen: die<br />
Braut, zwei Gespielinnen, die wir namentlich zwar auch<br />
nicht, doch ihrer Zurückhaltung wegen bei der Einladung zur<br />
Hochzeit kennen, und die Mutter der Braut. Ihr Verzehr<br />
machte zusammen 1 Gulden 36 Kreuzer aus.<br />
Ludwig Egler hat in der »Chronik der Stadt Hechingen«<br />
aufgezeichnet, daß das Hochzeitsessen mit einer Fleischsuppe<br />
und Weißbrotschnitten (zuweilen auch mit Butterknöpfle)<br />
seinen Anfang nahm, worauf ein Voressen aus Kutteln,<br />
Kalbsfüßen und Ochsenmaul folgte. Der erste Hauptgang<br />
war Ochsenfleisch mit Meerrettich (aha: Hechinger<br />
Tafelspitz), der zweite Speck und Kraut mit Blut- und<br />
Leberwurst (eine Schlachtplatte) und der dritte Kalbsbraten<br />
mit Salat 12 .<br />
Nachdem eine genügende Grundlage geschaffen war, konnte<br />
dem Wein zugesprochen werden. Am Tisch des Hochzeiters<br />
wurden 15 Maas und 1 Schoppen Sechs-Batzen-Wein und<br />
3 Schoppen Acht-Batzen-Wein 13 für zusammen 6 Gulden<br />
30 Kreuzer getrunken, womit feststeht, daß das Getränk der<br />
Männer dreimal so teuer war wie das Essen. Die Frauen<br />
waren zurückhaltender; sie tranken nur 4 Maas Sechs-Batzen-Wein<br />
im Wert von 1 Gulden 36 Kreuzer, womit ihr Essen<br />
und Trinken im Gleichgewicht war, was die Kosten betraf.<br />
Für 26 Kreuzer wurde Brot zum Wein gegessen.<br />
Es waren sechs Musikanten bestellt. Sie spielten mit Geigen,<br />
Bassettchen 14 , Waldhorn und Klarinette auf 15 . Jeder<br />
Musikant bekam für 24 Kreuzer ein Essen und für 4 Kreuzer<br />
Brot. Für die Musikanten gab es 1 Maas Tischwein zum<br />
Essen. Dies machte zusammen 3 Gulden 12 Kreuzer. Doch<br />
damit nicht genug: Jeder Musikant erhielt anschließend noch<br />
1 Maas Sechs-Batzen-Wein und für 4 Kreuzer Brot, was<br />
zusammen 2 Gulden 48 Kreuzer ausmachte. Der Hochzeiter<br />
spendierte den Musikanten über das übliche Maß hinaus noch<br />
1 Maas Sechs-Batzen-Wein und Brot für 4 Kreuzer, was ihn<br />
zusätzlich 28 Kreuzer kostete.<br />
KARL WERNER STEIM<br />
Kulturelle Vereine im Oberamt Hechingen 1858<br />
Hohenzollern war gerade acht Jahre preußisch, da verlangte<br />
die Königliche Regierung in Sigmaringen am 11. Juni 1858<br />
(I Nr. 3917) vom Oberamt in Hechingen einen Bericht über<br />
»die wissenschaftlichen und künstlerischen Zwecken dienenden<br />
Gesellschaften und Vereine«. Mit Datum vom 5. Juli 1<br />
teilte der Oberamtsverweser statistische Angaben über zwölf<br />
Vereine mit, den Landwirtschaftlichen Bezirksverein<br />
Hechingen, einen Lokalverein für Gewerbe und Landwirtschaft<br />
in Hechingen und in Owingen, den Musikverein<br />
Hechingen sowie die acht Gesangvereine von Hechingen,<br />
Burladingen, Grosselfingen, Hausen, Killer, Owingen,<br />
Rangendingen und Stetten bei Hechingen. Diese Angaben<br />
sind heute noch von großem Interesse, vor allem bezüglich<br />
des Alters der Vereinigungen, ihrer Vorsitzenden, der Mitgliederzahlen,<br />
der Statuten usw. Ältester Verein war der auf<br />
das Jahr 1836 zurückgehende Musikverein Hechingen.<br />
In seiner Einleitung mußte der Oberamtmann mitteilen, »daß<br />
im diesseitigen Bezirke Gesellschaften und Vereine, welche<br />
direkt wissenschaftlichen oder künstlerischen Zwecken die-<br />
Auch der Torhüter wurde mit 1 Maas Sechs-Batzen-Wein<br />
und für 4 Kreuzer Brot bedacht, was ebenfalls 28 Kreuzer<br />
ausmachte. Die Unkosten für den Torhüter rührten von dem<br />
alten Brauch her, daß Hochzeitsgesellschaften aus der unteren<br />
oder oberen Vorstadt bei ihrem Gang zur Kirche das<br />
Stadttor verschlossen vorfanden. Der Torwärter ließ die<br />
Gesellschaft erst dann durch, wenn er vom Hochzeiter zum<br />
üblichen Maas Wein mit Brot eingeladen wurde.<br />
Ziehen wir einen Schlußstrich: Alles in allem kostete dem<br />
Hochzeiter Johannes Gfrörer Verzehr und Getränk 25 Gulden<br />
20 Kreuzer, wovon »wegen dem Musikant Steinhauser<br />
28 Kreuzer« - aus welchen Gründen auch immer - abgezogen<br />
wurden. Den Empfang von 24 Gulden 52 Kreuzern bestätigte<br />
der Wirt Joseph Schmid am 16. Mai 1830.<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Lagerort: HHBH, G114X.<br />
2<br />
Alle Zeitberechnungen nach Hermann Grotefend, Taschenbuch<br />
der Zeitrechnung. Hannover 1982.<br />
3<br />
Siehe »Ehebuch 1807-1895« der Pfarrei St. Jakobus Hechingen.<br />
4<br />
1 Hechinger Schenkmaß entspricht 1,39781.<br />
5<br />
Sechs-Batzen-Wein, von dem 1 Maas 6 Batzen (= 24 Kreuzer)<br />
kostete. 1 Batzen war 4 Kreuzer wert.<br />
6<br />
1 Schoppen war rund 0,3501.<br />
7<br />
Vgl. J. Gramer, Die Grafschaft Hohenzollern. Ein Bild süddeutscher<br />
Volkszustände. 1400-1850. Stuttgart 1873, S.246.<br />
8<br />
Ebd.<br />
9<br />
Bürgerliche Hochzeiten = Hochzeiten von Bürgern bzw. Söhnen<br />
und Töchtern von Bürgern.<br />
10<br />
Wie Anm.7, S.247.<br />
11<br />
Ebd., S.246.<br />
12<br />
Hechingen 1887, S.202.<br />
13<br />
Acht-Batzen-Wein war von besserer Qualität; ein Maas davon<br />
kostete 32 Kreuzer, also mehr als einen halben Gulden.<br />
14<br />
Bassettchen = Violoncello.<br />
15<br />
Wie Anm. 12.<br />
Hingewiesen sei noch auf den Beitrag von Karl Widmaier, Eine<br />
Bürgerhochzeit in Althechingen in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts.<br />
In: Schwäbisches Heimatbuch für Hohenzollern. Hrsg.<br />
Eugen Flad. Berlin 1926, S. 31-34.<br />
nen, nicht bestehen; dagegen dürften der hiesige Landwirtschaftliche<br />
Verein, die bestehenden Localvereine für Landwirtschaft<br />
und Gewerbe, sowie die in einzelnen Orten bestehenden<br />
Gesang-Vereine als solche Vereine angesehen werden,<br />
welche indirekt wenigstens jene Zwecke anstreben.«<br />
Ein einzelnen werden die Vereine wie folgt beschrieben:<br />
»1. Der hiesige Landwirtschaftliche Bezirksverein. Derselbe<br />
wurde am 18. September 1853 gegründet; Vorsteher ist der<br />
unterzeichnete Oberamtsverweser. Der Verein zählt zur Zeit<br />
354 Mitglieder und sind die für sämmtliche Hohenzollerischen<br />
landwirtschaftlichen Vereine bestehenden Normalstatuten<br />
in Nr. 34 des Amtsblattes pro 1853 (Seite 223) abgedruckt.<br />
2. Der Hechinger Localverein für Gewerbe und Landwirtschaft,<br />
constituiert und oberamtlich genehmigt am<br />
26. November 1857. Vorsteher ist Kreisgerichtsrath Werner,<br />
hier. Der engere Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern, nämlich:<br />
Kreisgerichtsrath Werner, Stadtschulheiß Ruff und Kaufmann<br />
Henne, hier. Ferner bsteht noch ein Ausschuß von<br />
47
Verlag: <strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Karlstraße 3, 7480 Sigmaringen<br />
M 3828 F<br />
Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt.<br />
7Mitgliedern. Die Statuten sind in Nr. 143 des Hohenzollerischen<br />
Wochenblatts de 1857 abgedruckt. Mit diesem Verein,<br />
welcher 110 Mitglieder zählt, ist zugleich ein Sparverein<br />
verbunden, zu welchem pro Monat 60 kr Beiträge von den<br />
einzelnen Mitgliedern eingezahlt werden.<br />
3. Der Localverein für Landwirthschaft und Gewerbe in<br />
Owingen, der am 1.Januar 1857 ins Leben getreten ist.<br />
Vorsteher ist Vogt Johann Stifel in Owingen; der Verein zählt<br />
36 Mitglieder und hat keine besondere geschriebene Statuten.<br />
4. Der Musik-Verein in Hechingen 1 , gegründet im Jahre 1836<br />
unter dem Protectorate Sr. Hoheit des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen.<br />
Vereinsdirector ist Stadtschultheiß Ruff,<br />
hier, und Musikdirector Provisor Lehmann. Die Zahl der<br />
aktiven Mitglieder beläuft sich auf 54 und der passiven<br />
Mitglieder auf 173. Ein Exemplar der Statuten ist Königlicher<br />
Regierung mit Bericht vom 12. September 1853 in Vorlage<br />
gebracht worden.<br />
5. Der Gesangverein in Hechingen 3 . Derselbe ist im Jahre<br />
1851 gegründet worden und zählt zur Zeit 20 active Mitglieder.<br />
Vorsteher ist der Vorsänger Lichtenstein 4 hier. Der<br />
Verein ist oberamtlich genehmigt und sind dessen Statuten<br />
der Königlichen Regierung mit Bericht vom 12. September<br />
1853 in Vorlage gebracht worden.<br />
6. Der Gesangverein in Burladingen, entstanden im Herbst<br />
1857. Vorsteher sind Joseph Mauz, Schreiner, Lehrer Joseph<br />
Winter und Provisor Karl Winter in Burladingen. Der Verein<br />
zählt 22 Mitglieder.<br />
7. Der Gesangverein in Grosselfingen, gegründet im Jahre<br />
1844. Vorsteher ist Lehrer Johann Nepomuk Lorch in Grosselfingen.<br />
Der Verein zählt 20 Mitglieder, besitzt keine<br />
Statuten und hat die Genehmigung nicht eingeholt.<br />
8. Der Gesangverein in Hausen. Dieser Verein wurde vor ca.<br />
10 Jahren ins Leben gerufen, zählt zur Zeit 20 Mitglieder und<br />
hat eine besondere Bestätigung nicht eingeholt. Vorsteher ist<br />
Lehrer Steimer.<br />
9. Der Gesangverein in Killer, welcher erst im letzten Frühjahre<br />
entstanden ist, bereits 17 Mitglieder zählt, eine Bestätigung<br />
aber bis jetzt nicht nachgesucht hat. Lehrer Kästle in<br />
Killer ist Vorsteher dieses Vereins.<br />
10. Der Gesangverein in Owingen, gegründet im Jahre 1846.<br />
Vorsteher dieses Vereins ist Provisor Adolph Beck in Owingen,<br />
er zählt 18 Mitglieder, besitzt aber weder Statuten noch<br />
eine obrigkeitliche Genehmigung.<br />
HOHENZOLLERISCHE HEIMAT<br />
hrsggbn. vom Hohenz. <strong>Geschichtsverein</strong>.<br />
Die Zeitschrift »Hohenzollerische Heimat«<br />
ist eine heimatkundliche Zeitschrift. Sie will<br />
besonders die Bevölkerung in Hohenzollern<br />
und der angrenzenden Landesteile mit der<br />
Geschichte ihrer Heimat vertraut machen. Sie<br />
bringt neben fachhistorischen auch populär<br />
gehaltene Beiträge.<br />
Bezugspreis: 8.00 DM jährlich.<br />
Konto der »Hohenzollerischen Heimat«:<br />
803843 Hohenz. Landesbank Sigmaringen<br />
(BLZ 65351050).<br />
Druck:<br />
M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co.,<br />
7480 Sigmaringen, Karlstraße 10.<br />
48<br />
Die Autoren dieser Nummer:<br />
Dr. Otto H. Becker<br />
Hedinger Straße 17<br />
7480 Sigmaringen<br />
Dr. Hans-Dieter Lehmann<br />
In der Ganswies 2<br />
7457 Zimmern-Bisingen<br />
Jürgen Schmidt, Oberforstrat<br />
Uberlinger Straße 1<br />
7798 Pfullendorf<br />
Karl Werner Steim<br />
Wegscheiderstraße 26<br />
7940 Riedlingen<br />
Otto Werner, Rektor<br />
Friedrich-List-Straße 55<br />
7450 Hechingen<br />
Dr. Herbert Rädle<br />
Veit-Jung-Straße 13 a<br />
8430 Neumarkt<br />
11. Der Gesangverein in Rangendingen, der im Jahre 1843<br />
entstanden, 20 Mitglieder zählt, eine Genehmigung jedoch<br />
nicht eingeholt hat. Vorsteher dieses Vereins ist Lehrer Gallus<br />
Strobel in Rangendingen.<br />
12. Der Gesangverein in Stetten b/H. Dieser Verein ist im<br />
Jahre 1843 entstanden, zählt 20 Mitglieder, besitzt Statuten<br />
vom Jahre 1843, welche jedoch nicht bestätigt sind. Vorsteher<br />
ist Joseph Klotz, Musikus in Stetten b. Hechingen.«<br />
Anmerkungen:<br />
1 Staatsarchiv Sigmaringen, Ho 13 Nr. 994<br />
2 Gegründet als »Singverein« von Hofmusikus und Vizekapellmeister<br />
Georg Wichtl, 1843 schlossen sich »Singverein« und die<br />
Blechmusik »Metall-Harmonie« zusammen und führten nun den<br />
Namen »Musikverein«.<br />
3 Der heutige Sängerbund führt sich auf den 1836 gegründeten<br />
»Singverein« zurück. - S. Festschrift »150 Jahre Sängerbund<br />
Hechingen 1836-1986«.<br />
4 Sigmund Lichtenstein war u.a. bis zu seinem Tod 40 Jahre (jüdischer)<br />
Vorsänger und Vorbeter in der Synagoge und dirigierte zehn<br />
Jahre den von ihm gegründeten Synagogenchor wie auch den aus<br />
Christen und Juden zusammengesetzten Sängerbund; er starb<br />
1874. - S.Manuel Werner: Die Juden in Hechingen als religiöse<br />
Gemeinde. In: Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte, 21<br />
(1985), S. 78-79.<br />
Trochtelfinger Geschichtsund<br />
Heimatverein gegründet<br />
Am 24. Februar <strong>1989</strong> gründeten Heimatfreunde in Trochtelfingen<br />
den Trochtelfinger Geschichts- und Heimatverein.<br />
Zum ersten Vorsitzenden wurde Hans Schoser gewählt,<br />
Schriftführer wurde Heinz Schmid.<br />
Der Verein stellt sich die Aufgabe, Freunde der Geschichte<br />
und Heimatkunde der Stadt Trochtelfingen zusammenzuschließen,<br />
um die Geschichte und Heimatkunde der Stadt<br />
Trochtelfingen/Hohenzollern, der ehemaligen Grafschaft<br />
Werdenberg-Heiligenberg-Trochtelfingen, des ehemaligen<br />
fürstenbergischen Oberamtes Trochtelfingen, des ehemaligen<br />
hohenzollerischen Oberamtes Trochtelfingen und des<br />
ehemaligen Landkapitels Trochtelfingen zu erforschen, zu<br />
fördern und zu verbreiten.<br />
Wir wünschen dem Verein Wachsen, Blühen und Gedeihen<br />
und hoffen, noch viel von ihm zu hören.<br />
Schriftleitung:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth,<br />
7487 Gammertingen Telefon 07574/4211<br />
Die mit Namen versehenen Artikel geben die<br />
persönliche Meinung der Verfasser wieder;<br />
diese zeichnen für den Inhalt der Beiträge<br />
verantwortlich. Mitteilungen der Schriftleitung<br />
sind als solche gekennzeichnet.<br />
Manuskripte und Besprechungsexemplare<br />
werden an die Adresse des Schriftleiters erbeten.<br />
Wir bitten unsere Leser, die »Hohenzollerische<br />
Heimat« weiter zu empfehlen.
HOHENZOLLERISCHE<br />
HEIMAT<br />
Haigerlocher Judenfriedhof November <strong>1989</strong> (Foto K.W. Steim)<br />
KARL WERNER STEIM<br />
Der Haigerlocher Judenfriedhof im Dritten Reich<br />
Im Weildorfer Stadtwald, nahe dem Gruoler Weinberg und<br />
dem Weg zum Kloster Kirchberg, wurde wohl im 16. Jahrhundert<br />
ein Friedhof für die jüdische Gemeinde Haigerloch<br />
angelegt. Es muß um die Mitte jenes Jahrhunderts gewesen<br />
sein, denn seit 1546 werden regelmäßig Juden in Haigerloch<br />
genannt , und von 1567 stammte nach einer Feststellung vom<br />
Jahre 1880 2 der damals älteste Grabstein im Weildorfer Wald.<br />
Und 1587 kommt der Friedhof selbst in den Akten 3 vor.<br />
Dieser Friedhof bestand als solcher runde 250 Jahre lang,<br />
dann erhielten die Juden vom Sigmaringer Fürsten im Jahre<br />
1802 die Erlaubnis, unterhalb ihrer Siedlung »Haag« einen<br />
neuen Begräbnisplatz anzulegen 4 . Der Fürst verkaufte den<br />
Herausgegeben vom<br />
M 3828 F<br />
HohenzoIIerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />
ISSN 0018-3253<br />
39. Jahrgang Nr. 4 / Dezember <strong>1989</strong><br />
Platz für 500 Gulden. Als Begründung hatten die Juden vor<br />
allem die weite Entfernung nach Weildorf angegeben. Und<br />
damit beginnt die Geschichte dieses neuen Friedhofs, um den<br />
es hier im wesentlichen geht.<br />
Baumaßnabmen im 19.120. Jahrhundert<br />
Nach einem ersten Anlauf im Jahre 1880 machten sich die<br />
Juden um 1900 wieder an die Erweiterung ihres zu klein<br />
gewordenen Friedhofs 5 . Als sich 1908 der Haigerlocher<br />
Oberamtmann erkundigte, wie weit die Erweiterung des<br />
israelitischen Friedhofs gediehen sei, erhielt er vom Bürgermeister<br />
die Auskunft, das Israelitische Vorsteheramt habe
seinen Auftrag auf Genehmigung der Friedhofs-Erweiterung<br />
zurückgezogen 6 . 1909 hat die israelitische Gemeinde den<br />
Straßengraben beim Eingang in ihren Friedhof mit Zementröhren<br />
überbrückt und im oberen Teil Platten über den<br />
Graben gelegt. Wegen dieser Platten kam es bei Regen zu<br />
einem ungenügenden Wasserablauf, weshalb die Stadt anordnete,<br />
die Platten zu entfernen und durch Zementröhren zu<br />
ersetzen. Das Israelitische Vorsteheramt sagte die Ausführung<br />
der Arbeiten zu 7 . Im Jahre 1911 schrieb das Vorsteheramt<br />
»Grab-, Maurer- und Erdbewegungsarbeiten für den<br />
Umbau des Friedhofes« im Betrage von zusammen 2400<br />
Mark öffentlich aus 8 .<br />
Städtischer Friedhof für die Juden ?<br />
Am 12. April 1929 befaßte sich das Gemeindekollegium in<br />
Haigerloch mit einem Gesuch der israelitischen Kultusgemeinde<br />
um Bewilligung einer Beihilfe zur Friedhofsinstandsetzung<br />
9 . Bürgermeister Leopold Bausinger erläuterte die<br />
Rechtslage, wonach der Friedhof der politischen Gemeinde<br />
auch für die Israeliten zur Verfügung stehe. In der Beratung<br />
kam dann zum Ausdruck, daß man erst die Kosten wissen<br />
wolle, ehe man über eine Beihilfe entscheide. Die beiden<br />
jündischen Gemeinderäte Hohenemser und Ullmann konnten<br />
auf Anhieb keine Kosten nennen, so daß man die israelitische<br />
Gemeinde aufforderte, »die Kosten im einzelnen nachzuweisen,<br />
zu denen die Beihilfe erbeten wird«. Es bestand<br />
also wohl im Gemeinderat keine Neigung, dem Vorschlag des<br />
Bürgermeisters nachzukommen, künftig auch die Juden auf<br />
dem städtischen Friedhof zu beerdigen. Vielleicht hatten sich<br />
auch die jüdischen Gemeinderäte dagegen ausgesprochen;<br />
aus dem Gemeinderatsprotokoll geht das leider nicht hervor.<br />
Am 31. Mai befaßte sich das Kollegium erneut mit dem<br />
Antrag der israelitischen Kultusgemeinde 10 . Nach längerer<br />
Beratung wurde einstimmig beschlossen, »der israelitischen<br />
Gemeinde zu den Unterhaltungskosten des israelitischen<br />
Friedhofes eine Beihilfe von 100 RM zu bewilligen«. Man<br />
stellte sogar einen weiteren Zuschuß in Aussicht: »wobei es<br />
der Kultusgemeinde unbenommen sein solle, im dringenden<br />
Bedarfsfalle wegen etwaiger Erhöhung dieses Betrages später<br />
heranzutreten«. Ein Jahr später beantragte die israelitische<br />
Kultusgemeinde wieder eine Beihilfe zur Friedhofinstandsetzung,<br />
wobei die Kosten auf 50 bis 75 RM geschätzt waren. Es<br />
wurde am 5. September 1930 »für den nachgesuchten Zweck<br />
eine einmalige Beihilfe von 50 RM« bewilligt 11 . Im Jahre 1932<br />
befaßte sich die Israelitische Gemeinde mit der Erweiterung<br />
des Friedhofes und wollte das benachbarte ehemalige Burkhartsche<br />
Grundstück dazu benützen 12 . Gemeinderat und<br />
Gemeindevertretung stimmten am 16. Juli 1932 mit der Auflage<br />
zu, »daß die Ausgestaltung der neuen Friedhofanlage<br />
nach ästhetischen, den Grundsätzen moderner Friedhofskunst<br />
entsprechenden Gesichtspunkten erfolgt«. Im selben<br />
Jahr genehmigten die Bürgerkollegien ein Gesuch der Israelitischen<br />
Gemeinde, »die baufällige dem Haagweg zugelegene<br />
Mauer des israelitischen Friedhofes mit Rücksicht auf die<br />
Wurzeln der unmittelbar innerhalb der Mauer stehenden<br />
Bäume dergestalt erneuern zu dürfen, daß die Mauer hinausgeschoben<br />
wird und mit etwa 30 cm ihrer Breite auf Gemeindeeigentum<br />
zu stehen kommt«. Eine Gebühr für den Platz<br />
wurde nicht erhoben 13 . Das sollte die letzte Baumaßnahme<br />
am jüdischen Friedhof werden.<br />
Der Friedhof im Dritten Reich<br />
Am 14. Dezember 1942 teilte die Jüdische Kultusvereinigung<br />
Württemberg e.V. (Zweigstelle Württemberg der Reichsvereinigung<br />
der Juden in Deutschland) in Stuttgart der Stadtverwaltung<br />
Haigerloch mit: »Der in dortiger Gemarkung liegende,<br />
infolge Eingliederung der dortigen Religionsgemeinde<br />
50<br />
Grab des Rabbiners Maier Hilb (Rabbiner von 1836 bis 1880)<br />
(Foto K.W.Steim).<br />
in die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, in deren<br />
Eigentum übergegangene jüdische Friedhof soll auf Weisung<br />
der Aufsichtsbehörde zum Verkauf gebracht werden. Wir<br />
bieten daher hiermit der Stadt Haigerloch den vorbezeichneten<br />
Friedhof zum Kauf an. Als Kaufpreis soll der angemessene<br />
Verkehrswert bezahlt werden...« 14 Die Stadt wurde um<br />
ein Angebot gebeten. Haigerlochs Bürgermeister Rein zeigte<br />
sich am Erwerb der drei Parzellen (Nr. 232 mit 23,08 Ar<br />
Friedhof, Nr. 230 mit 1,85 Ar Weg und Nr. 225 mit 17,02 Ar<br />
Abhang) zwar interessiert, schrieb aber, das Gelände sei<br />
»Ödland an einem stark abfallenden Hang, das für eine<br />
Bebauung oder landwirtschaftliche Nutzung nicht gebraucht<br />
werden kann. Der angemessene Preis für derartiges Gelände<br />
ist RM 8.- pro ar oder für die Gesamtfläche 41,95 x 8 - RM:<br />
335,60«.<br />
Inzwischen lag der Jüdischen Kultusvereinigung in Stuttgart<br />
ein Angebot einer Haigerlocher Bürgerin für die Parzelle 225<br />
(Wiese) vor. Sie fragte daher bei der Stadt an, ob sie etwas<br />
gegen den Verkauf habe oder ob sie alle drei Parzellen kaufen<br />
wolle. Bürgermeister Rein antwortete, für die Parzelle 225<br />
hätten sich noch weitere Liebhaber gemeldet, er halte es<br />
deshalb für besser, diese Parzelle an die Gemeinde zu verkaufen,<br />
die sie dann weiter veräußern könne. Die Kultusvereinigung,<br />
der für Parzelle 225 ein Angebot über 350 bis 400 RM<br />
vorlag, wollte gern an Privat verkaufen, zumal der Preis höher<br />
lag als der, den die Stadt für alle drei Parzellen geboten hatte.<br />
Bürgermeister Rein wehrte sich gegen den Verkauf einer<br />
einzelnen Parzelle an Private, »weil von der Gemeinde beabsichtigt<br />
ist, das Gesamtareal für gemeinnützige Zwecke zum<br />
angemessenen Verkehrswert zu erwerben«. In einem weiteren<br />
Schreiben bemerkte Bürgermeister Rein weiter, »daß bei<br />
der Preisfestsetzung der angemessene Verkehrswert dann<br />
durch den Bürgermeister als Vorstand des Schätzungsamtes<br />
festgestellt und vorgeschlagen wird. Bei der Preisermittlung<br />
ist es und insbesondere in heutiger Zeit belanglos, ob bereits
Angebote mit abweichenden Preisen vorliegen. Maßgebend<br />
ist in erster Linie die Schätzung des Schätzungsamtes« 15 .<br />
Die Jüdische Kultusvereinigung ging nun auf das Angebot<br />
der Stadt ein und legte den Vertrag dem Reichssicherheitshauptamt<br />
in Berlin zur Genehmigung vor. Im Februar 1943<br />
kam die Genehmigung. Zur Fertigung des Kaufvertrags kam<br />
der jüdische Konsulent Dr. Ernst Israel Moos aus Ulm nach<br />
Haigerloch. Es blieb bei dem vom Bürgermeister vorgeschlagenen<br />
Kaufpreis von 335,60 RM. Der Kaufvertrag wurde am<br />
16. März 1943 vor dem Amtsgericht Haigerloch abgeschlossen.<br />
Der Hechinger Landrat Schraermeyer genehmigte am<br />
13. Mai 1943 den Vertrag. Der Kaufpreis wurde am 27. Mai<br />
1943 an die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland<br />
(Berlin) überwiesen 16 .<br />
In seinem Schreiben vom 29. April 1943 an den Landrat in<br />
Hechingen gab Bürgermeister Rein bekannt, was er mit dem<br />
Friedhofsgelände machen wollte: »Die Grundstücke werden<br />
zur Schaffung einer besseren Zufahrt zum Stadtteil Haag<br />
benötigt. Die heutige steile Auffahrt mit unübersichtlicher<br />
Einmündung in die Landstraße I. Ordnung Haigerloch -<br />
Balingen kann auf die Dauer nicht belassen werden. Zur<br />
gegebenen Zeit soll daher ein neuer Zufahrtsweg mit Serpentine<br />
in normaler Steigung über die gekauften Grundstücke<br />
gelegt werden. In entgegengesetzter Richtung ist die Anlage<br />
einer neuen Straße zum Haag durch die ehemalige Kreisgarage,<br />
dem Zöhrlaut'schen Mühlkanal und Eisweiher unmöglich« 17 .<br />
Am 1. November 1943 - in Haigerloch gab es inzwischen<br />
keine Juden mehr - wandte sich das »Reichsinstitut für<br />
Geschichte des neuen Deutschlands« an das Staatsarchiv<br />
Sigmaringen und teilte mit, man sei dabei, »die Grabinschriften<br />
der Judenfriedhöfe im deutschen Reichsgebiet aufnehmen<br />
zu lassen. Diese Grabinschriften bilden für die Zeit vor<br />
Einführung der Personenstandsregister und der teilweise<br />
schon früher angelegten Personenlisten die einzige Quelle für<br />
die genealogische Erforschung des Judentums und seiner<br />
Verbreitung im deutschen Volkskörper. Die Sicherstellung<br />
dieses Quellenmaterials geschieht am zweckmäßigsten in der<br />
Weise, daß die Inschriften fotografisch aufgenommen werden.<br />
Die Aufnahme muß so ausgeführt werden, daß später<br />
eine hebraistisch geschulte Fachkraft den Inhalt der Inschrift<br />
aus ihr entziffern und in ein dafür geschaffenes Formblatt<br />
übertragen kann. Eine Kartei dieser Formblätter soll dann<br />
also gleichsam die für die Juden nicht vorhandenen Kirchenbücher<br />
ersetzen. Diese Bestandsaufnahme muß jetzt durchgeführt<br />
werden, da der Weiterbestand der Judenfriedhöfe<br />
fraglich ist, der Erhaltungszustand der Grabmäler aber immer<br />
schlechter wird. Es ist jedoch nicht zweckmäßig, diese Arbeit<br />
ohne wissenschaftliche Anleitung an Ort und Stelle vornehmen<br />
zu lassen. Die Kriegsverhältnisse machen es uns unmöglich,<br />
solche Anweisungen jeweils selbst zu geben. Außerdem<br />
erachten wir es als dem wissenschaftlichen Zweck dienlicher,<br />
ortskundige und der örtlichen Forschung verpflichtende<br />
Kräfte zu dieser Arbeit heranzuziehen...« 18<br />
Das Staatsarchiv Sigmaringen machte das Reichsinstitut darauf<br />
aufmerksam, daß die Genealogie der Juden wohl leichter<br />
über deren Geburts-, Heirats-, Sterbe- und Familienregister<br />
erforscht werden könne als über die Grabsteine. Die Register<br />
seien an das Reichssippenamt abgegeben worden 19 . Das<br />
Reichsinstitut bedankte sich zwar für diesen Hinweis, da es<br />
davon nichts gewußt hatte, bestand aber auf der fotografischen<br />
Dokumentation.<br />
Das Reichsinstitut forderte die Stadt Haigerloch im November<br />
1943 - über das Staatsarchiv - auf, »daß die Grabsteine bis<br />
nach Beendigung der Bestandsaufnahme in ihrem gegenwärtigen<br />
Zustand unbedingt erhalten bleiben müssen«. Am<br />
16. November 1943 kam dann der Staatsarchivinspektor<br />
Schaffner nach Haigerloch und unterzog die beiden Judenfriedhöfe<br />
einer eingehenden Besichtigung. Darüber schrieb er<br />
dem Reichsinstitut: »Der Friedhof im Wald bei Weildorf ist<br />
in seiner Anlage und Abgrenzung noch zu erkennen. Zerstörungen<br />
und die Wegnahme von Steinen haben stattgefunden.<br />
Vorhanden sind noch 13 Steine, die zum Teil liegen, zum Teil<br />
stehen und alle nur hebräisch beschriftet sind. Außerdem<br />
habe ich zwei Steinstümpfe festgestellt, die nur kurz über den<br />
MARIA LEIBOLD<br />
A glückselegs Nuis Johr<br />
A Johr goht a im duifta Wenter,<br />
füar Alt und Jung und au füar Kender.<br />
Zwölf Monet drehet sich im Reiga,<br />
dr Janner duat sich eiseg zoiga.<br />
Dr Feber hot im Narrasäckle,<br />
vill bunte, närrsche Fasnetsfräckle.<br />
Im Meeza goht noch 's Bäurle wacker,<br />
mit seina Gäule uff da Acker.<br />
April bringt Reaga und a Schnaila,<br />
en Pfludder und a Waataweile.<br />
Im Moia duat se 's Heaz erfraia,<br />
en Juusger lau und Schroi nauskeia.<br />
'S ganz Dal ischt grea und d'Luft ischt glinder,<br />
's ischt Juni, hollet Schträuß ihr Kender.<br />
Dees ischt a gmachets Heibetweatter,<br />
so sait im Juli d'Bas zom Vetter.<br />
Wia kaa mes im Auguscht suscht wella,<br />
ma hairt noitz als noh hü und schnella.<br />
Dia Schwaiba ziahet und 's geit Nussa,<br />
dr Luft hots em September hussa.<br />
En guata Wei bringt dr Oktober,<br />
dr Kear ischt gfüllt und au dr Schober.<br />
Und em November do duats gfriara,<br />
dees ischt a Weatter zom sinniara.<br />
Dezember isch's dr Wald duat schweiga,<br />
ma duat sich voar dr Schtille neiga.<br />
Ma goht uff deara Johresloiter<br />
ällaweil en Schbrissel weiter.<br />
Dia Johr vrgauet und miar wandre<br />
zu oim Johr naus, und nei es andre.<br />
Erdboden herausragen, an ihrem oberen Ende aber einen<br />
Bogen zeigen, so daß zu vermuten ist, daß dies alte Steine<br />
sind, die nur tiefer im Erdreich stecken, möglicherweise<br />
hineingehauen sind. Da der Boden gefroren war, konnte ich<br />
nähere Untersuchungen an diesen beiden Steinen nicht<br />
anstellen. Von diesen 13 Steinen ist einer offensichtlich<br />
jüngeren Datums und stammt wahrscheinlich von dem Juden<br />
Isaias Zivi, der zuletzt 1884 hier beerdigt wurde.<br />
51
Der Judenfriedhof im Haag von Haigerloch ist in seiner<br />
Anlage im ursprünglichen Zustand gut erhalten. Es sind<br />
lediglich einige Grabsteine neueren Datums umgeworfen und<br />
demoliert. An den alten Steinen ist bisher nichts geschehen.<br />
Der Friedhof steht unter der besonderen Obhut der Stadt und<br />
es ist, wie mir der Bürgermeister selbst erklärte, vorläufig<br />
nicht beabsichtigt, an seiner Anlage irgend etwas zu ändern.<br />
Aus der Zeit vor 1874 habe ich 329 Steine festgestellt, d.h. es<br />
sind 329 Aufnahmen von Steinen notwendig, einschließlich<br />
derjenigen, die doppelseitig beschrieben sind, was etwa bei 50<br />
Steinen der Fall ist. Bis in welche Zeit die Steine zurückreichen,<br />
kann ich nicht genau angeben, da die zweifellos ältesten<br />
Steine keinerlei deutsche Beschriftung haben. Einige Steine<br />
sind stark verwittert« 20 .<br />
Im Dezember 1943 erklärte sich das Reichsinstitut damit<br />
einverstanden, daß die Herstellung der Aufnahmen der Witterungsverhältnisse<br />
wegen auf das Frühjahr 1944 verschoben<br />
wurden und übersandte eine Bescheinigung für die Fotografenfirma<br />
über die dienstliche Notwendigkeit der Aufnahmen.<br />
Im April 1944 vertröstete Fotografenmeister Karl Keidel aus<br />
Hechingen (der Haigerlocher Fotograf Paul Weber befand<br />
sich im Krieg) das Sigmaringer Staatsarchiv auf Mai, da er zur<br />
Zeit noch andere Aufträge abzuwickeln habe. Am 10. Juni<br />
übersandte er schließlich seine Abzüge im Format 9 x 12 cm<br />
und erwähnte, es habe sich um eine schwierige Aufgabe<br />
gehandelt, da die meisten Gräber stark vermoost gewesen<br />
seien und er sie erst abgebürstet und das Gestrüpp mit einer<br />
Schere entfernt habe. Außerdem sei er bei der Gestapo wegen<br />
»verdächtigen Treibens« auf dem Hechinger Judenfriedhof<br />
angezeigt worden.<br />
Die Aufnahmen wurden an das Reichsinstitut in Berlin<br />
weitergeleitet. Damit endet die Geschichte der Judenfriedhöfe<br />
Haigerlochs im Dritten Reich. Heute könnten die<br />
Aufnahmen - falls sie doch noch ermittelt werden, wie z.B.<br />
nach langer Suche die Familienregister der jüdischen<br />
Gemeinde, die sich jetzt in einem Staatsarchiv der DDR<br />
befinden, nachdem sie ursprünglich in Rußland waren - uns<br />
wertvolle Dienste leisten.<br />
JÜRGEN SCHMIDT<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Staatsarchiv Sigmaringen, Dep. Fürstl. Hohenz. Haus- und<br />
Domänenarchiv (FAS), Rentamtsrechnungen Haigerloch<br />
2<br />
Schwarzwälder Bote Nr. 175 vom 31.7. 1980 und Hohenz. Blätter<br />
Nr. 116 v. 3.8. 1880 (Zitat aus der Allgemeinen Zeitung des<br />
Judentums). S. auch: Gustav Spier: Der alte jüdische Waldfriedhof<br />
bei Haigerloch, in: Gemeindezeitung für die israelitischen<br />
Gemeinden Württembergs 6 (1929) S. 70<br />
3<br />
S. Anm. 1<br />
4<br />
S. Anm. 1 und Staatsarchiv Sigmaringen, Ho 202 Pr OA Nr. 2204<br />
5<br />
Staatsarchiv Sigmaringen, Ho 202 Pr OA Nr. 2204<br />
6<br />
Stadtarchiv Haigerloch, Akten, Nr. 688<br />
7<br />
S. Anm. 6<br />
8<br />
Haigerlocher Bote Nr. 47 v. 28.3. 1911<br />
9<br />
Stadtarchiv Haigerloch, Gemeinderatsprotokoll vom 12.4. 1929,<br />
§24<br />
10<br />
dto. vom 31.5. 1929, §35<br />
11<br />
dto. vom 5.9. 1930, §187<br />
12<br />
dto. vom 16.7. 1932, §354<br />
13<br />
dto. vom 9.9. 1932, §366<br />
14<br />
Stadtarchiv Haigerloch, Akten, Nr.572. S. auch: Gemeinderatsprotokoll<br />
vom 19.1. 1943, §306<br />
15<br />
S. Anm. 14<br />
16<br />
S. Anm. 14. - S. auch Gemeinderatsprotokoll vom 18.5. 1943,<br />
§324<br />
17<br />
S. Anm. 14<br />
18<br />
S. Anm. 14 und Staatsarchiv Sigmaringen, Ho 337 Fasz. 76<br />
19<br />
Stadtarchiv Haigerloch, Akten, Nr. 699<br />
20<br />
Staatsarchiv Sigmaringen, Ho 337 Fasz. 76<br />
Literatur<br />
Franz Xaver Hodler: Geschichte des Oberamts Haigerloch. Hechingen<br />
1928<br />
Willi Schäfer: Geschichte und Schicksal der Juden in Haigerloch.<br />
Zulassungsarbeit zur II. Reallehrerprüfung. Reutlingen 1971 (maschinenschriftlich)<br />
Gustav Spier: Der alte jüdische Waldfriedhof bei Haigerloch,' in:<br />
Gemeindezeitung für die israelitischen Gemeinden Württembergs<br />
6 (1929) S. 70<br />
Karl Werner Steim: Juden in Haigerloch. Photos von Paul Weber.<br />
Haigerloch (1987)<br />
Karl Werner Steim: Die Synagoge in Haigerloch. Haigerloch 1988<br />
Der Wald Weithart aus forstwissenschaftlicher Sicht, gestern und heute (Schluß)<br />
Die Waldwirtschaft zwischen 1740 und 1833/54<br />
Von dem traurigen Zustand des Weithart erfahren wir im<br />
Teilungsvertrag von 1740 eingangs: »In diesem Wald sei kein<br />
rechter Stumpen Bauholz mehr vorhanden, dagegen verschiedene<br />
verwüstete Plätze von einem und mehr Jauchert ohne<br />
eigenen Aufwuchs. Wenn keine Mittel vorgehalten wären,<br />
wäre die gesamte Abtreibung des Waldes in wenigen Jahren<br />
zu besorgen.«<br />
Man stellte also ernsthafte Überlegungen an, den Wald<br />
abzuholzen und in landwirtschaftliche Nutzung zu überführen.<br />
Der damalige Baumbestand setzte sich aus einem lockeren<br />
Schirm aus Fichten, Eichen, Forlen, Aspen, Birken und<br />
Erlen zusammen.<br />
Die Waldordnung, die im Zusammenhang mit der Aufteilung<br />
des Waldes erging, enthielt zwar einige waldschonende<br />
52<br />
Bestimmungen, (z.B. das Verbot der Ausstockung über<br />
Gebühr) und verhinderte das Schlimmste. Jedoch wurde dem<br />
Weithart auch in den nächsten hundert Jahren noch übel<br />
mitgespielt. Bis ins 19.Jahrhundert hinein herrschte der<br />
sogenannte regellose Femelbetrieb vor, d.h. man schlug die<br />
jeweils stärksten Bäume heraus und plünderte den Wald<br />
(Plünderwald = Plenterwald) regelrecht. Es wurden große<br />
Holzmengen entnommen, ohne den H°l zz u w achs zu kennen.<br />
Daneben war der Weithart noch dem ungehinderten<br />
Weidebetrieb unterworfen, der von Georgi (23. April) bis<br />
zum Katharinentag (25. November) dauerte. Wie schlecht der<br />
Wald Anfang des 19. Jahrhunderts aussah, geht aus verschiedenen<br />
Berichten hervor, so 1820 über den Mengener Weithart,<br />
1844 über den Gemeindewald Krauchenwies und 1858<br />
über den Pfullendorfer Weithart.
Die Waldwirtschaft zwischen 1833/54 und heute<br />
Zur Änderung des beschriebenen Zustandes waren drei<br />
wesentliche Ereignisse Voraussetzung:<br />
1. Einstellung der Waldweide. Sie erfolgte 1827 in Mengen<br />
und in den beiden folgenden Jahrzehnten auch in den<br />
anderen Weithartgemeinden.<br />
2. Erneute Vermessung des Waldes. Sie wurde 1843 für den<br />
Bereich der Sigmaringischen Herrschaft und 1844/45 für<br />
den Mengener Weithart durchgeführt.<br />
3. Aufstellung von sogenannten Forsteinrichtungswerken.<br />
Dies erfolgte aufgrund forstgesetzlicher Regelungen für<br />
die Weithartwaldungen zwischen 1833 und 1858. Dabei<br />
wurde die Höhe der Holznutzung nach eingehender<br />
Zustandserfassung aufgrund von Zuwachs und Altersaufbau<br />
des Waldes festgesetzt.<br />
Vergleichende Daten zeigen folgendes:<br />
Der durchschnittliche Holzvorrat betrug Mitte 19. Jahrhundert<br />
280 m 3 Holz pro Hektar. Heute sind es 418 m 3 pro<br />
Hektar.<br />
Die Nutzungsmöglichkeiten lagen vor 150 Jahren bei ca. 2,5<br />
fm pro Jahr und Hektar. Heute sieht der Nutzungsplan für<br />
den gesamten Weithart einen Einschlag von 8,6 fm pro Jahr<br />
und Hektar vor.<br />
Die regellosen Plünderungen hörten ab Mitte des ^.Jahrhunderts<br />
auf und die Waldwirtschaft ging auf die Betriebsform<br />
des schlagweisen Hochwaldes mit flächigen Kahlhieben<br />
über.<br />
Die holzlosen Platten wurden vorwiegend mit Fichte, zum<br />
Teil durch Saat, überwiegend jedoch durch Pflanzung wieder<br />
gezielt aufgeforstet. Zur Deckung des Pflanzenbedarfs legte<br />
man Pflanzschulen an. Uberhaupt setzte man in die Fichte<br />
sehr große Erwartungen, wie Berichte aus den Forsteinrichtungswerken<br />
1858 des Pfullendorfer Weithart und 1885 des<br />
Gemeindewaldes Hausen a.A. beweisen.<br />
Die sogenannte Umtriebszeit, also die Zeit zwischen Begründung<br />
der Kultur und Nutzung des Altbestandes, wurde<br />
zwischen 70 und 100 Jahren festgelegt. Dabei wählten die<br />
badischen Gemeinden Pfullendorf und Schwäbiishausen<br />
höhere Umtriebszeiten (90 bis 100 Jahre) als die württembergischen<br />
Gemeinden Mottschieß, Mengen und Hausen (70<br />
Jahre). Heute liegt die Umtriebszeit der Weithartwaldungen<br />
durchweg bei ca. 120 Jahren.<br />
Zwischen 1845 und 1900 wurde die Waldwirtschaft weiter<br />
ausgebaut. Das Pflanzschulwesen erfuhr eine Erweiterung.<br />
Z.T. gewann man Fichtensamen selbst. Man war zwischenzeitlich<br />
zur reinen Fichtennachzucht übergegangen. Seit 1890<br />
kamen auch ausländische Holzarten zum Anbau (verschiedene<br />
Kiefernarten, Douglasie und Lärche).<br />
Höhepunkt der Fichtenwirtschaft war die Zeit zwischen 1915<br />
und 1927. Man strebte damals den reinen Fichtenbestand als<br />
Betriebsziel an. Vorherrschende Betriebsform war der Großkahlschlag<br />
mit nachfolgender Pflanzung, z.T. mit landwirtschaftlicher<br />
Zwischennutzung. Wie groß die Kahlschläge<br />
damals waren, zeigte sich aus einer Beschreibung von 1905.<br />
Damals fanden sich im Mengener Revier Weithart 45 ha<br />
Waldfläche ohne Baumbestockung.<br />
Ab 1930 setzte sich die Erkenntnis durch, daß die reine<br />
Fichtenwirtschaft neben ökonomischen Vorteilen auch<br />
enorme Nachteile heraufbeschwor. Schäden durch Sturm,<br />
Schnee, Insekten, Pilze und der Rückgang der Bodenkraft<br />
waren zwangläufige Folgewirkungen. Man kehrte der Großkahlschlagswirtschaft<br />
den Rücken und verjüngte fortan auf<br />
kleinerer Fläche unter Verwendung von Laubbäumen. Dies<br />
erfolgte vor allem im Mengener Weithart.<br />
Allerdings bereitete der 2. Weltkrieg mit all seinen Folgen<br />
diesem Umdenkungsprozeß einen herben Rückschlag.<br />
Bedingt durch mehrere trockene Jahre ab 1944 und die<br />
kriegsbedingte Abwesenheit des meisten Forstpersonals,<br />
konnte sich der Buchdrucker, eine Borkenkäferart, stark<br />
vermehren. In den Jahren 1945 bis 1949 fielen allein in den<br />
Mengener und Pfullendorfer Weithartwaldungen rund<br />
19000 fm Käferholz an. In Verbindung mit dem Käfer<br />
erhöhte sich von 1945 bis 1949 auch der Anfall an Sturmholz.<br />
Dazu traten riesige Holzmengen, die als Reparationsleistungen,<br />
vor allem an Frankreich, abgegeben werden mußten.<br />
Nun hatte man wieder Großkahlflächen und mußte notgedrungen<br />
die Fichte verwenden. Frost und Mäuse machten<br />
dem spärlich eingebrachten Laubholz schnell den Garaus. Es<br />
muß rückblickend als großartige Leistung der damaligen<br />
Förstergeneration bezeichnet werden, daß diese riesigen<br />
Kahlflächen wieder in Bestockung gebracht wurden.<br />
Kaum hatte sich der Wald wieder etwas erholt, kam die<br />
nächste Katastrophe. Die Stürme der Jahre 1965 bis 1967<br />
warfen im Weithart zigtausend Festmeter Holz auf den<br />
Boden und wieder galt es aufzuforsten. Die vielen Naturereignisse,<br />
die in den letzten hundert Jahren über den Weithart<br />
hereingebrochen sind, spiegeln sich sehr gut im Altersklassenaufbau<br />
des Waldes wieder. Dieser zeigt einen sehr starken<br />
Flächenüberhang an Beständen der II. Altersklasse<br />
(21-40jährig). Dies sind u.a. die Kahlflächenaufforstungen<br />
der Nachkriegs- und der Sturmjahre. Weiterhin sehen wir<br />
einen Überhang an Beständen der IV Altersklasse (61-80jährig).<br />
Er ist auf die Großkahlschläge und starken Übernutzungen<br />
um 1900 zurückzuführen.<br />
Zusammenfassend stellen wir fest:<br />
Im Weithart war die Fichte schon im 16. Jahrhundert dominierende<br />
Baumart. Der Mensch hat ihren Anteil seither bis<br />
heute weiter erhöht. Hierbei wächst auf dem Großteil der<br />
Fläche bereits die 5. Fichtengeneration. Diese mehr als<br />
400jährige Fichtenwirtschaft hat viele Nachteile gebracht:<br />
Schäden durch Sturm, Schnee, Insekten und eine Verschlechterung<br />
der Bodenqualität.<br />
Dies zeigt sich u.a. in relativ schlechten Humusformen<br />
(Moder bis Rohhumus), sowie einer Bodenvegetation, die<br />
Säure und Nährstoffarmut anzeigt.<br />
Die künftige Waldwirtschaft im Weithart<br />
Durch die über 400jährige Fichtenwirtschaft haben wir uns<br />
im Weithart von der natürlichen Waldgesellschaft - dem<br />
submontanen Buchen-/Eichenwald - weit entfernt. In<br />
Zukunft muß ein verstärktes Augenmerk auf die Wiedereinbringung<br />
der Laubbäume gelegt werden. Auf die Fichte wird<br />
jedoch nicht völlig verzichtet. Wichtig ist, auf geeigneten<br />
Böden Mischbestände aus Laubbäumen und Fichten zu<br />
begründen.<br />
Die künftigen Schwerpunkte der Waldwirtschaft im Weithart<br />
sind<br />
1. Anbau von Stieleichen auf vernässenden, lehmig-tonigen<br />
Böden<br />
2. Einbringung von Rotbuchen bereits in den Fichtenaltbestand<br />
3. Regulierung der Schalenwildbestände, um den Erhalt verbißgefährdeter<br />
Laubbäume zu sichern.<br />
4. Intensive Pflege der Jungbestände, um die Laubbäume<br />
auch über das kritische Dickungsstadium hinweg zu erhalten<br />
und Bestandstabilität durch Erziehung großkroniger<br />
Bäume zu erreichen.<br />
5. Dosierte Kalk-Magnesiumdüngung auf stark verarmten<br />
Standorten.<br />
53
KARL-HEINZ LUTZ<br />
Vor 175 Jahren: ein Hechinger in den Befreiungskriegen -<br />
Anton Mathias Bechtold v. Ehrenschwerdt<br />
Während der Arbeit zu meiner Dissertation, in deren<br />
Rahmen auch die soziale Zusammensetzung des badischen<br />
Offizierkorps untersucht wird, stieß ich auf den Oberstleutnant<br />
Anton Mathias Bechtold v. Ehrenschwerdt. Nachforschungen<br />
ergaben, daß dieser Offizier als Sohn des Bürgers<br />
Bernhard Bechtold, seit 1770 Offizier im fürstlich hohenzollerisch-hechingenschen<br />
Kontingent, am 20. September 1781<br />
in Hechingen geboren wurde 1 . Eine Kurzbiographie dieser<br />
Persönlichkeit erscheint mir deshalb sinnvoll, weil Offiziere<br />
dieser Garge im allgemeinen weder in den biographischen<br />
Nachschlagewerken für ganz Deutschland 2 , noch in den<br />
regional begrenzten Kompendien, wie zum Beispiel den<br />
»Badischen Biographien«, Aufnahme fanden; auch das<br />
umfangreich angelegte Werk »Index Bio-Bibliographicus<br />
notorum Hominum«, das von Jean-Pierre Lobies herausgegeben<br />
wird, läßt jeden Hinweis vermissen. Zudem sind beide<br />
Zweige dieser Familie bereits seit Jahrzehnten ausgestorben,<br />
so daß sie zunehmend der Vergessenheit anheim gefallen sein<br />
wird, obwohl gerade in den 1980er Jahren einige Jahrestage<br />
zu feiern gewesen wären. Diese Miszelle will sich deshalb in<br />
erster Linie als Ergänzung und Anregung für die Regionalgeschichtsforschung<br />
verstanden wissen.<br />
Bernhard Bechtold hatte mit seiner Ehefrau Franziska Wilhelmine,<br />
geb. Siegling, zwei Söhne: Anton Mathias und<br />
Joseph Friedrich (* Hechingen 26.2. 1783, | Erfurt 2.7.<br />
1846). Beide ergriffen den Beruf des Vaters, avancierten,<br />
jedoch in verschiedenen Armeen, zum Oberstleutnant und<br />
wurden in den hohenzollerisch-hechingenschen Adelsstand<br />
erhoben; der Erstgeborene als königlich westfälischer Hauptmann<br />
der Leibjägergarde im Frühjahr 1810, der jüngere drei<br />
Jahre später; sie führten fortan den Zusatz »von Ehrenschwerdt«.<br />
Im Jahre der Standeserhöhung trat Anton Mathias von<br />
westfälischen in badische Dienste über und nahm hier als<br />
Stabsoffizier an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teil 3 .<br />
1813 wurde er zum Kommandeur des 3. badischen Landwehr-Bataillons<br />
ernannt und hatte im Zusammenwirken mit<br />
dem »Direktorium des Wiesenkreises«, einer dem Innenministerium<br />
nachgeordneten Dienststelle, in deren Zuständigkeitsbereich<br />
(Raum Lörrach und Schopfheim) seinen künftigen<br />
Verband aufzustellen, der schließlich ein Offizierkorps<br />
von 20 Soldaten umfaßte 4 . Neben der Aufstellung einer<br />
Landwehr, die für Baden ein Novum darstellte 5 , wurde auch<br />
die Formation des Landsturmes vorangetrieben, für den<br />
allein in Baden 9 Brigaden mit insgesamt 3142 Offizieren,<br />
14 790 Unteroffizieren, 460 Spielleuten und 167536 Soldaten<br />
vorgesehen waren 6 .<br />
Im September 1814 wurde er als überzähliger Major beim<br />
badischen Regiment Nr. 3 »Großherzog« geführt 7 . Die etatmäßigen<br />
Majore waren Alexander Wilhelm Carl v. Kalenberg,<br />
der 1809 aus preußischen Diensten nach Baden gekommen<br />
war, Benedikt Pankratius Kühn, 1807 aus kurmainzischen<br />
und salmschen Diensten übernommen, und Bernhard<br />
Heusch, welcher der einzige Badener in diesem Gespann<br />
war 8 . Zum damaligen Zeitpunkt war die Zusammensetzung<br />
des Offizierkorps aus Soldaten aller möglichen deutschen<br />
Länder typisch für das junge Großherzogtum Baden. Der<br />
Verband, dem Bechthold v. Ehrenschwerdt jetzt angehörte,<br />
wurde von Oberst v. Brandt geführt und hatte sich im<br />
Rahmen des VIII. deutschen Korps, dem die Belagerung der<br />
französisch besetzten Festungen Straßburg, Landau und<br />
54<br />
Pfalzburg aufgetragen war, von Januar bis Mai 1814 erfolgreich<br />
gegen Straßburg behauptet und so zum Sieg gegen<br />
Napoleon mit beigetragen 9 . Als nach dessen Rückkehr von<br />
der Insel Elba 1815 ein neuer Krieg ausbrach, beteiligte sich<br />
das badische Armeekorps erneut an den Kämpfen, nun mit<br />
etwa 18000 Mann. Diesmal zählte das Regiment, dem der<br />
Hechinger angehörte, zum zweiten deutschen Armeekorps,<br />
an dessen Spitze der Fürst von Hohenzollern stand, und<br />
wurde erneut zur Belagerung von Straßburg eingesetzt; das<br />
größte Gefecht, das dabei zu bestehen war, galt der Vereitelung<br />
des französischen Ausbruchversuchs vom 9. Juli 1815,<br />
der den Badenern einen Verlust von 9 Offizieren und 160<br />
Mann beibrachte 10 .<br />
Nachdem Napoleon nach der Niederlage von Belle-Alliance/<br />
Waterloo vom 18.6. 1815 endgültig von der europäischen<br />
Bühne hatte abtreten müssen und der badischen Armee bis zu<br />
den Revolutionsjahren 1848/49 eine mehr als dreißigjährige<br />
Friedenszeit beschieden war, heiratete Mathias Anton, der<br />
neuen Standeseigenschaft wohl bewußt, 1816 in Kandern<br />
Luise Karoline Friederike v. Stetten-Buchenbach, die einem<br />
weitverzweigten Geschlecht angehörte 11 . Aus dieser konfessionellen<br />
Mischehe - die Frau war protestantisch - ging<br />
lediglich ein Sohn hervor - Karl Friedrich Anton. Er trat in<br />
badische Zivildienste und verstarb, ledig geblieben, 1875 in<br />
Karlsruhe als Kammerjunker und Sekretär beim Oberhof-<br />
Gericht in Mannheim 12 , so daß mit ihm dieser Familienzweig<br />
erlosch.<br />
Joseph Friedrich Bechtold v. Ehrenschwerdt verdingte sich in<br />
preußischen Militärdiensten beim Infanterie-Regiment<br />
Nr. 31. Bei seinem Tode 1846 in Erfurt hinterließ er drei<br />
Söhne, von denen der älteste in Preußen die Beamtenlaufbahn<br />
einschlug und die beiden jüngeren wie ihr Vater den Offizierberuf<br />
erwählten. Da nur der älteste heiratete, seine Ehe jedoch<br />
kinderlos blieb, erlosch auch dieser Zweig bereits zu Anfang<br />
unseres Jahrhunderts.<br />
Es wäre nun unter anderem zu klären, aufgrund welcher<br />
Verdienste die oben genannten Brüder in den Adelsstand<br />
erhoben wurden, weshalb sie trotz der Nobilitierung ihre<br />
Heimat Hechingen verlassen hatten und ob sie noch nachhaltige<br />
Beziehungen zu ihr aufrechterhalten hatten. Eine solche<br />
Untersuchung müßte wohl in einen Beitrag zur Sozialgeschichte<br />
des hohenzollerischen Adels eingebettet werden.<br />
Interessant wäre aber auch die Herausarbeitung des Anteils<br />
anderer Hechinger bzw. Hohenzollern am Befreiungskrieg,<br />
sofern ein solcher überhaupt vorlag.<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
Vgl. Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Briefadeligen<br />
Häuser, Jg. 1911, S. 40f. und 1929, S. 35f.; es handelte sich um ein<br />
katholisches Geschlecht. Ein Porträt des Offiziers ist leider weder<br />
im GLA Karlsruhe noch im Weltgeschichtlichen Museum in<br />
Rastatt vorhanden. Die Schreibung des Namens variiert in den<br />
Quellen; neben »Bechtold« findet sich auch »Bechthold«, ebenso<br />
existierte auch die Schreibweise »Ehrenschwert«.<br />
2<br />
Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie und Neue Deutsche Biographie.<br />
3<br />
Zur Geschichte Hohenzollerns unter Napoleon vgl. Fritz Kallenberg,<br />
»Die Fürstentümer Hohenzollern im Zeitalter der Französischen<br />
Revolution und Napoleons«, S. 358-472 in: Zeitschrift zur<br />
Geschichte des Oberrheins (»ZGO«) 111. Bd. (N.F. 72) 1963 und<br />
jetzt auch Paul Sauer, Napoleons Adler über Württemberg, Baden<br />
und Hohenzollern. Süddeutschland in der Rheinbundzeit; Stutt-
gart, Berlin, Köln, Mainz 1987. Vgl. auch, freilich weniger wissenschaftlich,<br />
aber gute Stimmungsberichte enthaltend: Die Württemberger<br />
in den Freiheitskriegen. Herausgegeben vom Württembergischen<br />
Evangel. Lehrer-Unterstützungsverein; Stuttgart 1912<br />
(= Württembergische Volksbücher). Einen Einblick in den Einsatz<br />
der Hohenzollern, der sich vorwiegend in Spanien abspielte, gibt<br />
St. Keßler, »Das hohenzollerische Militär vor 150 Jahren im<br />
Dienste Napoleons«, S. 33 in: Hohenzollerische Heimat, 12.Jg.,<br />
H. 3, 1962; zum Engagement der Badener in Spanien siehe: Erich<br />
Blankenborn; 1808-1814. Badische Truppen in Spanien. Amtliche<br />
Veröffentlichung des Armeemuseums Karlsruhe/Baden. Deutsche<br />
Wehr am Oberrhein; Karlsruhe 1939.<br />
4<br />
GLA 238/30; hier einige Schreiben, die Aufstellung der Landwehr<br />
betreffend.<br />
5<br />
Dazu ausführlich Hermann Haering, »Die Organisierung von<br />
Landwehr und Landsturm in Baden in den Jahren 1813 und 1814«,<br />
S. 266-303 in: ZGO, 68. Bd. (N.F. 29. Bd.) 1914; zur weiteren<br />
Entwicklung von Landwehr und Bürgerwehr bis zu Revolution<br />
siehe Gottfried Brückner, Der Bürger als Bürgersoldat. Ein Beitrag<br />
zur Sozialgeschichte des Bürgertums und der bürgerlichen Gesellschaft<br />
des 19. Jahrhunderts. Dargestellt an den Bürgermilitärinstitutionen<br />
der Königreiche Bayern und Hannover und des Großherzogtums<br />
Baden; Phil. Diss. Bonn 1968.<br />
6<br />
GLA 238/29 »Stand und Formation insbesondere Die Organisation<br />
des Landsturms im Jahre 1814« - Tabellen zu allen Brigaden<br />
enthaltend, aus denen die Anzahl, Stärke und Dislokation der<br />
einzelnen Bataillone hervorgehen. Zum Befreiungskrieg vgl. auch<br />
Hannsjoachim W.Koch; Die Befreiungskriege 1807-1815. Napoleon<br />
gegen Deutschland und Europa; Berg/Starnberger See (Türmer)<br />
1987.<br />
7<br />
GLA 238/196; allerdings in der Schreibweise »v. Bechthold«. Der<br />
Name des Regimentes rührte daher, daß dessen Chef der Großherzog<br />
war. Uber die Einteilung des badischen Korps in den Kriegen<br />
JOHANN ADAM KRAUS<br />
Ende der Ringelsteiner?<br />
Eine nicht alltägliche Nachricht aus dem Breisgau hat im<br />
Februar 1981 einige für Heimatkunde besonders aufgeschlossene<br />
Bewohner von Ringingen auf der Zolleralb aufhorchen<br />
lassen. In Freiburg ist der 51jährige Hausmeister des Badischen<br />
Verlags namens Hans Ringelstein nach längerer Krankheit<br />
unter Hinterlassung der Witwe Auguste und zweier<br />
verheirateter Töchter (Ilona Reinhardt und Karin Stelzer) am<br />
18. Februar 1981 verstorben. Wer dachte da nicht sogleich als<br />
wissender Ringinger an die kleine Burgruine Ringelstein an<br />
der alten Markungsgrenze Burladingen-Ringingen überm<br />
Buckental, die nach jahrzehntelangen, in verschiedene Richtung<br />
zielenden Vermutungen endlich im Jahre 1931 1 als<br />
sicher festgestellt wurde. In Grenzbeschrieben von 1454 bis<br />
1780 konnte die genaue Lage des Adelssitzes nachgewiesen<br />
werden, über den man so lange gerätselt hatte. Die kleine<br />
Turmruine war später nach dem Namen des betreffenden<br />
Waldbesitzers »Aloises Schlössle« (nämlich nach Alois<br />
Stözle) vom Volksmund benannt worden, und der Ringelstein<br />
selbst war völlig vergessen. Dieses kleine Felsennest mit<br />
erst nachträglich unterhalb noch im Wald ob der Kälberweide<br />
festgestellten Hofraum war mindestens seit dem Jahre 1274<br />
Sitz des zollerischen Vasallengeschlechtes »von Ringelstein«,<br />
zeitweise auch »von Killer« genannt, welches Dorf in neuerer<br />
Zeit das alte Adelswappen mit einer Peitsche als Zugabe als<br />
Ortswappen angenommen hat. Der meisterwähnte Vertreter<br />
Heinrich hat den merkwürdigen Beinamen »Affenschmalz«<br />
1375 aus dem sonnigen Süden mitgebracht 2 , wo er im päpstlichen<br />
Heere focht, wie aus der Nachbarschaft ein Konrad von<br />
Burladingen und Hugo von Melchingen. Das zollerische<br />
Lehen, die Burg, die wohl als Ruine »Burgstall« hieß, samt<br />
den zugehörigen Gütern des Kaspar von Ringelstein war<br />
und Mobilmachungen von 1805-1859 vgl. Badischer Militär-<br />
Almanach, 6. Jg. 1859, S. 48-64.<br />
8 Kühn und v. Kalenberg wurden später Generalmajore; vgl. dazu<br />
Bernd Philipp Schröder, Die Generalität der deutschen Mittelstaaten<br />
1815-1870. Mit Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung<br />
hrsg. v. Institut zur Erforschung Historischer Führungsschichten,<br />
Bensheim; Osnabrück 1984 (= Handbuch der deutschen Generalität<br />
im 19. Jahrhundert; Teil 1), S.64 und 68.<br />
9 Vgl. Unter dem Greifen. Altbadisches Militär von der Vereinigung<br />
der Markgrafschaften bis zur Reichsgründung 1771-1871. Hrsg.<br />
von der Vereinigung der Freunde des Wehrgeschichtlichen<br />
Museums Schloß Rastatt e.V. Bearbeitet von Sabina Hermes und<br />
Joachim Niemeyer; Karlsruhe/Rastatt 1984, S. 79-81.<br />
10 Die Kampfhandlungen, an denen das spätere badische Leib-<br />
Grenadier-Regiment während der Jahre 1806-1815 teilnahm, sind<br />
nachzulesen bei v. Barsewisch; Geschichte des Großherzoglich<br />
Badischen Leib-Grenadier-Regiments 1803-1871. Zweite unveränderte<br />
Auflage; Karlsruhe 1906; S. 34-168.<br />
11 Ihr Bruder gab die Todesanzeige für den am 30.6. 1835 abends um<br />
6.30 Uhr verstorbenen 52jährigen Anton Bechtold v. Ehrenschwerdt<br />
in der »Karlsruher Zeitung« vom 3. 7. 1835 auf. Nach<br />
den Befreiungskriegen war er 1826 zum Oberstlieutenant aufgestiegen<br />
und seit dem 14. 6. 1832 mit der Stelle des Rekrutierungsoffiziers<br />
für den Bezirk Karlsruhe betraut. Zum Geschlecht derer v.<br />
Stetten vgl. E. von der Becke-Klüchtzner; Stamm-Tafeln des Adels<br />
des Großherzogthums Baden. Ein neu bearbeitetes Adelsbuch;<br />
Baden-Baden (A.v.Hagen) 1886-1888, S. 465-471 und 623. Er<br />
führt allerdings nur eine Caroline Friederike Ernestine Luise<br />
(1785-1853) auf, so daß seine Angaben nicht identisch sind mit<br />
denen des Gothaer Taschenbuches (Anm. 1), wo die Lebensdaten<br />
von Bechtolds Frau mit 1792-1832 angegeben werden.<br />
12 Vgl. die Hof- und Staatshandbücher des Großherzogtumes Baden<br />
1850-1873.<br />
schon im Jahre 1485 nicht mehr in Hand des Geschlechts,<br />
weswegen Albrecht von Ringelstein beim Kaiser Klage<br />
erhob. Dieses Albrechts vermutlicher Sohn Kaspar aber<br />
verscherzte durch seine Ehe mit einer württembergischen<br />
Leibeigenen Margareth N. seinen Adelstitel, so daß der Sohn<br />
Joß (Jodokus) mit 5 Schwestern auch leibeigen und ohne<br />
»von« 1548 in Hechingen lebten. Ein Christoph Ringelstein<br />
wird 1543 als Untervogt zu Sigmaringen gemeldet, das kurz<br />
zuvor zollerisch geworden war. Der Schmied Joß Ringelstein<br />
lebte 1589 in Stein bei Hechingen mit seiner Frau Walburga<br />
Redlerin und den Kindern Maria und Kaspar. Ebendort<br />
finden wir einen Balthasar und einen Kaspar Ringelstein um<br />
1595. Ein Viehhirt Laurenz R. zu Stein erhielt hundert Jahre<br />
später, nämlich 1679, einen Sohn Johannes und ein Hans<br />
Georg Ringelstein von da ehelichte 1680 eine Katharina Saile<br />
von Bechtoldsweiler, beide in beschränkten Verhältnissen.<br />
Fünf Jahre drauf erhielten sie einen Sohn Sebastian. Endlich<br />
im Jahre 1743 kam eine arme Landfahrerin oder Hausiererin<br />
Margaretha Elisabeth Bopeyin nach Ringingen auf der Alb.<br />
Sie gab an, Witwe des kurz zuvor verstorbenen Johannes<br />
Ringelstein und in guter Hoffnung zu sein. Sie gebar einen<br />
Sohn, der am 8. Oktober 1773 in der Ringinger Pfarrkirche<br />
nach dem Paten Andreas Fink dessen Vornamen erhielt. Hat<br />
die Frau noch gewußt von der Urheimat ihres Mannes, vom<br />
ehemaligen Schlössle Ringelstein? Doch das lag längst in<br />
Trümmern. Eulen und Falken nisteten im zerfallenen<br />
Gemäuer und wilder Epheu rankte sich um Felsen und Stein<br />
am Kästlesbühl. (Kästle von lat. castellum = Burg!) So zog die<br />
Frau mit den Ihrigen wieder weiter durch die Lande. Ob der<br />
eingangs genannte Hans Ringelstein in Freiburg als letzter<br />
Nachkomme der einst adeligen Familie in Frage kommt, wer<br />
55
kann das entscheiden? Als ursprünglicher Feinschleifer arbeitete<br />
er wegen angegriffener Gesundheit seit sieben Jahren als<br />
Hausmeister.<br />
Die Ruine Ringelstein wurde 1929 etwas instandgesetzt und<br />
vom Steinhauer Karl Dietrich, dem begeisterten Heimatfreund,<br />
eine Gedenktafel mit Wappen und Daten angebracht,<br />
die jedoch bald einigen Lausbuben als Zielscheibe ihrer<br />
Steinwürfe diente und in Trümmer ging. Selbst viele Ringin-<br />
HERBERT BURKARTH<br />
Der Streit um die Weiderechte im Hart<br />
Die Gemeinden Harthausen, Feldhausen und Kettenacker<br />
hatten eine gemeinsame Weide mit den Gemeinden Wilsingen,<br />
Pfronstetten und Tigerfeld. Das Gebiet wurde das Hart,<br />
auch die gemeinsame Weide genannt. Beide Bezeichnungen<br />
findet man heute noch auf der Topographischen Karte.<br />
Wahrscheinlich stammt diese gemeinsame Weide aus einer<br />
Zeit, in der es zwischen den kleinen Gemeinden noch große,<br />
unbebaute Flächen gab, die man als Weide und Wald benutzte.<br />
Mit Zunahme der Bevölkerung wurden die Anbauflächen<br />
immer mehr ausgedehnt und es kam dann häufig zu Streitigkeiten<br />
zwischen den Gemeinden. Meistens wurde der Streit<br />
durch eine endgültige Teilung beigelegt. Gelegentlich kam es<br />
jedoch zu endlosen Streitereien und Prozessen. Im Falle des<br />
Hart war die Lage komplizierter. Das Kloster Zwiefalten war<br />
Grundherr und versuchte das Hart als Wald anzupflanzen.<br />
Dies war an sich für die Gemeinden kein großer Nachteil,<br />
denn es war allgemein üblich die Weidetiere in den Wald zu<br />
treiben. Um Wald zu bekommen, mußte das Kloster Teile der<br />
Weide sperren, bannen, damit die Weidetiere nicht die jungen<br />
Bäume abfraßen. Um diese Banngebiete entbrannte dann<br />
immer ein heftiger Streit.<br />
Gelegentlich kam es auch vor, daß das Kloster seinen Untertanen<br />
erlaubte, im Hart Felder umzubrechen. Diese mußten<br />
dann dem Kloster die Landgarbe (die 5. oder 9. Garbe) geben.<br />
Auch gegen dieses Vorhaben des Klosters protestierten die<br />
Gemeinden. Sie hatten Interesse daran, daß alles so blieb, wie<br />
es war; jede Form der Kultivierung beeinträchtigte die Weide.<br />
Das Hart gehörte ursprünglich zur Herrschaft Gammertingen-Hettingen.<br />
Es wurde von Heinrich von Rechberg, dem<br />
Erben des letzten Grafen von Veringen, an das Kloster<br />
Zwiefalten verkauft. Aus nicht bekannten Gründen focht er<br />
denVerkauf später wieder an und es kam zu einer Schlichtung<br />
durch Gräfin Henriette von Württemberg (1429). Das<br />
Kloster sollte unangefochten im Besitz des »Waldes Hart«<br />
bleiben. Es sollte jedoch jährlich für den verstorbenen Grafen<br />
Wölfle von Veringen, den Heinrich von Rechberg, seine Frau<br />
und seine Kinder einen Jahrtag halten, wie man im Kloster für<br />
andere edle Leute Jahrzeit begehe.<br />
Der Verkauf betraf die Territorialrechte und das Recht am<br />
Wald. Die Rechte der drei Gammertinger Gemeinden auf die<br />
Weide wurden von dem Verkauf nicht berührt. Diese Rechte<br />
wurden übrigens grundsätzlich nie bestritten. Das Hart hatte<br />
eine Fläche von ca. 1000 Jauchert. Das Kloster stand den<br />
Gemeinden auf 300 Jauchert das Wiederecht zu. Dieses<br />
Gebiet wurde genau vermerkt. Auf diese Weise gelang es dem<br />
Kloster, die Gemeinden an den Rand seines Territoriums zu<br />
drängen.<br />
56<br />
ger schenkten dem im Wald versteckten Felsen mit den<br />
spärlichen Trümmern des Schlössle keine Beachtung, wie<br />
auch dessen richtigem geschichtlichem Namen Ringelstein,<br />
dem »kleinen Stein«!<br />
Anmerkungen<br />
1 Albv. Blätt. 1931, 317ff.<br />
2 Hohenz. JHeft 1954, 103-141.<br />
Der erste Streit um das Hart, der urkundlich belegt ist, datiert<br />
vom Jahre 1478. Graf Ulrich von Württemberg war Vermittler<br />
zwischen den Herren von Bubenhofen und dem Kloster.<br />
Schon 1501 beschwerten sich die Gemeinden Harthausen,<br />
Feldhausen und Kettenacker erneut. Das Kloster hatte die<br />
Egerten, die Weiden und den Sattler umgebrochen. Man<br />
einigte sich, daß die Egerten nicht mehr umgebrochen werden<br />
sollten, wie es die alten Gerechtigkeiten bestimmten.<br />
85 Jahre später, 1586 wurde ein Vertrag zwischen Zwiefalten<br />
und Frau Dorothea Speth, geb. von Rechberg abgeschlossen.<br />
Auch dieser Einigung waren längere Streitigkeiten vorausgegangen.<br />
Mehrere Wilsinger Bauern hatten im Hart Acker<br />
umgebrochen und gaben dem Kloster die Landgarbe. Es heißt<br />
in dem Vertrag u.a.: »was unterhalb, hinabwärts gegen die<br />
neue Kapelle bei dem Kreuzle liegt, haben Kettenacker,<br />
Harthausen, Feldhausen und Wilsingen den gemeinsamen<br />
Zutrieb. »Hier wird erstmals die Hartkapelle oder Sattlerkapelle<br />
genannt.<br />
1599 erhielt Schultheiß Michael Knupfer aus Pfronstetten von<br />
den Gemeinden die Erlaubnis im Ottental eine Holzwiese auf<br />
9 Jahre umzubrechen und zu bauen. Den halben Zehnten<br />
mußte er an die Herrschaft in Hettingen geben, die andere<br />
Hälfte bekam das Kloster.<br />
1603 war wieder ein heftiger Streit entbrannt. Das Kloster<br />
hatte 40 Jauchert im Weidedistrikt gebannt. Die Kettenacker<br />
trieben trotzdem ihr Vieh hinein, wogegen sich das Kloster<br />
bei der Speth'schen Herrschaft Hettingen beschwerte (Kettenacker<br />
gehörte seit der Speth'schen Teilung von 1599 zur<br />
Herrschaft Hettingen). Speth-Hettingen ersuchte das<br />
Kloster, die Weiderechte der Gemeinden nicht zu stören. Der<br />
Streit ging jedoch erst richtig los. Bauern von Pfronstetten<br />
und Tigerfeld legten im Hart eigenmächtig 8 bis 10 Jauchert<br />
Felder an. Sie wurden um 15 Gulden gestraft. Das Kloster<br />
errichtete neue Banngebiete, Speth protestierte und forderte<br />
die Untertanen auf, das Vieh in die gebannten Gebiete zu<br />
treiben. Das Kloster strafte die Gemeinden dafür um 10<br />
Gulden. Da die Speth'sche Herrschaft beim Kloster nichts<br />
erreichte, schickte sie 1607 eine Bittschrift an die herzogliche<br />
Regierung nach Stuttgart.<br />
Württemberg hatte die Schirmherrschaft über das Kloster.<br />
Schon der Vertrag von 1478 war mit Vermittlung des Grafen<br />
Ulrich abgeschlossen worden. Da aus Stuttgart zunächst<br />
nichts erfolgte, dachten die Junker Speth sogar daran, eine<br />
kaiserliche Kommission anzufordern. Dem Kloster war dieser<br />
Gedanke nicht unsympathisch, weil man mit Württemberg<br />
nicht allzu gut stand. Das Kloster machte sogar Vorschläge,<br />
wie diese Kommission zu besetzen sei. Württemberg<br />
hatte aber in der Zwischenzeit vom Kloster Zwiefalten einen
Bericht über die Angelegenheit angefordert, so daß eine<br />
kaiserliche Kommission nicht mehr in Frage kam.<br />
Das Kloster richtete nun selbst eine Bittschrift nach Stuttgart.<br />
In dem 300 Jauchert großen Trieb, den die Gemeinden<br />
Harthausen, Feldhausen und Kettenacker im Hart hätten,<br />
wollte das Kloster einige Plätze zu Wald machen. Die<br />
Gemeinden seien jedoch hinderlich und gewaltsam. Es wird<br />
ausführlich geschildert, was die fremden Untertanen dem<br />
Kloster alles antun.<br />
Die herzogliche Kanzlei forderte die Junker Speth zu einem<br />
Gegenbericht auf. Diese beklagten sich nun ihrerseits über<br />
das gewaltsame Benehmen des Klosters und wiesen auf die<br />
Verträge von 1478, 1501 und 1586 hin. Im Jahre 1612<br />
beschwerte sich das Kloster erneut beim Herzog Friedrich in<br />
Stuttgart, daß die drei Gemeinden einen, vom Kloster angelegten<br />
Waldsamenplatz beweidet und zerstört hätten. Von<br />
Stuttgart wurde nun ein Augenschein, also eine Ortsbesichtigung,<br />
angeordnet. Dabei fand man eine Einigung. Das<br />
Kloster dürfe jeweils 12 Jauchert bannen. Solange diese im<br />
Bann seien, dürfe keine andere Fläche bebaut werden. Im<br />
ganzen Weidegebiet dürften also nie mehr als 12 Jauchert<br />
gleichzeitig gebannt sein. Uber diese Einigung wurde ein<br />
Vertrag zwischen den streitenden Parteien geschlossen.<br />
Schon ein Jahr später, 1613 verlangte das Kloster 20 Jauchert.<br />
Dies wurde von den Junkern Speth dem Kloster zugestanden.<br />
Zur Beruhigung der Untertanen wurde versichert, daß diese<br />
wieder den Zutrieb bekämen, sobald der Wald angewachsen<br />
sei, oder sich zeige, daß der Wald überhaupt nicht wachse.<br />
Dieser Vertrag stiftete für längere Zeit Ruhe. Der Dreißigjährige<br />
Krieg brachte Not und Bedrängnis für Herrschaft und<br />
Untertanen. Das Hart verödete völlig. Trotzdem vergaßen<br />
die Gemeinden ihre Rechte nicht. 1665 wurde z.B. für die<br />
Gemeinde Feldhausen ein neues Bürgerbuch angelegt, weil<br />
die Soldaten das alte Buch vernichtet hatten. Darin wurden<br />
die Weiderechte im Hart genau beschrieben.<br />
Erst 1689 erfahren wir, daß man wieder am Streiten war. Das<br />
Kloster wollte ein Gebiet von 100 Jauchert mit Wald<br />
anbauen. Speth-Hettingen protestierte und beschwerte sich,<br />
darüber, daß Tigerfelder und Huldstetter durch Ausstocken<br />
und Anbauen von Holz den Trieb benachteiligten. In einem<br />
Vertrag wurde festgelegt, daß die Tigerfelder den Acker, den<br />
sie umgebrochen hatten, für 6 Jahre benützen dürften; danach<br />
müsse er wieder als Weide liegengelassen werden.<br />
Bei dieser Gelegenheit erfahren wir auch, daß das Hart als<br />
Folge des Krieges und der langen Notzeit völlig mit Gestrüpp<br />
verwachsen war. Die Weideberechtigten einigten sich, das<br />
Gebiet gemeinsam auszuholzen und auszustocken, um die<br />
Weiden wieder in guten Zustand zu bringen. Von der Forderung<br />
des Klosters nach 100 Jauchert Wald hört man nichts<br />
mehr.<br />
Speth-Hettingen beschwerte sich 1735, daß Tigerfelder,<br />
Pfronstetter und Huldstetter im Hart, nächst der Kapelle,<br />
grasen und Ackerfeld umbrechen. Offensichtlich versuchte<br />
die Speth'sche Herrschaft für sich selbst etwas herauszuschlagen,<br />
denn sie verlangte 1745 die Hälfte der Landgarbe von<br />
12Jauchert Ackerland im Mettental.<br />
1753 wurden die Marken im Hart neu gesetzt. Wir erinnern<br />
uns, daß 1599 Michael Knupfer aus Pfronstetten die Genehmigung<br />
bekommen hatte, für 9 Jahre im Hart eine Holzwiese<br />
anzulegen. 166 Jahre später, im Jahr 1767, zahlte Mathäus<br />
Knupfer von Pfronstetten den Triebberechtigten 11 Gulden<br />
für die Bewilligung, seine Holzwiese im Hart umbrechen zu<br />
dürfen. 1820 ist Knupfers Holzwiese schon zum Flurnamen<br />
geworden.<br />
Ein neuer Streit kam 1786 in Gang. Das Gammertinger Obervogteiamt,<br />
das jetzt für die ganze Speth'sche Herrschaft zuständig<br />
war, beklagte sich im Namen der drei Gemeinden beim<br />
Kloster. Dieses habe im Hart 60 bis 80 Jauchert Wald angebaut<br />
und es treibe etwa 800 Schafe ins Hart. Die Holzwiese des<br />
Johann Knupfer von Pfronstetten sei für 18 Jahre verliehen und<br />
dann Jahr um Jahr verlängert worden. Die Zeit sei nun<br />
abgelaufen. Die Bewohner des Kapellenhauses hätten nun<br />
diese Holzwiese ohne Anfrage und Erlaubnis umgebrochen.<br />
Die Klosterkanzlei antwortete umgehend. Hinsichtlich der<br />
Schafweide lasse man sich nicht beschränken. Dabei hatte das<br />
Kloster selbst im Hart überhaupt kein Weiderecht, sondern<br />
nur das Recht auf den Wald. Als Wald seien nicht 60 und nicht<br />
80 Jauchert angebaut, sondern nur 24 Jauchert im Sattlerhau.<br />
Der Knupfer habe nur einen ganz kleinen Steinriegel umgeackert,<br />
er habe die Gemeinden noch um Erlaubnis fragen<br />
wollen. So wurden von den schlauen Klosterkanzlisten die<br />
Rechtsbrüche nicht ganz abgestritten, sondern als klein und<br />
nicht erwähnenswert dargestellt. Anscheinend bestand das<br />
Kloster aber doch nicht auf der Schafweide, denn man hört<br />
nichts mehr davon.<br />
Akte des Herzoglich Wirtembergischen Oberamtes Zwiefalten mit<br />
dem Siegel der Klosterkanzlei.<br />
Das Klostergebiet Zwiefalten wurde 1802 dem Herzogtum<br />
Württemberg einverleibt. Zwiefalten bekam zunächst ein<br />
Oberamt und ein Forstamt. Das Oberamt wurde jedoch<br />
schon 1810 mit dem Oberamt Münsingen vereinigt. Das<br />
Forstamt blieb länger bestehen. Das herzogliche Oberamt<br />
wird in unserem Streit erstmals 1803 aktenkundig, als dem<br />
Huldstetter Bauern Michael Heß 30 Jauchert von der gemeinsamen<br />
Weide verpachtet wurden. Das Oberamt hatte noch<br />
kein eigenes Siegel, es benützte das Siegel der Klosterkanzlei<br />
weiter. Die Verpachtung erfolgte durch die Gemeinden, der<br />
Vertrag wurde nur vom Oberamt beurkundet. Das Hart war<br />
jetzt württembergischer Staatsforst, trotzdem scheint es<br />
zunächst keine wesentlichen Differenzen gegeben zu haben.<br />
Uber den Winter durften die Weiden nicht betreten werden.<br />
Im Frühjahr mußten die Gammertinger Gemeinden zunächst<br />
ihre »Weidebriefe« und Listen über die Anzahl und Art der<br />
Weidetiere vorlegen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde<br />
dann der Trieb freigegeben.<br />
1818 begannen neue Auseinandersetzungen, welche sich<br />
wahrscheinlich am Verkauf der Hartkapelle entzündeten.<br />
Um ihre Rechte zu wahren, erschienen zum Verkaufstermin<br />
auch die Bürgermeister von Harthausen, Feldhausen und<br />
Kettenacker. Die Kapelle sollte nur auf Abbruch verkauft<br />
werden, die drei Bürgermeister hatten jedoch die Befürchtugung,<br />
daß der Käufer den Kapellengarten als Eigentum<br />
bekomme. Sie protestierten deshalb gegen den Verkauf. Der<br />
württembergische Cameralbeamte, der den Verkauf vornahm,<br />
war ziemlich ungehalten. Er sei zum Verkaufen<br />
gekommen und wenn jemand Einwände hätte, dann möge er<br />
sie an höherer Stelle vorbringen. Forstmeister v. Moltke aus<br />
Zwiefalten schrieb an das Gammertinger Obervogteiamt, daß<br />
57
keine Grundstücke verkauft würden. Es sei geplant, an der<br />
Stelle der Kapelle einen Pflanzengarten anzulegen. Die<br />
Kapelle sei seit »undenklichen Zeiten« Eigentum des Klosters<br />
gewesen und die Gemeinden hätten auf dem Platz kein<br />
Anrecht. Der Streit war aber nun schon angeheizt. Im Mai<br />
1819 richtete das Obervogteiamt Gammertingen eine<br />
Beschwerde im Auftrag der drei Gemeinden an die königliche<br />
Regierung des Donaukreises in Ulm. Eingaben an das Justizamt<br />
in Zwiefalten, das Forstamt Zwiefalten und das Oberamt<br />
Münsingen seien erfolglos gewesen. Die Gemeinden würden<br />
in ihren, seit undenklichen Zeiten bestehenden Rechten<br />
beschädigt und beeinträchtigt. Man erhoffe nun Schutz von<br />
der königlichen Regierung.<br />
Was folgte, war zunächst ein Anpfiff von der Fürstlichen<br />
Regierung in Sigmaringen an das Obervogteiamt in Gammertingen.<br />
Man möge sich gefälligst an den Dienstweg halten und<br />
nicht eigenmächtig mit fremden Regierungen korrespondieren.<br />
Man solle einen erschöpfenden Bericht an die Fürstliche<br />
Regierung senden und diese würde sich dann der Sache<br />
annehmen.<br />
Hauptpunkt der Beschwerden war, daß das Forstamt Zwiefalten<br />
wesentlich mehr, als die zustehenden 20 Jauchert von<br />
der Weide gebannt habe. Der Volkszorn suchte auch nach<br />
einem Sündenbock, den er in der Gestalt des Unterförsters<br />
Ampfer fand. Ampfer hatte seinen Amtssitz in Kettenacker,<br />
Württemberg hatte immer die Forsthoheit in den Speth'schen<br />
Gebieten und das Recht, dort einen »Forstknecht« zu stationieren.<br />
Ampfer, so wurde berichtet, habe nicht nur den<br />
Zankhau, sondern auch den Tannenhau und das Zehnental<br />
für 2 Monate gebannt und damit der Weide 100 Jauchert, ein<br />
Drittel entzogen. Er selber habe im Hart Heu gemacht und<br />
seine Schafe ins Hart getrieben. Bei der Hartkapelle habe er<br />
sich einen Acker von 25 Jauchert angelegt und der Weide<br />
entzogen.<br />
Ampfer wurde zu diesen Beschuldigungen vom Forstamt<br />
Zwiefalten angehört. Er gab an, daß er seit 25 Jahren württembergischer,<br />
fußgehender Förster in Kettenacker sei. Er<br />
habe sich nie erlaubt, im Weidedistrikt Hart Heu zu machen.<br />
Schon seit 5 bis 6 Jahren habe er keine Schafe mehr und<br />
deshalb auch die Weide nicht benützt. Er habe sich nie einen<br />
Fruchtanbau von 25 Jauchert im Weidedistrikt gemacht. Auf<br />
Ansuchen habe er vom Pfarrer in Tigerfeld unentgeltlich 3<br />
Jauchert von den Pfarräckern im Hart (bei der Kapelle)<br />
erhalten. Auch der Mesmer habe vom Pfarrer 4 Jauchert und<br />
nicht mehr. Der ganzen Sache liege nur eine »leidenschaftliche<br />
Verläumdung« zugrunde.<br />
Es ergab sich dann, daß Ampfer zwar nicht 25 Jauchert, aber<br />
doch 7 Jauchert von der Weidefläche umgeackert hatte. Im<br />
übrigen teilte Forstmeister v. Moltke dem Obervogt Hermannutz<br />
in Gammertingen mit, daß er bereit sei, die gebannten<br />
Flächen vermessen zu lassen, wenn die Gammertinger die<br />
Kosten dafür übernehmen würden. Dem wurde natürlich<br />
heftig widersprochen, denn man könne nicht dem Geschädigten<br />
auch noch Kosten zumuten. Im übrigen hatte Obervogt<br />
Hermannutz das Hart schon von dem Feldhauser Förster und<br />
Geometer Christian Huthmacher vermessen lassen. Huthmacher<br />
berichtete, daß im Zankhau 60 Morgen seit 28 Jahren<br />
gebannt seien. Forstmäßig könnte man die Bannung aufheben.<br />
Im Tannenhau und Zehnental seien etwa 120 Morgen<br />
seit 10 bis 12 Jahren in der Bannung. Man könne noch gut<br />
sehen, daß der größte Teil der Fläche ursprünglich Weide und<br />
nicht Wald gewesen sei.<br />
Im September 1821 ließ nun Forstmeister v. Moltke seinerseits<br />
eine Vermessung durch den Geometer Münch vornehmen.<br />
Um der Sache amtlichen Charakter zu geben, lud er die<br />
beteiligten Bürgermeister und das Obervogteiamt dazu.<br />
Münch ermittelte eine, mit Wald bestandene Fläche, von 32<br />
Jauchert, 2 Viertel im Tannenhau, Zankhau und Zehnental.<br />
58<br />
Da Huthmacher in Morgen und Münch in Jauchert rechnete,<br />
ist es praktisch unmöglich, die Ergebnisse zu vergleichen. Es<br />
ist jedoch anzunehmen, daß sie weitgehend identisch sind.<br />
Das Ergebnis der Vermessung wurde an die Kreisregierung in<br />
Ulm geschickt. Dort begannen nun die Mühlen der Bürokratie<br />
zu mahlen (von September bis Mai).<br />
Im Frühjahr 1822 gab es erneut Anlaß zu Beschwerden.<br />
Förster Ampfer hatte angeblich nicht nur den Tannenhau,<br />
sondern auch den Zankhau und das Zehnental für 2 Monate<br />
gebannt. Als der Streit begann, war jedoch schon ein Schreiben<br />
der Kreisregierung von Ulm unterwegs. Darin stand etwa<br />
folgendes:<br />
1. Der Zankhau (seit 28 Jahren gebannt) ist noch in diesem<br />
Sommer für die Weide zu eröffnen.<br />
2. Vom Tannenhau und vom Zehnental sind statt der 20<br />
Jauchert, welche der Vertrag von 1613 gestattet, 32 Jauchert,<br />
2 Viertel gebaut. Diese können wegen der Gefahr<br />
für den Waldbestand jetzt nicht für die Weide eröffnet<br />
werden. Dies wird jedoch geschehen, sobald der Zustand<br />
des Holzes es gestattet.<br />
3. Die Untersuchungen des Forstamtes Zwiefalten haben<br />
ergeben, daß Unterförster Ampfer und der Kapellenmesmer<br />
neben den Pfarräckern von Tigerfeld zwar nicht 25<br />
Jauchert, wie in der Klage angegeben, aber doch 7 Jauchert<br />
von der Weidefläche zu Feld gemacht haben. Diese müssen<br />
sofort wieder als Weide liegen gelassen werden.<br />
4. Der Eichelgarten, welcher an der Stelle angelegt wurde,<br />
wo die Hartkapelle stand, darf nicht mehr ausgedehnt<br />
werden, als er duch die darum geführte Mauer begrenzt ist.<br />
Man hoffe, daß durch diese Verfügungen die klagenden<br />
Gemeinden zufrieden gestellt seien. Die Klagepunkte der<br />
Grasnutzung und Eintreibens von Schafen durch den<br />
Unterförster Ampfer seien nicht genügend begründet.<br />
Dieses Schreiben ist ein typisches Beispiel, wie man<br />
»Untertanen« von Seiten der Obrigkeit verdummte. Im Ton<br />
ist alles auf Entgegenkommen eingestellt: Der Zankhau ist<br />
noch in diesem Sommer zu eröffnen, in Wirklichkeit war<br />
diese Eröffnung längst fällig. Es sind zwar widerrechtlich 32<br />
Jauchert gebannt, aber wegen der Gefahr für den Waldbestand<br />
kann man sie nicht öffnen, die Untertanen haben das<br />
einzusehen. Man hätte ihnen auch eine Entschädigung anbieten<br />
können, aber die Leute waren ja zu bescheiden, von sich<br />
aus so etwas zu verlangen. Selbstverständlich wird man die<br />
Bannung sofort aufheben, wenn der Zustand des Holzes das<br />
gestattet. Zum Schluß warf man dem Volke den Unterförster<br />
Ampfer und den Kapellenmesmer zum Fräße vor. Für sie war<br />
es wirklich hart, die schon angesäten Äcker vom Vieh abweiden<br />
zu lassen. Aber das kostete die Staatskasse keinen<br />
Pfennig.<br />
Die Regierung des Donaukreises wollte es aber auch schriftlich<br />
haben, daß die Gemeinden nun zufriedengestellt seien. In<br />
einem Protokoll, das nach Ulm weitergeleitet wurde, bestätigten<br />
die Bürgermeister dem Obervogteiamt, daß sie<br />
beruhigt seien und darauf vertrauten, daß ihre Rechte nicht<br />
mehr geschmälert würden.<br />
Damit war der Streit um die Weiderechte im Hart beendet.<br />
Schon 8 Jahre später wurden die Weiderechte abgelöst. Die<br />
Gründe dafür waren wirtschaftlicher Natur, weil die Weidewirtschaft<br />
durch die Stallfütterung ersetzt wurde. Auch die<br />
Gemeinden forsteten ihre eigenen Weideflächen nach und<br />
nach auf. Das Hart wurde ein geschlossenes Waldgebiet,<br />
württembergischer Staatsforst. Zankhau, Tannenhau und<br />
Zehnental sind nur noch Waldparzellen. In der Nähe des<br />
früheren Standortes der Sattlerkapelle findet man sogar Täfelchen<br />
mit der Bezeichnung »Weite«, weil sich niemand mehr<br />
erinnert, daß das eigentlich »Weide« heißen müßte.<br />
Die verwendeten Urkunden und Akten befinden sich in<br />
Privatbesitz.
WALTER KEMPE<br />
Die Herren der Burg Leiterberg<br />
In der Gemarkung von Wangen bei Ostrach liegt links der<br />
jetzigen Landstraße Ostrach-Habsthal, ca. 500 m nach der<br />
Brücke, eine bewaldete, wenig auffällige Höhe. Sie verbirgt<br />
eine flache Kuppe, die nach drei Seiten, im Westen, Norden<br />
und Osten, terrassenförmig abfällt. Im Süden grenzt der<br />
Wald an eine ebene Wiese. Sie weist hier eine grabenartige<br />
Bodenwelle auf.<br />
Auf der amtlichen Flurkarte 1 ist das Grundstück als rhombenförmiges<br />
Viereck dargestellt. Die 1019 m 2 große Parzelle<br />
trägt die Nr. 204. Sie wird umschlossen von dem größeren<br />
Flurstück Nr. 203. Das Gewann selbst heißt »Leiterberg«.<br />
Ostwärts liegt die Flur »Breite« (= Ackerfeld einer Burg) und<br />
südlich die Flur »Gemeines Mark«.<br />
Die topographische Karte, Blatt Ostrach 2 , hier auf gleichen<br />
Maßstab gebracht, weist das Gebiet »Leiterberg« als »Reuteäcker«<br />
aus. Anstelle des Vierecks ist auf Höhe 626,3 eine<br />
ellipsen- bzw. eiförmige Fläche von ca. 900 m 2 zu sehen<br />
(Umriß gepunktet). Sie ist in Form und Größe ähnlich den<br />
kartenmäßigen Umrissen des ehemaligen Burgstalles auf dem<br />
Kaplaneigelände in Ostrach und des engeren Burgstalles von<br />
Burgweiler.<br />
Was hat es für eine Bewandtnis mit dem Leiterberg?<br />
Vermutungen und Legenden geben keine klare Antwort auf<br />
die Frage, ob hier eine Burg gestanden hat. Selbst offizielle<br />
Beschreibungen verneinen die frühere Existenz einer Burg<br />
auf Wangener Gebiet. Da heißt es z.B. »über das Vorhandensein<br />
einer Adelsburg ist nicht der Anhaltspunkt vorhanden,<br />
auch kein Flurname erinnert an eine solche« 3 .<br />
Und wenn wir gar unter Leiterberg nachlesen, heißt es:<br />
abgegangene Burg bei Levertsweiler. So nennt 1845 der<br />
Sigmaringer Archivar Eugen Schnell 4 Burg Leiterberg »nicht<br />
weit von Levertsweiler und Einhart«. 1905 wird im Oberbadischen<br />
Geschlechterbuch 5 der Leiterberg als abgegangene<br />
Burg bei Levertsweiler bezeichnet. Auch die Wappenrolle<br />
von Zürich 6 und die amtliche Beschreibung des Landes<br />
Baden-Württemberg von 1978 7 führen die Burg bei Levertsweiler,<br />
auf der die niederadeligen Herren von Leiterberg<br />
ansässig waren.<br />
Nach dem ersten Anhaltspunkt für Leiterberg auf der amtlichen<br />
Flurkarte der Gemarkung Wangen fand sich dann bei<br />
den Akten der Kapellenpflege Wangen im Pfarrarchiv<br />
Ostrach ein Auszug über »Laitterberg« vom 8.6.1831 8 , der -<br />
wie sich herausstellte - wahrscheinlich dem Fürstenbergischen<br />
Urbar des Amtes Wangen von 1760 entnommen ist 9 .<br />
Hier wird in Zusammenhang mit einem 2 Jauchert 1 Vierling<br />
121 Ruten großen Grundstück, Nr. 471 (etwa größer als<br />
1 Hektar) 10 , erwähnt, daß darauf früher als Besitz Salems ein<br />
Schlößle oder Haus stand. Heute seien jedoch nur noch die<br />
»Rudera«, das heißt der Schutt von alten, eingestürzten<br />
Gebäuden, zu sehen.<br />
Der Überlieferung nach 11 waren vor ca. 100 Jahren auf<br />
Parzelle Nr. 204 des Leiterbergs noch Mauerreste, deren<br />
Steine von Wangener Bürgern beim Bau von Häusern verwendet<br />
wurden. Nicht weit davon lag eine kleine Kiesgrube.<br />
Wie diese Burg oder das Schlößle um 1690 aussahen, hat ein<br />
Maler damals festgehalten. Unser Titelbild zeigt sie als Ausschnitt<br />
der Karte des Ostrachtales 12 , deren Kopie im<br />
Ostracher Heimatmuseum hängt.<br />
Es gilt zu untersuchen:<br />
1. wer die Herren von Leiterberg und ihre Nachfolger waren,<br />
2. wann und wo sie Besitz hatten und<br />
3. warum die abgegangene Burg Leiterberg, die in Wangen<br />
stand, auch Levertsweiler zugeordnet wurde.<br />
Die Herren von Leiterberg nannten sich nach ihrer Burg im<br />
Ostrachtal. Sie werden als Dienstmannen (Ministeriale) der<br />
Abtei Reichenau bezeichnet 13 . Die Schreibweise ist unterschiedlich:<br />
Laiterberg, Laiterberc, Laiterberch, Laitterberg,<br />
Laitterperg, Leiterberg und Leitersberg (bei verschiedenen<br />
Zitaten aus Urkunden haben wir die ursprüngliche Schreibweise<br />
beibehalten). Als Vornamen der Familie finden wir<br />
zwischen ca. 1200 und 1298: Burkard, Eggihard, Ortolf,<br />
Bertha und Engellindis. Die öftere Wiederkehr gleichlautender<br />
männlicher Vornamen über Generationen hinweg macht<br />
eine stammbaumm'ißige Erfassung schwierig. In einzelnen<br />
Fällen ist die Einstufung als Vater, Söhne, Töchter und<br />
Geschwister möglich. Sie werden als Dorf- und Patronatsherren,<br />
Dekane, Priester, Leutpriester, Pfarr-Rektoren,<br />
Ordensbrüder, Lehenmannen, Lehenträger und Zeugen in<br />
Urkunden aufgeführt. Ihr Siegel zeigt nach dem Lehenbuch<br />
der Abtei Reichenau eine auf einem grünen Dreiberge stehende<br />
rote Leiter auf silbernem Grund 14 .<br />
Der Name des Geschlechts ist mit Besitzungen und Rechten<br />
in Wangen, Levertsweiler, Ostrach und Krauchenwies verknüpft.<br />
1. Der Besitz in Wangen<br />
Die erste bekannte Verbindung zwischen Wangen, Krauchenwies<br />
und Leiterberg wird uns in einer Urkunde von 1243<br />
gezeigt. Bei der Schlichtung eines Streites zwischen dem<br />
Ritter Ekkehard von Wangen und dem Kloster Wald wegen<br />
eines Erbes vermittelte und ließ die Urkunde schreiben u.a.<br />
Ortolf, Dekan zu Krauchenwies. Er ist identisch mit Ortolf<br />
von Leiterberg, wie sein Siegel zeigt. Auch die meisten<br />
übrigen Zeugen waren aus unserer Gegend 15 . Locher<br />
beschreibt seine Stammburg als nördlich von Ostrach gelegen,<br />
wovon noch Ruinen bei Wangen zu finden sind (1872).<br />
Ob eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen den Herren<br />
von Wangen und den Herren von Leiterberg bestand,<br />
wissen wir nicht. Beide Familiennamen erschienen in einigen<br />
Fällen im gleichen Zeitraum in Urkunden über Wangen 16 ' 17<br />
Bereits 1294 war die Burg Leiterberg nicht mehr Besitz der<br />
Herren von Leiterberg. Beim Verkauf an Salem am 2.11.1294<br />
durch Ritter Ulrich von Königsegg und seinen Sohn 18 erfahren<br />
wir, daß der Vater des Verkäufers die Burg mit Zugehör<br />
früher von Burkard von Leiterberg erworben hatte. Sie dürfte<br />
zum Teil ein Lehen des Hochstifts Konstanz sowie des Edelmannes<br />
Bertold von Gundelfingen und seiner Brüder gewesen<br />
sein, da diese die Einwilligung zum Verkauf an Salem<br />
geben mußten. Diese Lehenherren waren bekanntlich auch in<br />
Einhart vertreten.<br />
Auf den in Lausheim ausgestellten lateinischen Kaufbrief<br />
wird dann noch jahrhundertelang Bezug genommen. So<br />
wurde der Brief im Jahre 1489 bei einem Streit wegen der<br />
Weiderechte beim Burgstall Leiterberg präsentiert 19 . Die<br />
Verhandlungen zwischen dem Besitzer Leiterbergs, Abt<br />
Johannes I. von Salem und dem Flecken sowie der Meierschaft<br />
zu Wangen dauerten ca. fünf Jahre. Hierbei erfahren<br />
wir Einzelheiten über den Umfang des Burgverkaufs von<br />
1294. Die Amtsperson Konrad Rott, Kaufmann zu Ostrach,<br />
trug als Vertreter des Abts vor, daß die Vorfahren des Abts<br />
59
das (Burg) Schloß »Laitterperg« mit Äcker, Wiesen, Bainden,<br />
Garten, Wald, Feld und mit allem Zugehör, mit Wegen, Trieb<br />
und Tratt, Wunn und Weid, laut einem gesiegelten Kaufbrief<br />
gekauft und genutzt haben. Der Vertreter Wangens entgegnete,<br />
daß keine Äcker außerhalb des (südlichen) Burggrabens<br />
zum Burgstall gehörten. Diese seien »ain gemain Gemärk<br />
usserthalb dem Graben«.<br />
Das südlich des ehemaligen Burggeländes angrenzende<br />
Gebiet heißt, wie wir gesehen haben, heute noch »Gemeines<br />
Märk« (Gemeindegrundstück). Als Schiedsrichter in diesem<br />
Streit entschied der uns von Einhart her bekannte Wilhelm<br />
Grämlich von Hasenweiler, daß die zwei Äcker am Burgstall<br />
Leiterberg, die innerhalb der von ihm festgesetzten Marken<br />
liegen, vom Abt nach eigenem Ermessen gegen Zins und<br />
Landgarb vergeben und eingezäunt werden dürfen. Vor und<br />
nach den Bäumen jedoch dürften sie (Vieh) treiben »wie uff<br />
ain andre brach« (Brache damals im 3. Jahr der Dreifelderwirtschaft).<br />
Anmerkungen<br />
1 Flurkarte Wangen, Lkr. Sigmaringen, Nr. SO 5320/SO 5420, hrsg.<br />
vom Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Stuttgart,<br />
Maßstab 1:2500, <strong>Ausgabe</strong> 1987.<br />
2 Topographische Karte, Ostrach, Blatt 8022, hrsg. vom Landesvermessungsamt<br />
Baden-Württemberg, Stuttgart, Maßstab 1:25000,<br />
<strong>Ausgabe</strong> 1975, vergrößert auf ca. 1:2500.<br />
3 Ludwig Heizmann, Der Amtsbezirk Pfullendorf und der ehemalige<br />
Amtsbezirk Achern in historischer Darstellung, mit 20 Abbildungen,<br />
Druck und Kommissionsverlag H.Wagner, München-<br />
Kolbermoor 1936, S. 31, Nr. 14, Wangen.<br />
4 Eugen Schnell, Historisch-statistische Beschreibung des Fürstlichen<br />
Oberamts Ostrach, in: Historisch-statistische Zeitschrift für<br />
HERBERT RÄDLE<br />
Zur Datierung des Falkensteiner Altars<br />
Der Falkensteiner Altar ist - neben dem Wildensteiner Altar 1<br />
- wohl das eindrucksvollste Werk des Meisters von Meßkirch<br />
in der Fürstlich Fürstenbergischen Gemäldesammlung<br />
Donaueschingen. Er ist alter Besitz der Fürstenberger und<br />
stammt aus der Schloßkapelle Falkenstein im Donautal 2 .<br />
Seine Datierung ist dokumentarisch nicht belegt.<br />
Nun weiß man freilich, daß der M.v.M. in der 2. Hälfte der<br />
30er Jahre vornehmlich im Dienste des Grafen Gottfried<br />
Werner von Zimmern gearbeitet hat. Werke aus dieser Zeit<br />
sind der schon erwähnte Wildensteiner Altar (datiert 1536),<br />
sowie der Haupt- und die insgesamt 10 ehemaligen Seitenaltäre<br />
der Kirche Sankt Martin in Meßkirch (ca. 1536-38),<br />
nach denen der Meister ja auch seinen Notnamen hat.<br />
Die Frage, ob der M.v.M. auch schon vor 1536 für Gottfried<br />
Werner von Zimmern gearbeitet hat, scheint nicht ohne<br />
weiteres beantwortbar. Hofstätter (S.6), der sich vorsichtig<br />
ausdrückt, stellt lediglich fest, der M.v.M. sei »von etwa 1530<br />
bis 1538 in Meßkirch für die Grafen von Zimmern tätig<br />
gewesen«. Doch hat schon Rieffei für ein viel früheres Werk<br />
des M.v.M., das Sigmaringer Hausaltärchen 3 , das durch eine<br />
Hochzeit auf 1524 datiert ist 4 , mit Recht »eine Beziehung (sc.<br />
des M.v.M.) zum Hause Gottfried Werners von Zimmern«<br />
festgestellt 5 . Gottfried Werner war nämlich mit Apollonia<br />
von Henneberg verheiratet, deren Wappen auf dem Altärchen<br />
vorkommt.<br />
Halten wir also fest: eine Beziehung des M.v.M. zur Familie<br />
Gottfried Werners von Zimmern kann schon für die Zeit um<br />
1524 belegt werden. Und wenn wir damit eine Information<br />
60<br />
die beiden Fürstentümer Hohenzollern, Sigmaringen, P. Liehner,<br />
1845, S. 35-129, hier S. 89.<br />
5<br />
J. Kindler von Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch,<br />
2. Bd., 1905, S. 485.<br />
6<br />
Die Wappenrolle von Zürich, Orell Füßli Verlag, Zürich, Leipzig,<br />
S. 107, Nr. 260, Leiterberg.<br />
7<br />
Das Land Baden-Württemberg, Amtliche Beschreibung nach<br />
Kreisen und Gemeinden, Bd. VII, Regierungsbezirk Tübingen,<br />
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1978, S. 830/31.<br />
8<br />
PfarrA Ostrach, Kapellenpflege Wangen, Auszug vom 8.6.1831<br />
bei den Jahresrechnungen.<br />
9<br />
Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen, Urbar des<br />
Amtes Wangen 1760.<br />
10<br />
J.A. Kraus, Ehemalige Maße und Gewichte im heutigen Hohenzollern<br />
und Umgebung, Hohenzollerische Jahreshefte 3, 1936,<br />
S.141-143.<br />
11<br />
Mündliche Information Schäfer, Wangen.<br />
12<br />
Ausschnitt aus der Karte »Ostrachtal«, StA Sigmaringen, Dep. 39,<br />
Karte 1, Aufnahme: Hauptstaatsarchiv Stuttgart.<br />
13<br />
Wie Anm. 5.<br />
14<br />
Wie Anm. 5, nach dem Lehenbuch der Abtei Reichenau, und<br />
K.A. Barack, Gallus Oheims Chronik von Reichenau, Stuttgart<br />
1866, S. 180.<br />
15<br />
Sebastian Locher, Regesten der Geschichte der Grafen von Veringen,<br />
1872, S. 46, und StA Sigmaringen, Dep. Fürstlich Hohenzollerisches<br />
Haus- und Domänenarchiv Sigmaringen, Bestand<br />
Kloster Wald, Urkunde 26, sowie Fürstenbergisches Urkundenbuch<br />
(= FUB) V., S. 102, Nr. 144 (1243).<br />
16<br />
FUB V., S. 124, Nr. 169 (1262) und Codex Diplomaticus Salemitanis,<br />
Urkundenbuch der Cistercienserabtei Salem, F. v. Weech,<br />
1883-1895, 3 Bde. (=CDS), hier CDSI., S.413, Nr. 371 (1262).<br />
17<br />
CDS II., S. 217-222, Nr. 600, hier S.219 (1279).<br />
18<br />
CDS II., S. 470^73, Nr. 889 und 890 (1294).<br />
19 StA Sigmaringen, Ho 158, Herrschaft Ostrach, Repert. Herberhold,<br />
S. 46, Nr. 182. (Schluß folgt)<br />
des Meisters von Meßkirch<br />
kombinieren, die W. Pfefferkorn in seinem Bericht über die<br />
kürzlich durchgeführten Grabungen auf Burg Falkenstein<br />
liefert 6 , die Tatsache nämlich, daß Gottfried Werner von<br />
Zimmern von 1516 bis 1526 Besitzer der Burg Falkenstein<br />
war, sie weitgehend auf den jetzigen Baubestand gebracht<br />
und wohl auch die Burgkapelle neu gebaut hat (den Turm<br />
über der Burgkapelle jedenfalls ließ er, wie die Zimmern'sche<br />
Chronik II 238 berichtet, abreißen), so dürfte wohl kaum<br />
mehr ein Zweifel bestehen, daß er, der in den Jahren 1516 bis<br />
1526 »viel auf Burg Falkenstein wohnte« 7 , damals auch den<br />
Auftrag für den Falkensteiner Altar erteilte und ihn hat<br />
aufstellen lassen. Die Entstehung des Falkensteiner Altars<br />
dürfte also auf die Zeit zwischen 1516 und 1526 - eher aber<br />
wohl gegen Ende dieses Zeitraums - zu datieren sein. In der<br />
Tat verbindet auch der Stil der Figuren und besonders<br />
Farbgebung und Gestaltung der Gewänder, sowie die Tatsache,<br />
daß noch viel Goldgrund verwendet ist, den Falkensteiner<br />
Altar mit den Malereien des Sigmaringer Hausaltärchens<br />
und spricht für eine Datierung beider Werke um die Mitte der<br />
20er Jahre. Chr. Salm setzt übrigens das Hausaltärchen auf<br />
1528, den Falkensteiner Altar auf »um 1525« 8 .<br />
Anmerkungen<br />
1 Der Wildensteiner Altar stammt in Wirklichkeit nicht von der Burg<br />
Wildenstein, einem Sitz der Grafen von Zimmern oberhalb Beuron,<br />
sondern aus dem Meßkircher Schloß.<br />
2 Vgl. H. Hofstätter, Die Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen<br />
Donaueschingen, München (Schnell und Steiner) 1 1980, S. 66. Der<br />
Falkensteiner Altar kam übrigens 1627 mit dem Erbe des Hauses<br />
Zimmern an die Fürstenberger. Hofstätter, S. 6.
3 Auch Chr. Salm, Kindlers Malerei Lexikon, Bd. 9, 1976, S. 105<br />
weist die Malereien des Hausaltärchens dem M.v.M. zu. Hingegen<br />
spricht W. Kaufhold, Das Fürstlich Hohenzollerische Museum<br />
in Sigmaringen, München (Schnell und Steiner) '1981, S. 14<br />
vorsichtig nur von »einem Meister des beginnenden Manierismus«.<br />
4 Vgl. Kaußold, S. 14.<br />
HERBERT RÄDLE<br />
Eine Kopie des Fuchs-Porträts von Jörg Ziegler<br />
Als Nachtrag zu dem in der Hohenzollerischen Heimat <strong>1989</strong>,<br />
S. 24 vorgestellten und besprochenen Porträt aus dem Ulmer<br />
Stadtmuseum (Abb. 1) sei noch auf ein Stück Nachwirkung<br />
dieses Bildes hingewiesen.<br />
Der hier in Abb. 2 wiedergegebene Holzschnitt erweist sich,<br />
wie leicht zu erkennen ist, als seitenverkehrte Kopie des<br />
Ulmer Aquarells von Jörg Ziegler. Er stammt von Tobias<br />
Stimmer (1539-1584), einem Sohn jenes Christoph Stimmer,<br />
der 1524 die heute noch vorhandenen Wappenscheiben des<br />
Pfullendorfer Rathauses geschaffen hat. Der Holzschnitt<br />
wurde erstmals 1587 in Nikolaus Reusners Porträtbuch<br />
veröffentlicht<br />
Anmerkung<br />
1 Genaue Ortsangabe: Nikolaus Reusner, Icones sive imagines<br />
virorum literis illustrium, Straßburg 1587, Neudruck Leipzig 1973,<br />
Fol.T. Zu den Pfullendorfer Wappenscheiben vgl. Manfred<br />
Abb. 1: Porträt des Humanisten und Botanikers Leonhard Fuchs<br />
(1501-1566) Mit IZ (= Jörg Ziegler) signiert, auf dem Ausschnitt<br />
nicht sichtbar. 1569 datiert. Ulm, Stadtarchiv, Nr. 1441. Aquarell auf<br />
Pergament.<br />
IRMGARD UND GÜNTER MERTZ<br />
Die Geschichte der Familie Molitor von Thalheim<br />
Die heute seit 5 Generationen in Thalheim ansässige Familie<br />
Molitor (lat. mola = Mühle, Molitor = der Müller) hat ihren<br />
Ursprung in Inneringen auf der Hochalb. Der nachweisbar<br />
Erste dieser Familie ist<br />
5 F. Rieffei, Das Fürstlich Hohenzollernsche Museum zu Sigmaringen,<br />
Gemälde und Bildwerke, Städel-Jahrbuch 1924, S. 65.<br />
6 W. Pfefferkorn, Die Burgruine Falkenstein an der Donau. Baugeschichte<br />
und bauliche Sicherung. In: Ztschr. f. Hohenzollerische<br />
Geschichte 22, 1986, 9^0.<br />
7 Zitat aus der Zimmern'schen Chronik II 238ß vil daselbs gewesen.<br />
8 Vgl. Kindlers Malerei Lexikon, Bd. 9, 1976, S. 102 ff.<br />
Hermann, in: Der Landkreis Sigmaringen, Sigmaringen 1981, S. 95<br />
(mit Abb.).<br />
LEONHAKDVS FVCHSIVS<br />
Mcdicus.<br />
Arttm ß me at camfptctas.muus ipje Galtnm<br />
St pLtnras.nouut en rxßo Dtofi oridet.<br />
H. D. LXVI.<br />
Abb. 2: Porträt des Leonhard Fuchs. Holzschnitt von Tobias<br />
Stimmer nach dem in Abb. 1 gezeigten Ulmer Aquarell von Jörg<br />
Ziegler. Aus: Reusner (1587)<br />
Christoph Molitori. ca. 1685 - nach 1746 ein Schulmaister<br />
ao Birgitta Wetacherin<br />
Christoph und Birgitta Molitor sind in den Inneringer Kirchenbüchern<br />
ausgewiesen als Eltern des 1741 die Ehe schlie-<br />
61
ßenden dortigen Schulmaisters, Meßners und Organisten<br />
Dominico Molitor. Alle Bemühungen zu klären, woher sie<br />
zuzogen, blieben bisher erfolglos. Das mag daran liegen, daß<br />
ihre Lebenszeit noch in das Ende des 17. Jahrhunderts fällt.<br />
Durch den 30 Jahre wütenden Krieg und 2 Pestwellen ist die<br />
Bevölkerung ausgeblutet. In Inneringen stehen viele Häuser<br />
leer, ihre Bewohner sind tot. Der Pfarrer Benckler klagt: »es<br />
ist kein Ölda, kein Wax, kein Batzen, sogar die Hostien<br />
khinden wir nit bezahlen«. Dieser Satz mag für die unvorstellbare<br />
Not jener Zeit charakteristisch sein, nur das zum<br />
Uberleben Notwendigste konnte wohl bezahlt werden.<br />
Erst 1745 wird Christoph I. in einem Brief des Jungnauer<br />
Obervogtes an den Oberamtmann erwähnt, er ist Pfründner,<br />
seinem Sohn dem Domenico seye das Amt des Schulmaisters<br />
und Meßners übertragen worden. Erwähnt sind zwei Söhne<br />
und eine noch unversorgte Tochter. Dominico und sein<br />
Bruder Franz Anton, Meßner und Organist zu Harthaußen,<br />
müssen für den Vater »und sein alterlebte Ehegattin« in deren<br />
Alter sorgen, da es keine irgendwie geartete Altersversorgung<br />
gibt. Das Schreiben ist ohne Datum ausgefertigt, aber von<br />
Vogt Jo. Fauler unterzeichnet, der das Amt von 1707 bis 1745<br />
innehatte.<br />
Dominicas Antonius Molitor, geb. 1713, gest.?<br />
Meßner, Schulmaister, Organist und Rathsschreiber<br />
OD 1740 Appollonia Traubin<br />
Im Trauregister in Inneringen ist die Eheschließung eingetragen,<br />
als Eltern Christoph I. und Birgitta Wetacherin. Das<br />
Geburtsdatum wurde aus der Einwohnerliste von 1778<br />
errechnet. Darin ist Dominico aufgeführt als Pfründner, 65<br />
Jahre alt »dermalen gewester Schulmaister zu Jungnau«. Die<br />
Anstellung eines guten Schulmaisters war von großer Wichtigkeit<br />
für die Gemeinden - so schreibt Herr Archivrat Maier<br />
in seiner Chronik des Ortes Inneringen. Daß dies zutrifft ist<br />
ersichtlich aus neueren Zahlen: 1770 waren in Deutschland<br />
höchstens 15% der Bevölkerung des Lesens und Schreibens<br />
kundig, 1800 betrug dieser Anteil ca. 25%.<br />
Am 28. Juni 1775 schreibt Dominicus an die Hofcanzley der<br />
Fürsten Fürstenberg zu Donauöschingen:<br />
Auf den an mich ergangenen Hochfürstlich gnädigst Herrschaftlichen<br />
befehl habe ich meine Eigenhändige Handschrift<br />
mit der Namens- und Ortsunterschrift Euer Hochfürstlichen<br />
Durchlaucht gehorsamst darlegen und hierbey mich zu<br />
höchst mildesten Hulden und Gnaden unterthänigst empfehlen<br />
sollen.<br />
Jungnau, 28 Juny 1775<br />
Unterthänigst treu gehorsamster Unterthan<br />
Dominicus Antonius Molitor<br />
Meßner, Schulmaister und<br />
Organist allda<br />
Die Inneringer Bücher geben keinen Aufschluß über das<br />
Todesdatum.<br />
Eingetragen sind zwei Kinder, Ernestus Antonius und Theresia.<br />
Theresia erhält 100 Gulden Mitgift und wandert - in einer<br />
großen Auswanderungswelle - nach Ungarn aus.<br />
Ernestus Antonius Molitor, geb. 19.4. 1741<br />
OD 1761 Magdalena Schmidin aus Neufra a.D.<br />
Wie in der Inneringer Chronik zu lesen ist, bedarf die<br />
Eheschließung bis ins 19. Jahrhundert der Zustimmung der<br />
Landesherrschaft. Magdalena Schmidin stammt aus Neufra<br />
a.D. und ist eines Schulmeisters Tochter. Erwähnt wird, daß<br />
sie im Geigenspiel »und anderen musices« sehr erfahren sey«,<br />
was darauf schließen läßt, daß auch sie schon unterrichtet hat,<br />
sie war also auch schon eine Lehrerin.<br />
Die Einbürgerungsakte der Magdalena Schmidin ist erhalten<br />
und lautet:<br />
... bin dahero der unterthänigst Meinung, daß die Magdalena<br />
Schmidin, welche 100 Gulden bares Gelt hereinziehet, gegen<br />
62<br />
Erlag von 10 Gulden in dahiesig'e Amts-Cassen und 8 Gulden<br />
der Inneringer Gemeind, woraus diese beholzet wird, dahier<br />
bürgerlich eingenommen werden könnte.«<br />
Zu hochfürstlichen höchsten Hulden mich<br />
unterthänigst empfehlend<br />
von mir dem Rath und Obervogt v. Lentz<br />
Act. Jungnau, 29.July 1761<br />
Am 31. Jänner 1792 schreibt Ernestus Antonius Molitor den<br />
vorgeschriebenen Schulbericht und beschwert sich darin u.a.<br />
daß die Ortsvorgesetzten (wohl entgegen der Vorschrift)...«<br />
nur einmal die Schule besuchet haben.« Wie sein Vater<br />
schreibt auch er an die Donaueschinger Canzley. Das Schreiben<br />
ist als Schönschriftprobe deklariert und enthält das<br />
Alphabet in großen und kleinen Buchstaben. Die Unterschrift<br />
lautet:<br />
Ernestus Antonius Molitor<br />
gebohren den 19. Aprill 1741<br />
Ludimoderator in Inneringen<br />
Im Einwohnerverzeichnis von 1778 ist die Familie aufge-<br />
Ernest Molitor ist alt 36 Jahr<br />
Franziskus Molitor ist alt 14 Jahr<br />
Christoph Molitor ist alt 5 Jahr<br />
Magdalena Schmidin, Mutter, ist a. 45 Jahr<br />
Barbara Molitorin ist alt 15 Jahr<br />
Magdalena Molitorin ist alt 13 Jahr<br />
Domenico Molitor, ein Pfründner ist alt 65<br />
Jahr, dermalen gewester Schulmaister zu<br />
Jungnau.<br />
Christoph Molitor II. geb. 26. 7. 1772<br />
Lehrer, Meßner und Organist<br />
1. Ehe 1794 Agathe Gindele v. Tafertsweiler<br />
Reichsprälatur Salem<br />
2. Ehe 1800 Anna Maria Glattus (auch Glattes)<br />
aus Inneringen<br />
3. Ehe 1815 Magdalena Birkle aus Inneringen<br />
Aus den ersten beiden Ehen hat Christoph Molitor 12<br />
Kinder, 6 überleben. Die erste Frau und mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
auch Anna Maria Glattus, die Mutter unseres<br />
Stammvaters Melchior, sterben bei der Geburt eines Kindes.<br />
Die Mütter- und Säuglingssterblichkeit ist noch sehr hoch in<br />
hohenzollerischen Landen. Erst Ignatz Semmelweis wird dies<br />
ändern. 1796 werden in Inneringen 36 Kinder geboren, und<br />
36 Kinder bis zu 7 Jahren sterben in diesem Jahr! Das<br />
Durchschnittsalter der Einwohner beträgt 40,5 Jahre.<br />
Was die Schule betrifft, so haben nur die beiden Orte<br />
Inneringen und Vilsingen schon ein eigenes Schulhaus, aber<br />
die Bauern weigern sich noch immer, den verhaßten Schulkreuzer,<br />
der pro Kind 25 Kr. pro Jahr beträgt, zu bezahlen.<br />
Christoph erhält von der Gemeinde<br />
für die Winterschule 54,10 Gulden<br />
für die Sommerschule 11,00 Gulden<br />
Von der Heiligenfabrik,<br />
¿er Kirchenverwaltung 194,21 Gulden<br />
Jahreseinkommen 259,31 Gulden<br />
Rechnet man noch Einnahmen aus der Tätigkeit als<br />
Rathschreiber und wahrscheinlich auch als »Gefälligkeitsschreiber«<br />
hinzu, so dürfte das Einkommen - verglichen mit<br />
anderen Bevölkerungsgruppen, nicht so schlecht gewesen<br />
sein, wie dies Spottlieder darstellen.<br />
Zum Vergleich: als Mozart starb, erhielt Konstanze Mozart<br />
für sich und die Kinder jährlich 200 Gulden vom Staat, wohl<br />
eine Art Ehrensold oder Rente.<br />
Am 17. April 1794 schreibt der Pfarrherr des Ortes, Baron<br />
Ignatz von Laßberg, der auch die Schulaufsicht führt:<br />
Daß ich bei der Endtprüfung den 12. des Monats die Schule
des Provisors Christophs Molitor durch alle Classen und in<br />
allen Gegenständen der Normal (gemeint ist die österreichische<br />
Normalschule) gut und vorschriftsmäßig unterrichtet<br />
befunden habe, wird ihme Molitor andurch bescheinet.«<br />
Der Provisor Molitor wohnte bei dem Unterschultheißen<br />
Ayß, der für die Logie des Provisors von der Gemeinde<br />
jährlich 4 Gulden 14 Kreutzer erhält.<br />
1827 verkauft Christoph Molitor sein Haus, Wert 350<br />
Gulden.<br />
Melchior Molitor, geb. 3.1. 1812<br />
Lehrer gest. ?<br />
CD 13. 10. 1835 Anna Maria Ott<br />
Tochter des Sonnenwirtes Johannes Ott<br />
und seiner Frau Katharina geb. Wiedmer<br />
Melchior ist in den Inneringer und Thalheimer Kirchenbüchern<br />
als Lehrer der 2. Klaßenabtheilung bezeichnet, während<br />
zuvor die Begriffe Schulmagister, Schulmaister, Schulmeister<br />
verwendet wurden.<br />
1832 kauft Melchior, erst 21 Jahre alt von seiner künftigen<br />
Schwiegermutter, der früh verwitweten Katharina Wiedmer<br />
ein Haus nebst Scheuer, Garten, Platz für 800 Gulden.<br />
Am 11. Oktober 1832 wird Melchior Molitor von der für die<br />
Prüfung des Schulkandidaten bestellten Commission geprüft.<br />
Die Prüfung ist öffentlich. Er wird hinsichtlich seiner Kenntnisse<br />
in den Lehrgegenständen sehr gut und in der Musik<br />
vorzüglich befunden. Später rühmt die Gemeindeverwaltung<br />
Gammertingen, wo er drei Jahre als Lehrer wirkte, seinen<br />
sanften Umgang mit den Kindern. Dies ist um so erstaunlicher,<br />
als noch lange Zeit nach seinem Wirken - wie dies im<br />
Ichenhausener Schufmuseum des Bayerischen Nationalmuseums<br />
so schön plastisch dargestellt ist - Strafen wie das Kien<br />
auf dem Holzscheit an der Tagesordnung waren.<br />
Todestag- und Ort Melchior Molitors konnten wir noch<br />
nicht ausfindig machen.<br />
Hermann Molitor, geb. 15.5. 1836 in Inneringen<br />
Kaufmann, gest. 31.3. 1903 in Thalheim<br />
00 1862 Walburga Birkle<br />
verläßt den in 5 Generationen vom Vater auf den Sohn<br />
übertragenen Beruf des Schulmeisters. Gesichert ist, daß er<br />
im Thalheimer Kirchenchor schon als Jugendlicher mitgesungen<br />
hat, dieser Chor wurde von seinem Vater Melchior<br />
geleitet, der auch als Lehrer am Ort wirkte.<br />
Die in dieser Zeit beginnenden bürgerlichen Freiheiten, so<br />
das Recht auf freie Niederlassung - bringen es mit sich, daß<br />
wir über die »jüngeren Generationen« weniger wissen als<br />
über die unter strenger obrigkeitlicher Überwachung lebenden<br />
und wirkenden früheren Mitglieder der Familie.<br />
Adolf Molitor, geb. 12.9. 1865 in Inneringen<br />
Landwirt, gest. 9. 8. 1946 in Thalheim<br />
00 18.7. 1893<br />
Maria Herzog<br />
900 Jahre Benediktinerabtei Zwiefalten<br />
Am Fest Mariae Geburt 1089 kam eine Schar Hirsauer<br />
Mönche ins Tal der »zwiefältigen Aach«, um ein neues<br />
Kloster zu gründen. Genau 714 Jahre bestand dieses Kloster,<br />
dessen geistliche und geistige Ausstrahlung wichtiger und<br />
größer war, als die Reichweite seines kleinen weltlichen<br />
Territoriums.<br />
Im September 1802 wurde das Kloster von Württemberg<br />
besetzt. Kaum ein Jahr später wurden die Mönche aus dem<br />
Kloster vertrieben und die Klosterkirche für den Gottesdienst<br />
geschlossen. 1812 bekamen die großen, leeren Klostergebäude<br />
eine neue Bestimmung. Die Insassen des »Tollhau-<br />
Der Sohn<br />
Ernst Molitor, geb. 27.9. 1908 in Thalheim<br />
Flaschnermeister und Landwirt<br />
und dessen Nachkommen leben in Thahlheim, so daß die<br />
Geschichte der Familie Molitor von Thahlheim einschließlich<br />
der heute Erwachsenen 10 Generationen umfaßt.<br />
MARIA LEIBOLD<br />
Em Janner<br />
Pfoschta hauet weiße Kappa,<br />
übern Wald nei schreiet Grappa,<br />
dr Schnailuft döberet oms Haus<br />
und blooset älle Wenkel aus.<br />
Hähl isch duß, s'ischt kalt und s'gauret,<br />
d'Nahna schtrickt, dr Nehne knauret,<br />
's Fuir em Ofa knischteret laut,<br />
em Ofaraihrle sudderet s'Kraut.<br />
Und dr Behnelada gläbberet,<br />
's hiecht so laut, daß Bas vrläbberet<br />
ihren guata Malzkaffee,<br />
über's blüschne Kanabee.<br />
Mit em Baahschlitt fehrt dr Naaze,<br />
überm Bach deann schtreckt dr Blaaze<br />
e dr Schuir sei Briaz mit Schtrauh,<br />
denn wenns ausgeeng noch wärs mau.<br />
Ällz goht jetz a bissle gschtäter,<br />
denn dear Janner ischt a Heeter,<br />
und dia Kelte duat oim waih,<br />
dia Räuhe und dia Häufa Schnai.<br />
Maudreg duat ma gudderlocha,<br />
's schneit so aane und bis zwocha<br />
dreibts e d'Bööm da aischta Saft,<br />
d'Sonn hot au schau weng a Kraft.<br />
Druckt dia Werme nei en Boda,<br />
und daß d'Wenterfruucht duat groota<br />
sorgt dr Baschtle und dr Fabe,<br />
und em Wenter nimmts sei Habe<br />
doch oinaweag bald na da Bach,<br />
drom schleif noh mol und juck und lach.<br />
ses« Ludwigsburg wurden nach Zwiefalten verlegt. Aus der<br />
Bewahranstalt und späteren Heilanstalt entwickelte sich im<br />
Lauf der Jahrzehnte ein modernes Psychiatrisches Krankenhaus.<br />
Seit 1970 wurden in den Krankenhausgebäuden 25<br />
Millionen Mark verbaut. Für die Klosterkirche, die seit 1974<br />
restauriert wurde, wandte das Land 8 Millionen auf.<br />
Schon im Hinblick auf das kommende 900jährige Jubiläum<br />
erschien 1986 das Buch »Kloster Zwiefalten« unter der<br />
Redaktion von Hermann Josef Pretsch. Es enthält Beiträge<br />
zur Kloster- und Krankenhausgeschichte, zahlreiche, zum<br />
großen Teil farbige Abbildungen illustrieren den Text.<br />
63
Verlag: <strong>Hohenzollerischer</strong> <strong>Geschichtsverein</strong><br />
Karlstraße 3, 7480 Sigmaringen<br />
Festprogramm<br />
M 3828 F<br />
Postvertriebsstück. Gebühr bezahlt.<br />
Für das Jubiläumsjahr <strong>1989</strong> hat Hermann Pretsch, katholischer<br />
Krankenhausseelsorger, eine umfangreiche Festschrift<br />
vorbereitet. In einer Feier wurde das Buch am 21. Mai <strong>1989</strong><br />
der Öffentlichkeit vorgestellt. Gleichzeitig wurde im<br />
Klostergebäude eine Ausstellung zur Klostergeschichte<br />
eröffnet. Dies war der Auftakt zu zahlreichen Veranstaltungen<br />
im Jubiläumsjahr, die ihren Höhepunkt in der ersten<br />
Septemberwoche hatten.<br />
Anläßlich der Jahrestagung der Bayerischen Benediktinerakademie<br />
wurde am 8. Oktober <strong>1989</strong> im Münster der erste<br />
Benediktinergottesdienst seit der Säkularisation gefeiert.<br />
Die Festschrift<br />
Wie schon erwähnt, ist Hermann Josef Pretsch Herausgeber<br />
der Festschrift und es muß gesagt werden, daß es ohne die<br />
unermüdliche Arbeit von Herrn Pretsch keine Jubiläumsfeier<br />
in dieser Form gegeben hätte. Er selbst hat drei Beiträge für<br />
die Festschrift verfaßt: »Adel und Kirche, Verwandtschaftliche<br />
Verhältnisse in Zusammenhang mit der Stiftung des<br />
Klosters Zwiefalten.« - »Das Ende der Hirsauer Reformbewegung,<br />
Hildegard von Bingen und die Zisterzienser, Fallbeispiel<br />
Zwiefalten«. Als dritten Beitrag schrieb er die »Baugeschichte<br />
des Klosters Zwiefalten in der Zeit von 1659 bis 1716«.<br />
Wilfried Setzier berichtet über »die Entwicklung vom Römischen<br />
Kloster« bis zum »Sonderfall« im Reich (1089-1570).<br />
Außerdem bringt er eine Liste der Zwiefalter Äbte.<br />
Uber ein seltsames Kapitel berichtet Eberhard Fritz »Zwiefalten<br />
und Württemberg in Konkurrenz um die Konfession<br />
der Untertanen. Kirchenpolitik in den Pfarreien Neuhausen,<br />
Ödenwaldstetten, Metzingen, Genkingen und Willmandingen<br />
im Spiegel württembergischer Quellen und Geschichtsschreibung.«<br />
Ein Beitrag von Franz Quartal: »Kloster Zwiefalten zwischen<br />
Dreißigjährigem Krieg und Säkularisation. Monastisches<br />
Leben und Selbstverständnis im 6. und 7. Saeculum der Abtei.«<br />
Weitere Beiträge:<br />
Rainer Joos, »Zwiefalten und das Kloster Kladrau (Kladruby)<br />
in Böhmen.« Herrad Spilling, »Reinhard von Munderkingen<br />
als Schreiber und Lehrer.« Heribert Hummel, »Eine Zwiefalter<br />
Bibliotheksgeschichte.« Reinhold Halder, »Zur Bau- und<br />
Kunstgeschichte des alten Zwiefalter Münsters und<br />
HOHENZOLLERISCHE HEIMAT<br />
hrsggbn. vom Hohenz. <strong>Geschichtsverein</strong>.<br />
ISSN 0018-3253<br />
Die Zeitschrift »Hohenzollerische Heimat«<br />
ist eine heimatkundliche Zeitschrift. Sie will<br />
besonders die Bevölkerung in Hohenzollern<br />
und der angrenzenden Landesteile mit der<br />
Geschichte ihrer Heimat vertraut machen. Sie<br />
bringt neben fachhistorischen auch populär<br />
gehaltene Beiträge.<br />
Bezugspreis: 8.00 DM jährlich.<br />
Konto der »Hohenzollerischen Heimat«:<br />
803843 Hohenz. Landesbank Sigmaringen<br />
(BLZ 653 51050).<br />
Druck:<br />
M. Liehners Hofbuchdruckerei GmbH & Co.,<br />
7480 Sigmaringen, Karlstraße 10.<br />
64<br />
Die Autoren dieser Nummer:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth<br />
Eichertstraße 6<br />
7487 Gammertingen<br />
Walter Kempe<br />
Silcherstraße 11, 7965 Ostrach<br />
Pfr. Johann Adam Kraus<br />
Badstraße 8<br />
7800 Freiburg-Littenweiler<br />
Klosters.« Konrad Küster, »Zwiefalter Klostermusik und<br />
oberschwäbische Musikgeschichte.« Walter Frei, »Liebe zu<br />
den Wissenschaften und ununterbrochene Fürsorge für die<br />
studierende Jugend, Zur Schulgeschichte des Klosters Zwiefalten.«<br />
Walter Frei, »Das Zwiefalter Schul- und Klostertheater<br />
in der Barockzeit. Neue Erkenntnisse zur Theaterpflege<br />
im Kloster Zwiefalten und an seinen Schulen im 17. und<br />
18.Jahrhundert.« Günter Kolb, »Barockbauten im Gebiet<br />
der Abtei Zwiefalten«. Stefan Kummer, »Architektur und<br />
Dekoration des Zwiefalter Münsterraumes Gesamtkunstwerk<br />
oder Ensemble.« Klaus Könner, »Das Schicksal der<br />
Münsterausstattung nach der Säkularisation. Zur verlorenen<br />
Hauptorgel des Joseph Martin von Hayingen.« Irmtraut Betz<br />
- Wischnath, »Das Oberamt Zwiefalten (1803-1810).« Walter<br />
Meyberg, »Die barocke Klosteranlage in Zwiefalten, Der<br />
Baubestand zur Zeit der Säkularisation und die Veränderungen<br />
im 19. und 20. Jahrhundert.<br />
Das großzügig mit Abbildungen ausgestattete Buch erschien<br />
in der Süddeutschen Verlagsanstalt Ulm und kostet DM 48,-.<br />
WERNER BECK<br />
Karl-Heinz Lutz<br />
In der Breite 59, 7801 Umkirch<br />
Irmgard und Günter Merz<br />
Lichtenweg 1, 8038 Gröbenzell<br />
Dr. Herbert Rädle<br />
Veit-Jung-Straße 13a, 8430 Neumarkt<br />
Jürgen Schmidt, Oberforstrat<br />
Überlinger Straße 1, 7798 Pfullendorf<br />
Orts- und Familienchronik Boll<br />
Nach jahrelanger Arbeit hat der Hechinger Werner Beck jetzt<br />
die »Orts- und Familienchronik Boll« veröffentlicht. Mitautor<br />
ist der im letzten Jahr verstorbene Anton Hoch. Das jetzt<br />
erschienene Buch hat einen Umfang von 400 Seiten und<br />
enthält 180 zum Teil sehr alte Fotos. Die frühesten Aufnahmen<br />
stammen aus der Zeit um 1870. Viele Fotos sind mit<br />
Angabe der abgebildeten Personen abgedruckt. Allein die 17<br />
Schulklassenfotos aus drei Generationen ab 1890, viele mit<br />
den Namen der Schulkinder, stellen einen besonderen Wert<br />
dar. 70 Seiten Ortschronik und 200 Seiten Häuserbeschreibung<br />
vermitteln einen tiefen Einblick in das Boller Dorfleben<br />
im Lauf der Jahrhunderte. Der Verkauf findet über die<br />
Ortschaftsverwaltungen Boll und Stetten sowie die Filiale der<br />
Raiffeisenbank Boll und die Filiale der Kreissparkasse Boll<br />
statt. Auch die Bankfilialen der umliegenden Gemeinden<br />
halten einige Exemplare bereit. Ferner kann die Chronik in<br />
den Boller Gasthäusern »Löwen«, »Hirsch« und »Kaiser«<br />
bestellt oder beim Herausgeber Werner Beck, In den Schelmenäckern<br />
17 in Hechingen, Telefon 07471/4370, direkt<br />
bezogen werden. Preis DM 78,-.<br />
Karl Werner Steim<br />
Wegscheiderstr. 26<br />
7940 Riedlingen<br />
Schriftleitung:<br />
Dr. med. Herbert Burkarth,<br />
7487 Gammertingen Telefon 07574/4211<br />
Die mit Namen versehenen Artikel geben die<br />
persönliche Meinung der Verfasser wieder;<br />
diese zeichnen für den Inhalt der Beiträge<br />
verantwortlich. Mitteilungen der Schriftleitung<br />
sind als solche gekennzeichnet.<br />
Manuskripte und Besprechungsexemplare<br />
werden an die Adresse des Schriftleiters erbeten.<br />
Wir bitten unsere Leser, die »Hohenzollerische<br />
Heimat« weiter zu empfehlen.