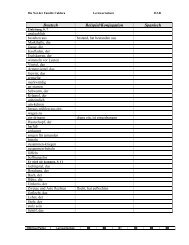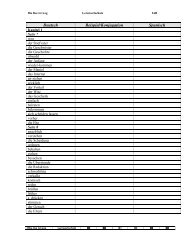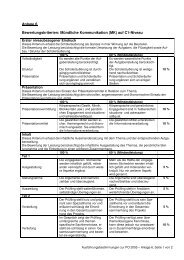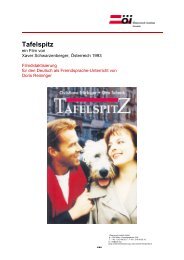Joschka Fischer Die rot-grünen Jahre | Michael Ondaatje Divisadero ...
Joschka Fischer Die rot-grünen Jahre | Michael Ondaatje Divisadero ...
Joschka Fischer Die rot-grünen Jahre | Michael Ondaatje Divisadero ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4. November 2007<br />
<strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong> <strong>Die</strong> <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong> <strong>Jahre</strong> | <strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong> <strong>Divisadero</strong> |<br />
Anne Applebaum Essay über die russische Revolution und westliche<br />
Intellektuelle | Paul Stauffer bespricht die neue Saly-Mayer-Biografie |<br />
Rezensionen von Ralph Dutli, Angelika Overath, Urs Altermatt und vielen<br />
anderen | Charles Lewinsky Meine Zitatenlese
Inhalt<br />
<strong>Jahre</strong>stage sind<br />
Geburtstage<br />
der Geschichte<br />
4. November 2007<br />
�������������������� <strong>Die</strong> <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong> <strong>Jahre</strong> | ���������������� <strong>Divisadero</strong> |<br />
�������������� Essay über die russische Revolution und westliche<br />
Intellektuelle | Paul Stauffer bespricht die neue ���������������������|<br />
Rezensionen von Ralph Dutli, Angelika Overath, Urs Altermatt und vielen<br />
anderen | ���������������� Meine Zitatenlese<br />
<strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong><br />
(Seite 18).<br />
Illustration von<br />
André Carrilho<br />
Belletristik<br />
4 <strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>: <strong>Divisadero</strong><br />
Von Judith Kuckart<br />
6 Warlam Schalamow: Durch den Schnee<br />
Manfred Sapper, Volker Weichsel,<br />
Andrea Huterer: Das Lager schreiben<br />
Von Ralph Dutli<br />
7 Regina Ullmann: <strong>Die</strong> Landstrasse<br />
Von <strong>Michael</strong> Braun<br />
Uta Grosenick und Caspar H.Schübbe:<br />
China Artbook<br />
Von Gerhard Mack<br />
8 <strong>Michael</strong> Lentz: Pazifik Exil<br />
Von Paul Jandl<br />
9 Katja Lange-Müller: Böse Schafe<br />
Von Sieglinde Geisel<br />
10 Khaled Hosseini: Tausend strahlende Sonnen<br />
Von Susanne Schanda<br />
Zoe Ferraris: <strong>Die</strong> letzte Sure<br />
Von Pia Horlacher<br />
11 Annemarie Schwarzenbach: Lorenz Saladin<br />
Von Angelika Overath<br />
Kurzkritiken Belletristik<br />
9 Bernadette Calonego: Unter dunklen Wassern<br />
Von Regula Freuler<br />
Adolf Endler: Krähenüberkrächzte Rolltreppe<br />
Von Manfred Papst<br />
Jurek Becker: Mein Vater, die Deutschen<br />
und ich<br />
Von Manfred Papst<br />
Do<strong>rot</strong>a Masłowska: <strong>Die</strong> Reiherkönigin<br />
Von Regula Freuler<br />
Essay<br />
12 Propaganda und Realität<br />
Von Anne Applebaum<br />
Kolumne<br />
15 Charles Lewinsky<br />
Das Zitat von Irmgard Keun<br />
<strong>Jahre</strong>stage sind Geburtstage der Geschichte. Sie dienen der Vergegenwärtigung<br />
historischer Prozesse. Am 7.November jährt sich zum<br />
90.Mal der Beginn der russischen Revolution. <strong>Die</strong> amerikanische<br />
Historikerin Anne Applebaum nimmt für uns das Ereignis von 1917<br />
zum Anlass, die doppelzüngige Haltung der Bolschewiken und ihrer<br />
intellektuellen Sympathisanten im Westen zu analysieren. Dezidiert<br />
ruft die Pulitzer-Preisträgerin zu wissenschaftlicher und politischer<br />
Redlichkeit auf – nicht nur gegenüber geschichtlichen Fakten, sondern<br />
auch gegenüber der Demokratie-Scheinheiligkeit Putins und anderer<br />
Machthaber. Lesen Sie dazu Applebaums Essay (Seite 12).<br />
Dass sich in Sowjetrussland statt der versprochenen rosigen Zukunft<br />
ein Abgrund von Terror, Zwangsarbeit und Tod auftat, zeigt das im<br />
Westen noch kaum bekannte Werk von Warlam Schalamow. Ralph Dutli<br />
stellt den literarischen Antipoden Solschenizyns vor (Seite 6).<br />
Zu den in der Schweiz vergessenen Persönlichkeiten gehört auch der<br />
St.Galler Kaufmann Saly Mayer. Paul Stauffer rezensiert die Biografie<br />
dieses Präsidenten der Schweizer Juden, der in schwieriger Zeit mit<br />
der vielgeschmähten Fremdenpolizei zusammengearbeitet und später<br />
1700 KZ-Häftlinge gerettet hat (Seite 16).<br />
Wir wünschen eine interessante, erkenntnisreiche Lektüre. Urs Rauber<br />
Kurzkritiken Sachbuch<br />
15 Heidi Witzig: Wie kluge Frauen alt werden<br />
Von Kathrin Meier-Rust<br />
Roderich Ptak: <strong>Die</strong> maritime Seidenstrasse<br />
Von Geneviève Lüscher<br />
Heiko Haumann: <strong>Die</strong> Russische Revolution<br />
1917<br />
Von Urs Rauber<br />
Harald Bergsdorf: <strong>Die</strong> neue NPD<br />
Von Kathrin Meier-Rust<br />
Sachbuch<br />
16 Hanna Zweig-Strauss: Saly Mayer, 1882–1950<br />
Von Paul Stauffer<br />
18 <strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong>: <strong>Die</strong> <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Jürgen Schreiber: Meine <strong>Jahre</strong> mit <strong>Joschka</strong><br />
Von Gerd Kolbe<br />
19 Willi Winkler: <strong>Die</strong> Geschichte der RAF<br />
Von Heribert Seifert<br />
Peter Zihlmann: Dr. Guido A.Zäch<br />
Von Markus Häfliger<br />
20 Paul Widmer: <strong>Die</strong> Schweiz als Sonderfall<br />
Von Urs Rauber<br />
21 Amin Jaffer: Made for Maharajas<br />
Von Jost Auf der Maur<br />
22 Adam Hochschild: Sprengt die Ketten<br />
Von Ina Boesch<br />
AP<br />
Anne Applebaum, Historikerin und Publizistin.<br />
23 Rolf Meier: Briefe aus Abessinien<br />
Von Geneviève Lüscher<br />
Eberhard Rathgeb: Schwieriges Glück<br />
Von Daniel Puntas Bernet<br />
24 Anonymus: Wohin mit Vater?<br />
Christine Eichel: <strong>Die</strong> Liebespflicht<br />
Cyrille Offermans: Warum sollte ich meine<br />
demente Mutter belügen?<br />
Von Simone von Büren<br />
25 Silvio Bircher: Wahlkarussell Bundeshaus<br />
Von Urs Altermatt<br />
Wolfgang Sofsky: Verteidigung des Privaten<br />
Von Thomas Köster<br />
26 Beatrix Mesmer: Staatsbürgerinnen ohne<br />
Stimmrecht<br />
Von Tobias Kaestli<br />
Das amerikanische Buch: Journals 1952–<br />
2000 von Arthur M.Schlesinger<br />
Von Andreas Mink<br />
Agenda<br />
27 Yann-Brice Dherbier: Maria Callas<br />
Von Manfred Papst<br />
Bestseller November 2007<br />
Belletristik und Sachbuch<br />
Agenda November 2007<br />
Veranstaltungshinweise<br />
Chefredaktion Felix E. Müller (fem.) Redaktion Urs Rauber (ura.), Regula Freuler (ruf.), Geneviève Lüscher (glü.), Kathrin Meier-Rust (kmr.), Manfred Papst (pap.) Ständige Mitarbeit Urs Altermatt,<br />
Urs Bitterli, Corina Caduff, Andreas Isenschmid, Manfred Koch, Judith Kuckart, Gunhild Kübler, Charles Lewinsky, Beatrix Mesmer, Klara Obermüller, Angelika Overath Produktion Eveline Roth,<br />
Hans Peter Hösli (Art-Director), Swilly Eggenschwiler (Bildredaktion), Carmen Casty (Layout), Marta Casulleras, Irmgard Matthes, <strong>Michael</strong> Nägeli (Korrektorat) Adresse NZZ am Sonntag,<br />
«Bücher am Sonntag», Postfach, 8021 Zürich. Telefon 044 258 11 11, Fax 044 26170 70, E-Mail: redaktion.sonntag@nzz.ch<br />
BETTMANN / CORBIS<br />
John F. Kennedy und Arthur M. Schlesinger (rechts).<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 3
Belletristik<br />
Roman Mit Büchern wie «Der englische Patient» hat <strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong><br />
ein Millionenpublikum gewonnen. In «<strong>Divisadero</strong>», der Geschichte<br />
von drei Waisenkindern, begeistert er mit der Schönheit seiner Sprache<br />
Wenn Liebende<br />
auseinandergeprügelt<br />
werden<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>: <strong>Divisadero</strong>. Aus dem<br />
Englischen von Melanie Walz. Hanser,<br />
München 2007. 280 Seiten, Fr. 38.70.<br />
Von Judith Kuckart<br />
So steht es im Buch: Im Norden Kaliforniens<br />
auf einer Landstrasse bei Nicasio<br />
liegt ein Farmhaus, das man im Film<br />
oder im Traum schon einmal gesehen<br />
haben mag. Der Farmer kommt mit der<br />
neugeborenen Tochter Anna allein aus<br />
dem Krankenhaus zurück. Seine Frau ist<br />
im Kindbett gestorben wie die Mutter<br />
der kleinen Claire. Also hat er Claire,<br />
den Wechselbalg, auch gleich mitgenommen.<br />
Jetzt ist er Witwer mit drei<br />
Kindern, denn daheim wartet noch der<br />
Nachbarssohn Cooper, Vollwaise. Er<br />
war vier, als er als Einziger ein Gewaltverbrechen<br />
überlebte, das seine Familie<br />
auslöschte. Er wird noch ein paarmal<br />
überleben müssen. Beim ersten Mal<br />
werden es die Schläge des alten Farmers<br />
sein. Später wird es eine Gang von professionellen<br />
Spielern sein, die ihm das<br />
Gedächtnis aus dem Kopf schlägt, so<br />
dass er nur noch weiss, wie man Auto<br />
fährt. Und noch viel später, wenn wir als<br />
Leser nicht mehr bei ihm sind, wird er<br />
wohl eines ähnlich gewaltsamen Todes<br />
sterben. So steht es im Buch, auch wenn<br />
es nicht drinsteht.<br />
Alle Geschichten, die in «<strong>Divisadero</strong>»<br />
erzählt werden, gehören irgendwie<br />
zusammen. Was diese Welten in ihrem<br />
Innersten zusammenhält, ist die Schönheit<br />
von <strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>s Sprache. Sie<br />
ist so kräftig und schön wie das Gesicht<br />
von Cooper, in das sich seine Schwester<br />
Anna verliebt, die nicht seine richtige<br />
Schwester ist. Coopers Gesicht hat auf<br />
Fotos keine deutlichen Züge, keine Physiognomie,<br />
die <strong>Ondaatje</strong> in feste Sätze<br />
gefasst hätte. Cooper bleibt ein schemenhaftes<br />
Spiegelbild im Fensterglas<br />
oder ein Schatten auf dem Rasen.<br />
So ist es auch mit <strong>Ondaatje</strong>s Sprache.<br />
<strong>Die</strong> Geschwister Anna und Cooper, die<br />
mit Claire zusammen ein dreiteiliger<br />
«Paravent» sind, jeder für sich eine<br />
Einheit, doch mit den anderen beiden<br />
zusammen ein Ding voller Überraschungen<br />
und Schattierungen, diese<br />
4 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
drei erwischt der Alte bei der Liebe.<br />
Er ist kein moderner, kein zärtlicher,<br />
aber ein schützender Vater. Nur im Niemandsland<br />
zwischen Müdigkeit und<br />
Einschlafen hat er manchmal am Abend<br />
die drei, als sie noch klein waren, an<br />
sich gedrückt. Da lagen sie wie Hündchen<br />
auf seinem karierten Hemd. Was<br />
zwischen den Menschen und ihrem<br />
Zuviel an frühen Verletzungen passiert,<br />
erzählen die Körper, die sich in einer<br />
Notgemeinschaft zusammengeschlossen<br />
haben und denen <strong>Ondaatje</strong> auch<br />
seine Sprache gibt. Eine Begleitung aus<br />
Wörtern, die den Leser näher an das<br />
Geheimnis bringt.<br />
Montagearbeit am Selbst<br />
Eines Tages schlägt die Vertrautheit zwischen<br />
den Geschwistern um in Liebe,<br />
schneller als sie es selber bemerken.<br />
Schuld ist der warme Regen. Es regnet,<br />
als Anna Cooper in seiner Rückzugshütte<br />
auf dem Berggrat, den man von der<br />
Farm aus gerade noch sieht, besuchen<br />
geht. Der Regen macht melancholisch<br />
und weckt die schmerzliche Lust auf<br />
Liebe, die einen anfällt, wenn Glücklichseinwollen<br />
und Traurigseinmüssen<br />
streiten, bis man selber nicht mehr<br />
Mensch ist, sondern Wetter. Als der Alte<br />
die beiden erwischt, schlägt er Cooper<br />
die Seele taub, den Körper fast tot, und<br />
Anna rammt dem rasenden Vatertier<br />
eine Glasscherbe tief in den Rücken,<br />
was ihm für immer das Herz bricht.<br />
<strong>Die</strong> Szene ist anderthalb Seiten kurz,<br />
sie hat mich verschreckt, aber ebenso<br />
mit Anna, Cooper, Claire und dem Alten<br />
für den Rest des Buches verbunden.<br />
Man möchte mit ihnen bis zur letzten<br />
Seite und noch weiter gehen. Doch während<br />
<strong>Ondaatje</strong> seine Geschichte <strong>Divisadero</strong><br />
– was auf Spanisch «getrennt sein»<br />
und «aus der Ferne betrachtet» heisst<br />
– fortschreibt, verliere ich die eine oder<br />
andere Figur aus den Augen. Er lässt die<br />
frühen Fäden fallen und springt hinein<br />
in eine andere Geschichte, hinüber nach<br />
Frankreich, zu anderen Schicksalen.<br />
Mir ist schon klar, so eine Komposition,<br />
die diese biografische Wehmut bei<br />
mir anrichten kann, schreibt sich nicht<br />
schlicht an einem Strang entlang fort,<br />
sie will Schicksal einholen und muss<br />
sich dafür der Sprache ausliefern; sie<br />
muss kurze Momente, die aufblitzen<br />
und absehbar noch nirgendwohin gehören,<br />
dafür aber um so kostbarer sind,<br />
zulassen und hinschreiben. Sie werden<br />
schon zu etwas führen.<br />
Schon klar, das Netz ist dicht, und<br />
will man nur einigermassen einen Eindruck<br />
von seiner Dichte erfassen, muss<br />
man mit jedem Satz, in dem es um etwas<br />
geht, sagen: Es geht auch um etwas<br />
anderes. Nach jedem Komma wartet<br />
die nächste Überraschung. T<strong>rot</strong>zdem,<br />
ich habe erst Anna und dann Cooper<br />
vermisst, während ich weiterlas. Als ich<br />
Anna wiedertraf, war sie längst Literaturwissenschafterin<br />
im ländlichen<br />
Frankreich geworden. Da hatte ich ihre<br />
Melodie verloren. Ich erkannte Anna<br />
nicht gleich. War aus dem faszinierenden<br />
Mädchen eine langweilige Frau<br />
geworden? War sie nicht doch Claire?<br />
Nachdem der Alte die Liebenden<br />
Cooper und Anna auseinandergeprügelt<br />
und so aus der wichtigsten Zeit<br />
ihres Lebens vertrieben hatte, floh<br />
Anna, um viele <strong>Jahre</strong> später in der<br />
Gegend von Toulouse und auf den<br />
Spuren eines Dichters namens Lucien<br />
Segura, berühmt zu Beginn des vorigen<br />
Jahrhunderts, anzukommen, wo sie dessen<br />
Lebensspuren zu einem Bild zusammenschiebt<br />
und bei dieser Montagearbeit<br />
sich selber ausbessert. Sie befragt<br />
sich selber, ohne laut Antwort zu geben,<br />
bis eines Tages ein nächster Mann über<br />
die Wiese herüber in ihre Einsamkeit<br />
hineingeschlendert kommt. Rafael ist<br />
ein Sänger, ein Zigeuner mit Kräutern in<br />
den Hosentaschen. Er fängt an zu erzählen.<br />
Sie fängt an zu erzählen. Erzählen<br />
heilt. Wie beim Schneiden eines Films<br />
entwickelt sich die eigentliche Eloquenz<br />
dieser Geschichte im Schnitt.<br />
Verzaubernd<br />
Lege ich das Buch weg, schneide ich mir<br />
das Gelesene noch einmal neu zusammen,<br />
ermutigt von der Haltung das<br />
Autors, dass sowieso alles anders kommt,<br />
im Leben, im Buch, bei Anna, beim Sänger.<br />
Bei allen. Alle leben so. Wie Anna<br />
und Rafael einander davon erzählen, ist<br />
es dem Leben angemessen. Es ist das<br />
Erzählen der Liebenden, die sie – wie<br />
B. GARCIN GASSER / OPALE
Bestsellerautor<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>,<br />
64, ist ein brillanter<br />
Stimmen-Arrangeur.<br />
alle Liebenden es tun – im Dunkeln das<br />
Dunkel neu zusammenkleben lässt. An<br />
den Schnittstellen, wo Anna und Rafael<br />
Verletzungen wie Filmschnipsel erzählend<br />
aneinanderdrücken, finden auch<br />
vergangene Lieben wieder statt.<br />
Cooper ist auch geflohen und ewig<br />
auf der Flucht geblieben, als Falschspieler,<br />
der mit dem Glück und mit Gott<br />
beim Pokern hadert. Unsichtbar begleitet<br />
ihn auf dieser Irrfahrt der Alte, der<br />
ihn so zurechtschlug. Denn nicht nur<br />
das Herz Annas, auch das versteinerte<br />
des Alten ist in Cooper mit aufgehoben.<br />
Jeder Mensch ist er selber und der, der<br />
er nicht geworden ist, und dazu noch all<br />
die anderen, die im Lauf seines Lebens<br />
bei ihm eingezogen sind. So steht es im<br />
Buch. <strong>Die</strong>se menschliche Ambivalenz,<br />
diese ständige Unsicherheit, wer das<br />
wohl heute ist, der einem da mit dem<br />
Gesicht von gestern begegnet, macht ein<br />
Buch wie «<strong>Divisadero</strong>» so spannend. Es<br />
verzaubert.<br />
Choreograph der Gefühle<br />
Wer fragt da noch nach der Geschichte?<br />
Ich frage nach ihr. Ich frage nach<br />
Claire. Sie bleibt in der Nähe des Alten,<br />
vor dem die anderen beiden flohen. Sie<br />
lernt etwas Vernünftiges, aber lernt es<br />
nicht, vernünftig mit jenem Moment<br />
umzu gehen, an dem ihre herkunftslose,<br />
aber einander so zugewandte Familie<br />
zerbrach. Einmal noch trifft sie Cooper<br />
zufällig wieder. Beide sind sie auf<br />
Geschäftsreise, er in Richtung Abgrund.<br />
Er verwechselt sie mit Anna. Das ist<br />
früher oft und nicht nur ihm passiert.<br />
Denn auch der Leser hört, während er<br />
Claire begleitet, die Stimme Annas mit,<br />
die den Anfang des Romans in der Ichform<br />
erzählt, um wenige Seiten später<br />
an einen Erzähler zu übergeben, der<br />
ihren Ton übernimmt und mit den beiden<br />
Schwestern gemeinsam Cooper<br />
beobachtet. Er bleibt mit seiner erzählenden<br />
Kamera so dicht an dem Knaben<br />
dran wie die Mädchen mit ihren Herzen.<br />
Vielleicht ist es aber auch doch wieder<br />
Anna, die hinter der Erzählkamera<br />
steckt, welche ihren Standpunkt hat in<br />
der Strasse, die <strong>Divisadero</strong> heisst, da, wo<br />
Anna wohnt.<br />
<strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>, der Autor von<br />
preisgekrönten Romanen wie «Der<br />
englische Patient», «Buddy Boldens<br />
Blues» oder «Anils Geist», ist ein Stimmen-Arrangeur,<br />
ein Bildermaler, ein<br />
Choreograph der Gefühle. Er liebt den<br />
Jazz. Unsentimental und mit viel Kraft<br />
setzt er seine Stofffülle in einem eigenen<br />
Zeit-Raum-Schema zusammen, bis<br />
Sequenzen sich einschreiben, als seien<br />
sie ein Stück von einem selbst, das man<br />
noch nicht gelebt hat.<br />
Längst habe ich begriffen, ich muss<br />
mich hinsetzen und das Buch noch einmal<br />
lesen, wenn ich Anna und Cooper<br />
wieder treffen will. Ihre Liebe ist bis zu<br />
letzten Seite da. Sie ist da in der Form.<br />
So steht es im Buch. �<br />
Judith Kuckart, geboren 1959 in<br />
Westfalen, lebt als Schriftstellerin<br />
und Regisseurin in Berlin und Zürich.<br />
Zuletzt erschien von ihr der Roman<br />
«Kaiserstrasse» (2006).<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 5
Belletristik<br />
Gulag Neben Solschenizyn gibt es einen weiteren Chronisten des Gulag: Warlam Schalamow<br />
Am Kältepol der Grausamkeit<br />
Warlam Schalamow: Durch den Schnee.<br />
Erzählungen aus Kolyma. Band 1. Aus<br />
dem Russischen von Gabriele Leupold.<br />
Hrsg. und mit einem Nachwort von<br />
Franziska Thun-Hohenstein. Matthes &<br />
Seitz, Berlin 2007. 344 S., Fr. 40.30.<br />
Manfred Sapper, Volker Weichsel, Andrea<br />
Huterer (Hg.): Das Lager schreiben.<br />
Varlam Šalamov und die Aufarbeitung<br />
des Gulag. BMV Berlin, Zeitschrift<br />
Osteuropa 6/2007. 440 S., 1 CD, Fr. 37.70.<br />
Von Ralph Dutli<br />
In der Erzählung «<strong>Die</strong> Einzelschicht»<br />
merkt der Häftling Dugajew, dass er allmählich<br />
schwächer wird, dass er seinen<br />
16-Stunden-Tag nicht länger durchhält.<br />
«Dugajew karrte, hackte und kippte,<br />
und wieder: karrte, hackte, kippte.» Als<br />
er t<strong>rot</strong>z aller Rackerei nur fünfundzwanzig<br />
Prozent der Tagesnorm erfüllt, wird<br />
er nachts abgeholt und an einen abgelegenen<br />
Ort geführt. Im Schlusssatz enthüllt<br />
sich Warlam Schalamows einsame<br />
Kunst des Unausgesprochenen. «Und als<br />
Dugajew begriff, worum es ging, bedauerte<br />
er, dass er umsonst gearbeitet, sich<br />
umsonst gequält hatte an diesem letzten<br />
heutigen Tag.»<br />
Wie konnte der Welt des Gulag, in der<br />
Zwangsarbeit, Frostkälte, Hunger, Schläge,<br />
Tod und Entwürdigung herrschten,<br />
bedeutende Literatur entspringen? Der<br />
1907 im nordrussischen Wologda geborene<br />
und 1982 in Moskau verstorbene<br />
Schalamow war von der Unsagbarkeit<br />
und Nichtdarstellbarkeit der Lagerwelt<br />
überzeugt und hat ihr dennoch überzeugende<br />
Texte abgerungen. Seine «Erzählungen<br />
aus Kolyma» blieben aber lange<br />
ein Geheimtipp. Der Autor wurde im<br />
Schatten Solschenizyns, des Übervaters<br />
der Lagerliteratur, kaum wahrgenommen.<br />
Mit dem eindrücklichen Band<br />
«Durch den Schnee» eröffnet der Verlag<br />
Matthes & Seitz eine sechsbändige<br />
Werkausgabe, die diesem Schattendasein<br />
endlich ein Ende setzen wird.<br />
Beben unter den Zeilen<br />
Schalamow verbrachte vierzehn <strong>Jahre</strong><br />
in der Lagerhölle am nordostsibirischen<br />
Fluss Kolyma, an jenem «Kältepol der<br />
Grausamkeit», wo Millionen Menschen<br />
der Vernichtung zugeführt wurden.<br />
Schon 1945 zirkulierte das verstörende<br />
Wort vom «Auschwitz ohne Öfen». Nach<br />
seiner Rückkehr aus der Hölle blieb ihm<br />
eine einzige Lebensaufgabe: jenes Universum<br />
des Schreckens aus seiner Erinnerung<br />
heraus zu beschwören, gegen die<br />
allgemeine Amnesie anzukämpfen.<br />
Unter den russischen Autoren, die<br />
über den Gulag geschrieben haben, blieb<br />
er ein Sonderfall. Denn nie darf man bei<br />
ihm moralische Erbauung geniessen,<br />
keine Anklage eines Unrechtsregimes<br />
erwarten. Gerade durch die radikale<br />
Trost- und Sinnverweigerung erklärt<br />
sich seine heillose Modernität. Schalamow<br />
ist ein literarischer Solitär. Er<br />
wollte «authentische» Literatur, eine<br />
paradoxe «nichtliterarische Literatur».<br />
6 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
HANS-JUERGEN BURKARD / BILDERBERG<br />
Schon 1945<br />
zirkulierte das Wort<br />
vom «Auschwitz ohne<br />
Öfen», wenn vom<br />
Gulag die Rede war.<br />
Doch diese Nicht-Kunst ist durchtrieben<br />
komponiert und von bestechender<br />
erzählerischer Ökonomie. Gabriele<br />
Leupolds Übersetzung ist vorzüglich<br />
in ihrer Präzision, in ihrer scheinbaren<br />
Emotionslosigkeit, die nie das Beben<br />
unter den Zeilen verleugnet.<br />
Was Schalamow letztlich umtreibt,<br />
ist das Faszinosum der Zählebigkeit<br />
des Menschen. <strong>Die</strong>ser zeigt selbst als<br />
Wrack, als von den Goldgruben ausgespuckte<br />
«menschliche Schlacke», einen<br />
unverständlichen Lebenswillen. <strong>Die</strong><br />
Erzählung «Regen» spricht von einem<br />
Versuch, sich das Bein zu zertrümmern,<br />
doch er misslingt gründlich und<br />
führt zur Einsicht, «dass ich weder zum<br />
Selbstverstümmler noch zum Selbstmörder<br />
tauge. Mir blieb nur zu warten,<br />
bis das kleine Unglück abgelöst wird<br />
durch ein kleines Glück, bis das grosse<br />
Unglück sich erschöpft. Das nächste<br />
Glück war das Ende des Arbeitstags,<br />
drei Schluck heisse Suppe.»<br />
Schalamows Erzählungen sollte man<br />
jedem wohlstandssatten, gedächtnislosen<br />
Zeitgenossen per Rezept verschreiben,<br />
damit er wieder weiss, in welcher<br />
Welt er lebt. Schalamows Lager-Pandämonium<br />
erlaubt tiefe Einblicke in<br />
die Abgründe des Menschenmöglichen.<br />
Unter dem Titel «Was ich im Lager<br />
gesehen und erkannt habe» steht als<br />
Erstes: «<strong>Die</strong> ausserordentliche Fragilität<br />
der menschlichen Kultur und Zivilisation.<br />
Der Mensch wurde innerhalb von<br />
drei Wochen zur Bestie – unter Schwerarbeit,<br />
Kälte, Hunger und Schlägen.»<br />
Ein Pullover kann unter Häftlingen,<br />
die nur «Staatswäsche» tragen, zum Verhängnis<br />
werden, weil das Kriminellenoberhaupt<br />
beim Kartenspiel noch einen<br />
Einsatz braucht. Auf das Kommando<br />
«Los, ausziehen» erwidert der Pulloverbesitzer:<br />
«Nur mitsamt der Haut.» Einen<br />
Augenblick später wird er erstochen.<br />
Es ist typisch für Schalamows Erzählschlüsse,<br />
dass keine Auflehnung folgt,<br />
nur die umso schmerzhaftere Lakonie.<br />
«Das Spiel war aus, und ich konnte nach<br />
Hause gehen. Zum Holzsägen musste<br />
ich mir jetzt einen anderen Partner<br />
suchen.» Das Geschehen wird nicht<br />
eingebettet in einen «höheren Sinn», es<br />
bleibt enigmatisch, verstörend. <strong>Die</strong> Welt<br />
ist die Lagerwelt – ohne Sinn.<br />
Im Schatten Solschenizyns<br />
Es ist ein Glücksfall, dass die Zeitschrift<br />
«Osteuropa» zeitgleich ein ausgezeichnetes<br />
Themenheft mit dem Titel «Das<br />
Lager schreiben» herausbringt. Es bietet<br />
einen Leitfaden zur Orientierung in<br />
einem dunklen Universum, verfasst von<br />
Experten wie Nicolas Werth, Michail<br />
Ryklin und anderen. Wer mehr über<br />
Schalamows «Poetik der Unerbittlichkeit»<br />
erfahren will und Gründe dafür<br />
sucht, warum dieser Autor immer im<br />
Schatten Solschenizyns verharren musste,<br />
wer sich die Frage stellt, ob es nicht<br />
auch «Widerstand im Gulag», Meuterei<br />
und Flucht gegeben habe, der greift mit<br />
Gewinn zu diesem Materialienband, in<br />
dem auch Schalamows Notate über seine<br />
eigene Prosa und über die Nichtdarstellbarkeit<br />
der Lagerwelt nachzulesen sind.<br />
Nicht nur hier dämmert einem, wer oder<br />
was dieser Schattenautor eigentlich war:<br />
ein Prosaist ersten Ranges. �<br />
Ralph Dutli ist unter anderem<br />
Herausgeber der Ossip-Mandelstam-<br />
Gesamtausgabe und des Hörbuchs<br />
«Russische Literaturgeschichte».
Erzählungen Regina Ullmanns Werk ist bis heute umzingelt von groben Missverständnissen.<br />
<strong>Die</strong> Neuauflage ihres wichtigsten Erzählbandes gibt Gelegenheit zur Richtigstellung<br />
«Als trüg ich Lasten aus aller Welt»<br />
Regina Ullmann: <strong>Die</strong> Landstrasse.<br />
Erzählungen. Nachwort von Peter<br />
Hamm. Kollektion Nagel & Kimche,<br />
Zürich und München 2007. 182 S., Fr. 36.–.<br />
Von <strong>Michael</strong> Braun<br />
Der Sehnsuchtsort der Dichterin Regina<br />
Ullmann war die Weltabgeschiedenheit.<br />
Grosse Städte wie München und Wien<br />
erlebte sie dagegen als Nährboden des<br />
Unglücks. So verwundert es nicht, wenn<br />
auch die einsamen Helden ihrer Erzählungen<br />
stille Schauplätze bevorzugen:<br />
An einsamen Landstrassen, am Fenster<br />
verwunschener Wirtshäuser im Wald<br />
gelangen diese unglücklichen, oft körperlich<br />
versehrten Figuren zu einem<br />
tastenden Weltbewusstsein, geschützt<br />
vor dem Lärm der Moderne. Und wenn<br />
sich diese einsamen Waldgänger dann<br />
im «Schmerz der Leidenschaft» verzehren<br />
und nach Erfüllung ihrer absoluten<br />
Liebe drängen, ist ihr Unglück vorprogrammiert.<br />
Dann werden sie, wie der<br />
verliebte Bauernbursche in der Erzählung<br />
«Vor einem alten Wirtshausschild»,<br />
von Naturmächten verschlungen.<br />
In einer von Ullmanns verwinkelten<br />
Erzählungen spricht eine Reisende<br />
ohne Ziel, die sich auf einer Bergkuppe,<br />
einem «Kogel», niedergelassen hat. Dort<br />
grübelt sie vor sich hin, murmelt einige<br />
Gebete, überlässt sich ihren Tagträumen.<br />
In ihren Phantasmagorien tauchen<br />
die Bilder von Heiligengestalten auf,<br />
die Menschen und Tiere huschen wie<br />
Schatten vorüber. «Mir war so schwer»,<br />
sinniert die somnambule Ich-Erzählerin<br />
gleich zu Beginn des Textes, «als trüg<br />
ich Lasten, unbekannte, aus aller Welt.»<br />
Gefördert von Rilke<br />
Tatsächlich trug auch Regina Ullmann<br />
von Kindheit an viele drückende seelische<br />
Lasten mit sich herum. Im Dezember<br />
1884 als Tochter eines jüdischen<br />
Stickerei-Kaufmanns und einer überaus<br />
dominanten Mutter in St. Gallen geboren,<br />
litt sie in ihrer Kindheit unter starken<br />
Sprachhemmungen. <strong>Die</strong> ehrgeizige<br />
Mutter dachte ihr dennoch früh eine<br />
dichterische Laufbahn zu.<br />
Das literarische Offenbarungserlebnis<br />
widerfuhr ihr aber erst <strong>Jahre</strong> später<br />
in der Steiermark, wo sie die Lebensrituale<br />
der bäuerlich-archaischen Welt<br />
kennenlernte. Auf ihren im Herbst 1907<br />
publizierten Erstling, den Einakter «<strong>Die</strong><br />
Feldpredigt», reagierte Rainer Maria<br />
Rilke mit nachhaltiger Begeisterung. Bis<br />
zu seinem Tod im Dezember 1926 blieb<br />
Rilke ihr treuester Förderer – ohne indes<br />
verhindern zu können, dass die schwermütige<br />
Dichterin von einer Krise in die<br />
nächste stürzte.<br />
Nach Rilkes Tod verschärfte sich Ullmanns<br />
Verlorenheitsgefühl noch, bis sie<br />
nach ihrem Ausschluss aus dem Deutschen<br />
Schriftstellerverband 1935 nach<br />
St. Gallen floh, wo sie bald in einem<br />
katholischen Schwesternheim bis kurz<br />
vor ihrem Tod 1961 Zuflucht fand. Bis<br />
heute ist das schmale Werk der Dichterin<br />
umzingelt von groben Missverständnissen.<br />
Zwar fand ihr Gesamtwerk<br />
gleich zweimal mutige Verleger. Aber<br />
das eigenwillig Visionäre ihrer Welterkundung<br />
hat man meist auf eine Variante«bayrisch-österreichisch-schweizerischer<br />
Heimatdichtung» (Charles<br />
Linsmayer) reduziert. Der Wesenskern<br />
dieser Prosa liegt woanders: im Weltgefühl<br />
einer tiefen Demut gegenüber<br />
der Schöpfung; und in einer mystischen<br />
Innigkeit, die leuchtende Bilder einer<br />
Realpräsenz der Dinge hervorbringt.<br />
In der Weltverlorenheit<br />
Peter Hamm hat nun den wichtigsten<br />
Erzählband der Ullmann, das 1921<br />
erstmals erschienene Werk «<strong>Die</strong> Landstrasse»,<br />
neu ediert und mit einem<br />
instruktiven Nachwort versehen. So<br />
besteht die Chance, dass die Dichtung<br />
Regina Ullmanns endlich zu ihrem literarischen<br />
Recht kommt. Denn die Aufmerksamkeit<br />
für ihr Werk ist immer<br />
Eine wallende Mähne, <strong>rot</strong>e Lippen, ein leicht<br />
zurückgebogener Kopf und das Licht von der Seite:<br />
So inszeniert die Werbung der Popkultur Frauen<br />
als Vamps. Feng Zhengjie ist von der Bildsprache<br />
des Pop wie von westlichen Anzeigen fasziniert<br />
und überträgt sie auf Phänomene der chinesischen<br />
Lebenswelt: «Ich spürte, dass die Popkultur eine<br />
aussergewöhnlich starke Vitalität besass. Vielleicht<br />
fand ich das alles selbst verwirrend und wollte<br />
darum unbedingt herausfinden, was wirklich unter<br />
der Oberfläche lag.» Der 1968 in der Provinz Sichuan<br />
geborene Künstler persiflierte Hochzeitsbilder<br />
wieder überblendet worden durch Schilderungen<br />
ihrer tragischen Biografie.<br />
Zuletzt hat Eveline Hasler (in «Stein<br />
bedeutet Liebe») die in ihrer Seelendramatik<br />
monströse Geschichte neu<br />
ausfabuliert, die Regina Ullmann mit<br />
dem Münchner Psychoanalytiker Otto<br />
Gross verband. Der mit anarchistischlibertären<br />
Theorien verschwenderisch<br />
umgehende Freud-Schüler wollte seine<br />
Patienten nicht nur von allen Neurosen<br />
befreien, sondern auch mit e<strong>rot</strong>ischer<br />
Libertinage beglücken. 1907 erlag auch<br />
Regina Ullmann der Intensität dieser<br />
charismatischen Persönlichkeit und<br />
liess sich von dem fanatischen Weltbeglücker<br />
schwängern. Nicht genug damit,<br />
dass Gross der psychisch labilen Dichterin<br />
mit seinem psychoanalytischen<br />
Absolutismus zusetzte, er versuchte<br />
die Schwangere auch zum Selbstmord<br />
zu animieren. Kurz darauf wurde er in<br />
einer Zürcher Irrenanstalt interniert.<br />
Regina Ullmann wurde ihrerseits in die<br />
Weltverlorenheit zurückgestossen, der<br />
sie nie wieder entrinnen konnte. �<br />
Pop-Art aus China Schreiende Farben, knallige Bilder<br />
der 1990er <strong>Jahre</strong> ebenso wie verknöcherte Gelehrte.<br />
Greller Kitsch ist seine Methode an der neuen Kultur<br />
von Konsum und Kommerz. Der opulente Band, in<br />
dem er nun vorkommt, stellt 80 Künstlerinnen und<br />
Künstler aus dem Reich der Mitte mit biografischen<br />
Daten, zahlreichen Werkabbildungen und konzisen<br />
Einführungen vor. Er darf als erster umfassender<br />
Führer für die boomende Kunstszene des<br />
gegenwärtigen China gelten. Gerhard Mack<br />
Uta Grosenick und Caspar H. Schübbe (Hrsg.):<br />
China Artbook. Dumont, Köln 2007.<br />
670 Seiten, 850 Farbabbildungen, Fr. 66.–.<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 7
Belletristik<br />
Roman Spektakulär erzählt: fiktive Gedanken deutscher Intellektueller im Kalifornien-Exil<br />
«Das Ganze ist ein Quark geworden»<br />
<strong>Michael</strong> Lentz: Pazifik Exil. S. <strong>Fischer</strong>,<br />
Frankfurt a. M. 2007. 464 S., Fr. 35.40.<br />
Von Paul Jandl<br />
Was sind die Künstler? «Wenn es ans<br />
Leben geht, werden sie Dilettanten!»<br />
Nicht nur in ihrem Tagebuch hat die<br />
resolute Wiener Dame immer das letzte<br />
Wort. Bei den Lebensdingen kennt sich<br />
Alma, verwitwete Mahler, geschiedene<br />
Gropius und verheiratete Werfel, eben<br />
aus. Über die staubigen Pyrenäen und<br />
zu Fuss führt sie im Herbst 1940 ein<br />
illustres Trüppchen von Exilanten. <strong>Die</strong><br />
opulente Garderobe für die neue Heimat<br />
wird ihr in einem Dutzend Koffern<br />
hinterhergetragen.<br />
Wenn diese authentische Reise des<br />
<strong>Jahre</strong>s 1940 nicht selbst schon ein Roman<br />
war, dann hat <strong>Michael</strong> Lentz jetzt einen<br />
daraus gemacht. «Pazifik Exil» heisst<br />
das Buch, das in breitem Cinemascope<br />
zeigen will, wie eng die Welt in einer<br />
Epoche des Untergangs wird. Dass die<br />
Komik kein Trost, sondern die nicht<br />
minder bedrohliche Kehrseite des Tragischen<br />
ist, zeigt der Roman in einer<br />
furiosen Sprache.<br />
Alle sind sie da, im kalifornischen Exil<br />
zwischen Pacific Palisades und Santa<br />
Monica: Alma und Franz Werfel, die<br />
Manns und die Feuchtwangers, Bertolt<br />
Brecht, Arnold Schönberg und Hanns<br />
Eisler. Es sind verzweifelte Zeitdiagnostiker<br />
und versierte Hypochonder.<br />
Brecht, Mann, Werfel<br />
Was sie ausmacht, zeigt Lentz nicht in<br />
einer fortlaufenden Handlung, sondern<br />
in monologischen Sentenzen oder in<br />
subtil beobachteten Szenen. Was dabei<br />
herauskommt, sind Vignetten voller<br />
Melancholie. Lange und im Stil seiner<br />
wie hingeknallten Sprache kann Bertolt<br />
Brecht das Los des sportlichen Autofahrers<br />
oder der Weltrevolution beklagen.<br />
Wenn er auf halbem Wege zur Cocktailparty<br />
bemerkt, dass er noch die Hausschuhe<br />
an den Füssen hat, dann denkt er<br />
nur: Was soll’s. Er ist doch der berühmte<br />
Brecht, und das ist schliesslich keine<br />
Frage der Toilette. Noch berühmter aber<br />
ist Thomas Mann, den Lentz als Poseur<br />
vor dem Spiegel der Welt zeigt. «Wo ich<br />
bin, ist Deutschland», lautet der notorische<br />
Satz des exilierten Grossschriftstellers.<br />
Etwas leiser klingt das Echo<br />
Brechts: «Wo ich bin, kann Thomas<br />
Mann nicht sein.»<br />
Wenn Lentz’ Roman satirisch ist, dann<br />
an solchen Stellen. <strong>Die</strong> Grossen lässt er<br />
auf die Details ihrer Eitelkeit schrumpfen,<br />
den Bescheidenen gibt er Grösse.<br />
Mögen die Spiegelfechtereien zwischen<br />
Brecht und Thomas Mann im Blutvergiessen<br />
der Ehrabschneidung gipfeln,<br />
anderswo geht es elender zu. Heinrich<br />
Mann macht sich keine Illusionen über<br />
die Chancen des Exils. Erfolglos und<br />
verarmt steht er endgültig im Schatten<br />
des auch in Amerika umworbenen Bruders.<br />
Was bleibt ihm? Wenn Heinrich<br />
8 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
GLAESCHER / LAIF<br />
Der deutsche Autor,<br />
Lautpoet und Musiker<br />
<strong>Michael</strong> Lentz, 43.<br />
Mann seine Zeichnungen nackter Frauen<br />
kritzelt, dann ist das zumindest e<strong>rot</strong>ische<br />
Versöhnung mit der Welt. Haben<br />
nicht all die sinnlich Hingestreckten die<br />
Brüste seiner eigenen Frau? Nelly Mann,<br />
die Mesalliance der Familie, die ewige<br />
Zielscheibe des Bruders Thomas Mann,<br />
verdämmert im Exil. Das trostlose<br />
Leben und der Alkohol setzten ihr nicht<br />
weniger zu als der Spott einer in der<br />
Fremde noch schwerer zu ertragenden<br />
Verwandtschaft. 1944 begeht Nelly in<br />
Los Angeles Selbstmord. Ihr Schicksal<br />
ist ein stilles.<br />
Stiller jedenfalls als das der omnipräsenten<br />
Alma Mahler-Werfel, deren<br />
Ceterum censeo aus den Seiten des<br />
Romans dröhnt. «<strong>Die</strong> Juden sind mein<br />
Schicksal», heisst es immer wieder, bis<br />
dem herzkranken Franz Werfel die antisemitischen<br />
Tiraden auch einmal zu viel<br />
werden. «Meine Frau Hitler» nennt er<br />
das böse dahinschwadronierende Weib,<br />
das Werfel seine Verfolgung durch die<br />
Nazis nicht verzeihen will.<br />
Brillant verdichtet<br />
«Das Ganze, von Tod und Leben, ist ein<br />
Quark geworden.» Wenn dieser verzweifelt<br />
direkte Satz Heinrich Manns<br />
eine Abbreviatur des Exils ist, was ist<br />
dann Lentz’ fast fünfhundert Seiten<br />
dicker Roman?<br />
«Pazifik Exil» ist masslos. Für die<br />
politische Lage der dreissiger und vierziger<br />
<strong>Jahre</strong> interessiert sich der Roman<br />
weniger als für eine in Bildern verdichtete<br />
Psychologie dieser Zeit. Man wird<br />
im brillanten Projekt «Pazifik Exil» die<br />
avantgardistische Schreibstube erkennen,<br />
aus der der 43-jährige deutsche<br />
Schriftsteller kommt, und auch den Versuch,<br />
munter draufloszuerzählen. Denn<br />
das kann Lentz auch. <strong>Die</strong> Suada seiner<br />
Figuren, den stets zur Selbstrechtfertigung<br />
aufgestachelten Zorn, macht Lentz<br />
zu einem Spektakel von surrealer Wahrheit.<br />
Aus der Welt sind die Sätze, Mutmassungen<br />
und Daseinserklärungen der<br />
aus der Welt gefallenen Manns, Feuchtwangers,<br />
Schönbergs und Werfels.<br />
Künstler auf verlorenem Posten. «Ich<br />
frage mich oft, ob wir mit dem Verlassen<br />
Deutschlands nicht die Wirklichkeit<br />
verlassen hatten», lässt Lentz Heinrich<br />
Mann sagen, und das ist ein Satz, der<br />
wohl für den ganzen Roman steht.<br />
Das Exil ist ein Laboratorium für<br />
das eigene Leben, der Ausgang dieses<br />
unfreiwilligen Experiments ist ungewiss.<br />
In einer der beindruckendsten<br />
Szenen des Buches – einer Szene, die<br />
zeigt, wie brillant der Autor seinen voll<br />
aus biografischen Quellen schöpfenden<br />
Stoff verdichten kann – trauert Arnold<br />
Schönberg seinem «Wagner-Sessel»<br />
nach. Den von Schönberg in Deutschland<br />
erstandenen Ohrenfauteuil, auf<br />
dem schon Richard Wagner gesessen<br />
sein soll, nimmt Thomas Mann dem<br />
Komponisten ab, um darin den «Doktor<br />
Faustus» zu schreiben. Doch nicht nur<br />
das: Auch die Idee der Zwölftonmusik<br />
wandert unversehens in seinen Roman.<br />
Der von Schönberg schmerzlich<br />
vermisste und bis dahin überallhin<br />
mitgeschleppte Sessel ist der kleinste<br />
gemeinsame Nenner einer Lebensreise.<br />
Während der Komponist zu einer Klage<br />
anhebt, die allen Weltverwünschern<br />
Thomas Bernhards zur Ehre gereicht<br />
hätte, ahnt man, was ein Exil im Exil<br />
war. «<strong>Die</strong>ser Sessel ist Heimat», sagt<br />
Arnold Schönberg. Da sitzt ganz behaglich<br />
schon Thomas Mann in seinem<br />
Fauteuil. �
Roman Eine Liebes- und Aidsgeschichte<br />
ist eines der meistdiskutierten Bücher<br />
dieses Herbstes<br />
Intim und in die<br />
Ferne gerückt<br />
PETER PEITSCH<br />
Katja Lange-Müller: Böse Schafe.<br />
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007.<br />
205 Seiten, Fr. 30.–.<br />
Von Sieglinde Geisel<br />
Es ist 1987, die Mauer steht noch, und<br />
Aids ist ein Todesurteil. Kaum ein Jahr<br />
ist Soja in Westberlin. Harry ist eine<br />
Zufallsbekanntschaft, doch sie will ihn<br />
um jeden Preis haben – das Wort «Junkie»<br />
hatte sie in der DDR nie gehört.<br />
Was ihr von dieser Liebe in der Erinnerung<br />
bleibt, ist ein «betörend undramatisches<br />
Glück», ein Standbild von zwei<br />
Menschen, die nebeneinander auf der<br />
Matratze liegen. Mehr ist es nicht, denn<br />
kennengelernt hat sie Harry in den knapp<br />
drei <strong>Jahre</strong>n eigentlich kaum. Er entzieht<br />
sich, verschwindet, ist gleichgültig und<br />
egozentrisch, hat Geheimnisse. Er sei<br />
einer der «guten Bösen», so liest Soja es<br />
nach seinem Tod in seinem Notizbuch.<br />
<strong>Die</strong> guten Bösen unterscheiden sich von<br />
den bösen Bösen darin, dass sie nicht<br />
mehr einander Gewalt antun, sondern<br />
nur noch sich selbst. Der HIV-positive<br />
Harry schützt Soja vor Ansteckung,<br />
indem er sie beim Sex jeweils rechtzeitig<br />
«von der Palme holt», wie er es<br />
ausdrückt.<br />
Eine Amour fou, die nicht gut ausgeht<br />
und von deren Glück sich Soja<br />
nicht mehr erholt. Doch Lange-Müller<br />
schreibt keine traurigen Bücher. Harrys<br />
gekerbtes Kinn sieht aus «wie ein stoppliger<br />
Babypopo», Sojas toupierte Frisur<br />
«wie ein gefrorener Ameisenhaufen».<br />
Nicht immer haut der Sprachwitz hin.<br />
«Ich ging jedoch nicht rauchen, sondern<br />
im Zimmer umher», solche Manierismen<br />
häufen sich. Hinreissend sind dagegen<br />
die Sexszenen. Der Sex selbst mag<br />
schiefgehen, doch Katja Lange-Müller<br />
macht daraus ein sprachliches Kleinod<br />
an Zärtlichkeit und Komik.<br />
Was einen beim Lesen gefangen<br />
nimmt, ist nicht nur diese seltsame<br />
Liebe, sondern die sprachliche Form.<br />
Denn Soja erzählt ihre Geschichte nicht<br />
uns, sondern dem toten Harry, und<br />
zwar tut sie dies in strengem Imperfekt<br />
und über weite Strecken in der zweiten<br />
Person. «Du warst [. . .] permanent<br />
müde, döstest vor dich<br />
hin, lasest keine Fantasy-<br />
Romane, hörtest nicht The<br />
Doors, sprachst kaum.»<br />
Eine seltene Verbform,<br />
die den Text auf sanfte<br />
Weise verfremdet. <strong>Die</strong><br />
Intimität der Zwiesprache<br />
wird vom erhabenen<br />
Imperfekt sogleich<br />
in die Ferne gerückt<br />
– diese paradoxe Wirkung<br />
trägt den ganzen<br />
Roman. �<br />
Kurzkritiken Belletristik<br />
Bernadette Calonego: Unter dunklen<br />
Wassern. Kriminalroman. Bloomsbury,<br />
Berlin 2007. 381 Seiten, Fr. 35.40.<br />
<strong>Die</strong> gebürtige Stanserin Bernadette<br />
Calonego, seit <strong>Jahre</strong>n freie Auslandkorrespondentin<br />
an der Westküste Kanadas,<br />
überrascht erneut mit einer ungewöhnlichen<br />
Ermittler-Figur. Im Début<br />
«Nutze deine Feinde» war es eine Event-<br />
Managerin, die mysteriöse Todesfälle<br />
aufklärte. In «Unter dunklen Wassern»<br />
lässt Calonego die 33-jährige Historikerin<br />
Sonja Werner ermitteln. <strong>Die</strong>se ist in<br />
British Columbia auf Recherche für eine<br />
Ausstellung über die dichterisch ambitionierte<br />
Deutsche Else Seel, die in den<br />
zwanziger <strong>Jahre</strong>n von Berlin in die kanadische<br />
Pampa emigrierte, um dort einen<br />
ihr unbekannten Tramper zu heiraten.<br />
Dabei verfolgt Werner auch ein anderes<br />
Ziel: den Tod ihres Mannes aufzuklären.<br />
An manchen Stellen wünscht man sich<br />
etwas weniger Einfühlungsprosa, doch<br />
gewinnt Calonego die Leserin mit Thrill<br />
und süffiger Schreibe.<br />
Regula Freuler<br />
Jurek Becker: Mein Vater, die Deutschen<br />
und ich. Aufsätze, Vorträge, Interviews.<br />
Suhrkamp, Frankfurt 2007. 326 S., Fr. 34.30.<br />
Der deutsche Erzähler und Drehbuchautor<br />
Jurek Becker (1937–1997) stammte<br />
aus dem polnischen Lodz, überlebte als<br />
Kind Ghetto und Konzentrationslager<br />
und kam 1945 mit seinem Vater nach<br />
Ostberlin, wo er bis 1977 blieb. Hier<br />
gelangte er als Schriftsteller zu Ruhm,<br />
siedelte dann aber nach Westberlin über.<br />
Sein Erstling, «Jakob der Lügner», blieb<br />
der beste seiner insgesamt sieben Romane.<br />
Becker war ein unprätentiöser, aber<br />
exakter und anschaulicher, dem mündlichen<br />
Sprachfluss verpflichteter Erzähler<br />
– und zudem ein wacher politischer<br />
Kopf. Davon zeugen seine Poetikvorlesungen,<br />
seine Aufsätze, Vorträge und<br />
Interviews, so etwa der Schlüsseltext<br />
«Mein Judentum». Eine erste Auswahl<br />
dieser kleinen Schriften erschien 1996<br />
im Band «Ende des Grössenwahns»;<br />
Christine Becker, die Witwe des Autors,<br />
legt nun eine massgeblich erweiterte<br />
Sammlung der stets konkreten, undogmatischen<br />
und deshalb nach wie vor<br />
höchst lesenswerten Texte vor.<br />
Manfred Papst<br />
Adolf Endler: Krähenüberkrächzte<br />
Rolltreppe. 79 kurze Gedichte. Wallstein,<br />
Göttingen 2007. 90 Seiten, Fr. 29.50.<br />
Adolf Endler, nach eigenem Bekunden<br />
«eine der verwachsensten Gurken der<br />
neuen Poesie», wurde 1930 in Düsseldorf<br />
geboren und siedelte als begeisterter<br />
Jungkommunist 1955 in die DDR<br />
über. <strong>Die</strong> Euphorie währte nicht lange.<br />
Von den sechziger <strong>Jahre</strong>n an kommentierte<br />
Endler den real existierenden<br />
Sozialismus in kauzigen Gedichten und<br />
borstiger Prosa; bald konnte er nur noch<br />
im Untergrund und im Westen publizieren.<br />
Der wortmächtige Sonderling<br />
vom Prenzlauer Berg brachte 1999 bei<br />
Suhrkamp eine üppige Auswahl seiner<br />
Lyrik unter dem Titel «Der Pudding<br />
der Apokalypse» heraus; nun legt er bei<br />
Wallstein einen Band mit kurzen Gedichten<br />
aus fünfzig <strong>Jahre</strong>n nach. <strong>Die</strong> beiden<br />
Bücher überschneiden sich nicht. Hier<br />
zeigt sich Endler von einer ungewohnten<br />
Seite: als lakonischer Melancholiker von<br />
trockenem Humor.<br />
Manfred Papst<br />
Do<strong>rot</strong>a Masłowska: <strong>Die</strong> Reiherkönigin.<br />
Ein Rap. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007.<br />
191 Seiten, Fr. 18.20.<br />
Ein Taschenbuch für Fans von Poetry-<br />
Slams und Spoken-Word-Anlässen:<br />
<strong>Die</strong> 24-jährige polnische Schriftstellerin<br />
Do<strong>rot</strong>a Masłowska nimmt in ihrem<br />
preisgekrönten Zweitling kein Blatt vor<br />
die freche Schnauze. Aber was für eine<br />
poetische Schnauze das ist! Im Singsang<br />
reimt sie einen Kraftausdruck auf<br />
den anderen, bringt das Leben im ehemaligen,<br />
immer noch tristen Osten auf<br />
Punkt und Komma: «Alle leben in der<br />
Platte, steh’n beim Amt auf der Matte,<br />
die Jugend hat Angst, zur Schule zu<br />
gehen, weil andere Kinder ihnen das<br />
Geld abziehen.» <strong>Die</strong> Geschichte dreht<br />
sich lose um den Popsänger Stan Retro,<br />
dem Karriere und Liebe den Bach runtergehen.<br />
Masłowska, die mit ihrem<br />
Début «Schneeweiss und Russen<strong>rot</strong>»<br />
zu Polens Literatur-Shootingstar wurde,<br />
schreibt über die Warschauer Musikszene,<br />
Alkohol, Betrug, Freundschaft und<br />
den ganz gewöhnlichen Überlebenskampf.<br />
Ein Kränzchen winden wir Olaf<br />
Kühls kraftvoller Übersetzung.<br />
Regula Freuler<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 9
Belletristik<br />
Roman Sein Erstling «Drachenläufer» wurde zum Weltbestseller. In seinem neuen Buch erzählt<br />
Khaled Hosseini vom Schicksal zweier Frauen in seiner einstigen Heimat Kabul<br />
Wehe, das Kind ist nur ein Mädchen<br />
Khaled Hosseini: Tausend strahlende<br />
Sonnen. Aus dem Amerikanischen von<br />
<strong>Michael</strong> Windgassen. Bloomsbury,<br />
Berlin 2007. 384 Seiten, Fr. 38.–.<br />
Von Susanne Schanda<br />
Mit seinem neuen Roman knüpft der<br />
afghanisch-amerikanische Autor Khaled<br />
Hosseini an seinen Erfolg des «Drachenläufers»<br />
an. «Tausend strahlende Sonnen»<br />
ist eine packende Hommage an die<br />
afghanischen Frauen und gibt der von<br />
Krieg und Terror zerstörten Stadt Kabul<br />
ein Gesicht – voll Narben, Furchen und<br />
ungebrochenem Lebenswillen. An Leid<br />
fehlt es nicht in diesem Roman. Dass<br />
er überhaupt lesbar ist, verdankt sich<br />
der grenzenlosen Liebe des 42-jährigen<br />
Autors zu seiner einstigen Heimat, die<br />
er als 5-Jähriger verlassen musste.<br />
Seinen ersten Roman «Drachenläufer»,<br />
inzwischen mit sieben Millionen<br />
Exemplaren ein Weltbestseller und vom<br />
Schweizer Hollywood-Regisseur Marc<br />
Forster verfilmt, hat Hosseini noch<br />
aus seinen Erinnerungen geschöpft.<br />
Später ist er nach Afghanistan gereist.<br />
Vieles, was er dort gefunden habe, sei<br />
zu schrecklich, um erzählt zu werden,<br />
sagt der Autor. Auch so gibt es in seinem<br />
neuen Roman noch genügend Episoden<br />
von kaum erträglicher Grausamkeit.<br />
Vor dem Hintergrund der afghanischen<br />
Geschichte von 1973 bis 2003<br />
entfalten sich die individuellen Lebensgeschichten<br />
von zwei Frauen und ihren<br />
Familien. In der Zeit, als aus dem Königreich<br />
Afghanistan eine Republik wird,<br />
könnte das unehelich geborene Mädchen<br />
Mariam seinen 15. Geburtstag feiern.<br />
Doch was es sich von seinem Vater<br />
Krimi Kritische Stimme gegen die Geschlechtertrennung in Saudiarabien<br />
Leiche unter der mörderischen Wüstensonne<br />
Zoe Ferraris: <strong>Die</strong> letzte Sure. Aus dem<br />
Amerikanischen von Matthias Müller.<br />
Pendo, München und Zürich 2007.<br />
400 Seiten, Fr. 32.40.<br />
Von Pia Horlacher<br />
Nichts Neues im Westen, müssen fleissige<br />
Krimileserinnen leider oft feststellen.<br />
Doch nun entführt uns die junge<br />
Amerikanerin Zoe Ferraris mit einem<br />
aussergewöhnlichen Début in den arabischen<br />
Osten und damit in eine uns ganz<br />
unbekannte Welt des literarischen Verbrechens.<br />
Dort wird, unter der mörderischen<br />
Sonne der Wüste, die Leiche der<br />
16-jährigen Nouf gefunden, Tochter aus<br />
reicher, streng islamischer Saudi-Oberschicht.<br />
War sie entführt worden? Oder<br />
geflüchtet aus ihrem goldenen Frauen-<br />
10 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
käfig auf einer streng bewachten Halbinsel?<br />
Gar Opfer eines Ehrenmordes durch<br />
die eigene Familie? Denn die Obduktion<br />
ergibt, dass die junge unverheiratete<br />
Frau schwanger war – ein Todesurteil<br />
in dieser radikalislamischen Welt. Ein<br />
Freund ihres Bruders, der zurückgezogen<br />
lebende Wüstenführer Nayir, ist am<br />
Ermitteln. Für den schüchternen und<br />
strenggläubigen Mann, der sich inbrünstig<br />
nach weiblichen Kontakten sehnt,<br />
aber keine Frau anhören und ansehen,<br />
geschweige denn ansprechen darf, eine<br />
fast unlösbare Aufgabe. Denn Nouf hatte<br />
in diesem System einzig unter ihresgleichen<br />
erlaubten Kontakt, folglich könnten<br />
nur ihre Schwestern und Freundinnen<br />
das Rätsel lösen helfen.<br />
<strong>Die</strong> totale Geschlechtertrennung, so<br />
inhuman wie einst die Rassentrennung<br />
in den USA, ist denn auch das eigent-<br />
wünscht, verweigert dieser der Tochter:<br />
die Aufnahme in seine legitime Familie.<br />
Nach dem Selbstmord ihrer Mutter wird<br />
Mariam an den dreissig <strong>Jahre</strong> älteren<br />
Witwer Raschid verschachert. Als sich<br />
nach mehreren Fehlgeburten herausstellt,<br />
dass sie ihm keine Kinder gebären<br />
kann, beginnt Raschid, sie zu beschimpfen,<br />
zu misshandeln, einzusperren.<br />
Inzwischen sind die sowjetischen<br />
Truppen einmarschiert und werden<br />
während zehn <strong>Jahre</strong>n von den Mujahedin<br />
bekämpft. Bomben fallen auf Kabul,<br />
unzählige Menschen sterben. Eines<br />
Tages kommt Raschid mit dem verletzten<br />
Nachbarsmädchen Laila auf den<br />
Armen nach Hause. <strong>Die</strong> 15-Jährige hat<br />
kürzlich ihre Eltern verloren und ist, was<br />
niemand weiss, von ihrem Jugendfreund<br />
Tarik schwanger. Raschid schöpft neue<br />
Hoffnung auf Nachwuchs und heiratet<br />
die verzweifelte Laila. Als diese neun<br />
Monate später eine Tochter zur Welt<br />
bringt, die Raschid gar nicht gleicht,<br />
schöpft er Verdacht und deckt nun auch<br />
Laila mit Wut und Schlägen ein. <strong>Die</strong> beiden<br />
Ehefrauen verbünden sich.<br />
Was den Roman «Tausend strahlende<br />
Sonnen» zu einer packenden Lektüre<br />
macht, ist neben dem spektakulären Plot<br />
die differenzierte Zeichnung der Frauenfiguren.<br />
Bereits als Kind hat Mariam von<br />
ihrer Mutter gelernt, dass eine Frau in<br />
der afghanischen Gesellschaft nur eines<br />
können muss: aushalten. Doch Mariam<br />
kann mehr und lernt laufend dazu.<br />
Khaled Hosseinis Romanfiguren<br />
sind nicht nur Täter und Opfer. Selbst<br />
der prügelnde Ehemann gewinnt durch<br />
die Liebe seines kleinen Sohnes ein<br />
menschliches Gesicht. Und Mariam, die<br />
als mittelloser Bastard zur Opferrolle<br />
prädestiniert scheint, gibt der Geschich-<br />
te mit ihrem radikalen Befreiungsschlag<br />
schliesslich die ersehnte Wende.<br />
Khaled Hosseini erzählt seine hochdramatische<br />
Geschichte in einfacher<br />
Sprache und trifft mitten ins Herz.<br />
Nicht, dass wir grundsätzlich Neues<br />
über Afghanistan erfahren würden. Dass<br />
den Frauen unter den Taliban nicht nur<br />
der Zutritt zu Schulen und Universitäten,<br />
sondern auch zu vielen Spitälern<br />
verwehrt wurde, war bekannt. Doch<br />
erst wer hier liest, wie Leila in einem<br />
unhygienisch geführten Spital mit Kaiserschnitt<br />
ohne Narkose ihren Sohn<br />
zur Welt bringt, spürt, was das wirklich<br />
bedeutet.<br />
Hosseini richtet den Fokus auf individuelle<br />
Schicksale und gibt dem zerrissenen<br />
Land ein Gesicht. Schmerzlich<br />
nahe bringt er, was die Taliban mit ihrer<br />
pervertierten Auslegung des Islam den<br />
Frauen antun. Wenn am Schluss Apfelbäume<br />
blühen, Abflusskanäle und Brunnen<br />
gebaut werden und Leila schwanger<br />
ist, scheint das des Happy-Ends fast<br />
zu viel. Doch es berührt, wie der Tod<br />
Mariams letztlich akzeptiert wird als<br />
Teil einer schrecklichen Realität. <strong>Die</strong>se<br />
Geschichte hätte wohl nicht erzählt<br />
werden können ohne die Hoffnung, die<br />
aus dem titelgebenden Gedicht des persischen<br />
Lyrikers Saib-e-Tabrizi spricht,<br />
einer Hymne an die Stadt Kabul.<br />
Anzumerken bleibt, dass Hosseinis<br />
Fiktionen von der Realität eingeholt<br />
werden. <strong>Die</strong> Familien der beiden 12-jährigen<br />
Hauptdarsteller der «Drachenläufer»-Verfilmung<br />
fürchten in Afghanistan<br />
um das Leben ihrer Söhne wegen deren<br />
Rolle in einer Vergewaltigungsszene.<br />
Hollywood hat aus Angst vor Racheakten<br />
der Taliban den für 2. November<br />
geplanten Filmstart verschoben. �<br />
liche Thema von Ferraris’ «Finding<br />
Nouf» (so der amerikanische Originaltitel).<br />
Dabei geht die New Yorkerin,<br />
die selbst mit ihrem saudiarabischen<br />
Ehemann in Dschidda, dem Schauplatz<br />
der Geschichte, lebte, raffiniert vor: Das<br />
eigentliche Verbrechen, um das es ihr<br />
geht, ist die ebenso alltägliche wie totale<br />
Versklavung der Frauen unter der Scharia;<br />
doch der Held der Geschichte ist<br />
gerade dafür blind. Mit der tatkräftigen<br />
Hilfe einer rebellischen Gerichtsmedizinerin,<br />
um die selbst der verklemmte<br />
Nayir nicht herumkommt, gehen ihm<br />
t<strong>rot</strong>zdem allmählich die Augen auf.<br />
Ihr Buch über das Leben in einer solchen<br />
Gesellschaft sei «nur» ein Krimi<br />
geworden, sagt Zoe Ferraris, weil eine<br />
Frau dort zuerst tot sein müsse, bis ein<br />
Mann sich mit ihrem Leben beschäftigen<br />
dürfe. �
Biografie Annemarie Schwarzenbachs Erfolgsbuch über den Abenteurer Lorenz Saladin<br />
Liebhaber der Welt<br />
Annemarie Schwarzenbach: Lorenz<br />
Saladin. Ein Leben für die Berge.<br />
Hrsg. und mit einem Essay von<br />
Robert Steiner und Emil Zopfi.<br />
Lenos, Basel 2007. 272 Seiten, Fr. 36.–.<br />
Von Angelika Overath<br />
Sie waren beide jung und charismatisch.<br />
Am 22. Juni 1936 stellt die «Zürcher<br />
Illustrierte» unter dem Titel «Daheim<br />
und draussen» zwei Weltreisende vor:<br />
Lorenz Saladin, den Bergsteiger, der<br />
zuletzt Touren im Kaukasus, im Pamirgebirge<br />
in Zentralasien und in den daran<br />
anschliessenden Tienschan unternommen<br />
hatte, und die androgyne Schönheit<br />
Annemarie Schwarzenbach, die mutige<br />
Fotoreporterin, einmal im Brautkleid an<br />
der Seite des Diplomaten Claude Clarac,<br />
das andere Mal männlich gekleidet<br />
bei einer archäologischen Ausgrabung.<br />
Lorenz Saladin, der meist mittellose<br />
Gelegenheitsarbeiter, und Annemarie<br />
Schwarzenbach, die höhere Tochter<br />
eines Zürcher Seidenweberei-Millionärs<br />
und einer Mutter aus der Generalsfamilie<br />
Wille, kannten sich nicht.<br />
Wenige Monate später, am 17. September<br />
1936, ist Lorenz Saladin tot. Er starb<br />
mit 39 <strong>Jahre</strong>n auf dem Rückweg nach der<br />
Besteigung des Siebentausenders Khan<br />
Tengri im Osten Kirgistans. Schwarzenbach<br />
erfährt zufällig vom Schicksal des<br />
Schweizer Bergsteigers. Sie trifft seinen<br />
jüngeren Bruder Peter und erhält<br />
von ihm die Vollmacht, Lorenz Saladins<br />
Hinterlassenschaften abzuholen. Als<br />
antifaschistischer Reporterin gelingt es<br />
ihr, die nötigen Visa zu bekommen und<br />
nach Moskau zu reisen. Sie befragt die<br />
russischen Bergsteigergefährten.<br />
Mit Notizbüchern Saladins und 1200<br />
Negativen von Fotografien, die er mit<br />
seiner Leica gemacht hatte, kehrt sie<br />
zurück und beginnt die Biografie jenes<br />
Mannes, von dem sie schreiben wird:<br />
«Er war kein Abenteurer, er wurde<br />
nicht blind durch die Kontinente gejagt,<br />
er floh nicht, er war ein Liebhaber der<br />
Welt.» War das so? Oder wünschte sie<br />
sich, dass es für ihn so gewesen sein<br />
möge? Mit keinem Wort geht sie zum<br />
Beispiel auf Saladins gescheiterte Heiratspläne<br />
ein.<br />
Dunkle Wahlverwandtschaft<br />
Im Juli 1938 schliesst Schwarzenbach<br />
während eines Drogenentzugs am<br />
Bodensee das Manuskript ab. Der Band<br />
erscheint im selben Jahr; er wird ihr zu<br />
Lebzeiten meistverkauftes Buch. Annemarie<br />
Schwarzenbach stirbt 1942 an den<br />
Folgen eines Fahrradunfalls in Sils im<br />
Engadin. Sie ist 35 <strong>Jahre</strong> alt geworden.<br />
<strong>Die</strong> nun erschienene Neuausgabe ihrer<br />
Saladin-Biografie verschränkt das Leben<br />
zweier Königskinder. Im Zentrum steht<br />
der dramatisch aufgebaute, atmosphärisch<br />
dichte Text von Schwarzenbach,<br />
der sich auch heute noch mit Spannung<br />
liest. <strong>Die</strong> Herausgeber – beide Schriftsteller<br />
und passionierte Bergsteiger<br />
MARC KINDERMANN / VISUM<br />
EWGENI ABALAKOW<br />
Tienschan-Gebirge in<br />
Kirgistan (oben).<br />
Lorenz Saladin sitzt<br />
erschöpft am Gipfel<br />
(unten).<br />
– haben ihm aber gleichsam eine historisch-kritische<br />
Einfassung gegeben. Aus<br />
dem Wissen und den Möglichkeiten der<br />
späteren Generationen heraus konnten<br />
Emil Zopfi (Jahrgang 1943) und Robert<br />
Steiner (Jahrgang 1976) Saladins Leben<br />
und die Umstände seiner Expeditionen<br />
recherchieren und in einem engagierten<br />
Nachwort darstellen. Sie profilieren<br />
nun die russischen Expeditionsteilnehmer<br />
deutlicher und korrigieren Fehler.<br />
Erschütternd ist ihr Abriss, der zeigt,<br />
wie viele der mutigen Bergsteiger an<br />
der Seite Saladins dem stalinistischen<br />
Terror zum Opfer fielen.<br />
Deutlich wird bei dieser sorgfältig<br />
gestalteten Neuausgabe zweierlei: Da<br />
sind die Lebenslinien eines leidenschaftlichen<br />
Jungen aus dem solothurnischen<br />
Schwarzbubenland, der gegen alle Konventionen<br />
zu einem der grössten Bergsteiger<br />
seiner Zeit wurde und zudem auf<br />
dem besten Weg war, ein renommierter<br />
Fotograf zu werden. Und da ist die dunkle<br />
Wahlverwandschaft, die eine junge,<br />
psychisch gefährdete Schriftstellerin<br />
und Fotoreporterin zu diesem fremden<br />
und ihr doch eigentümlich nahen Leben<br />
empfand. Schwarzenbach war keine<br />
Bergsteigerin, und doch hat sie mit viel<br />
Einfühlungsvermögen jene Leidenschaft<br />
beschrieben, die einen Menschen unter<br />
Einsatz des Lebens in die eisigen Höhen<br />
zieht. Auch die morphinabhängige<br />
Schwarzenbach hat sich nicht geschont,<br />
vielmehr suchte sie auf ihren Reisen<br />
immer wieder jene elementaren Härten<br />
extremer Landschaften, die ihr ein<br />
Gegengewicht zu dem unverstandenen<br />
Liebesentzug ihres Alltag waren.<br />
Reisen wie eine Irrende<br />
Saladins Tagebucheintragungen bestechen<br />
durch eine einfache, klare Sprache:<br />
«Wir gehen am Khan Tengri nicht etappenweise,<br />
sondern direkt mit schweren<br />
Säcken. Abmarsch um halb zehn Uhr<br />
abends, über den nach Süden abfallenden<br />
Gletscher, sehr leicht bei Mondlicht.»<br />
Seine Fotografien zeigen ihn als<br />
einen geduldigen und stilsicheren Beobachter,<br />
der einen Sinn für Bildkomposition<br />
und Dramatik hatte. <strong>Die</strong> Fotografin<br />
Schwarzenbach muss die Qualität der<br />
Aufnahmen sofort erkannt haben. Saladin<br />
fotografierte Etappen und Szenen<br />
der Besteigungen und immer wieder<br />
auch Momente der fremden Kulturen:<br />
komplizierte Nomadenzelte, Märkte,<br />
ein Mädchen beim Melken einer Stute,<br />
einen muslimischen Bauern im Mohnfeld,<br />
Reihen von Traktoren.<br />
Wer diese Bilder von Lorenz Saladin<br />
sieht, mag sich an den Nachruf von<br />
Arnold Kübler auf Annemarie Schwarzenbach<br />
erinnern und von hierher ihre<br />
erstaunliche Verbundenheit zu dem<br />
Schweizer Bergsteiger auf dem Dach<br />
der Welt verstehen: «Weil sie nicht wie<br />
eine Ausflüglerin reiste, sondern wie<br />
eine Irrende, gab es keine Schranken<br />
für ihre Anteilnahme am Fremden, und<br />
die Unvoreingenommenheit war ihre<br />
fruchtbare Begleiterin.» �<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 11
AP<br />
Essay<br />
<strong>Die</strong> russische Revolution wurde jahrzehntelang<br />
von westlichen Intellektuellen idealisiert. <strong>Die</strong>se<br />
verkennen auch heute das diktatorische Regime in<br />
Russland – und anderswo. Das ist eine Form von<br />
Korruption, schreibt Anne Applebaum<br />
Propaganda<br />
und Realität<br />
Vor neunzig <strong>Jahre</strong>n rollten zwei Revolutionswellen<br />
über Russland und fegten die zaristische<br />
Gesellschaft hinweg wie ein Kartenhaus. Alexander<br />
Kerenski, der Führer der ersten provisorischen<br />
Regierung, schrieb später einmal, nach<br />
der Abdankung des Zaren im März 1917 seien<br />
«alle politischen und taktischen Programme,<br />
so kühn und so gut durchdacht sie auch waren,<br />
ziel- und nutzlos im Raum gehangen».<br />
Obwohl die provisorische Regierung<br />
schwach, die Unzufriedenheit im Volk weitverbreitet<br />
und die Wut über die Schlächterei<br />
des Ersten Weltkriegs gross war, hatte kaum<br />
jemand erwartet, dass die Macht den Bolsche-<br />
Anne Applebaum<br />
<strong>Die</strong> US-Historikerin Anne Applebaum, 43, ist<br />
Kolumnistin und Mitglied der Chefredaktion<br />
der «Washington Post». Zuvor arbeitete<br />
die Russland-Expertin für den britischen<br />
«Economist» und andere Blätter in Warschau<br />
und London. Sie verfasste zwei Bücher zur<br />
osteuropäischen Geschichte: «Between East<br />
and West. Across the Borderlands in Europe»<br />
(1994) und «Gulag – A History» (2003). Für<br />
Letzteres erhielt sie den Pulitzer-Preis. Zurzeit<br />
arbeitet sie an einem Buch über die Errichtung<br />
der Sowjetherrschaft in Zentraleuropa nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg.<br />
Den vorliegenden Text schrieb Anne Applebaum<br />
für die «NZZ am Sonntag» zum 90.<strong>Jahre</strong>stag<br />
der russischen Revolution von 1917.<br />
12 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
wiken in die Hände fallen könnte. Im Ausland<br />
kannte man sie kaum. Nach einer bezeichnenden,<br />
aber kaum wahren Anekdote stürzte ein<br />
Beamter ins Büro des österreichischen Aussenministers<br />
und schrie: «Exzellenz, es gab eine<br />
Revolution in Russland.» Worauf der Minister<br />
grunzte: «Wer könnte schon eine Revolution<br />
in Russland machen. Sicher nicht der harmlose<br />
Herr T<strong>rot</strong>zki aus dem Cafe Central.»<br />
Er irrte sich: Am 25. Oktober 1917 – am 7.<br />
November neuerer Zeitrechnung – plünderte<br />
ein Mob den Winterpalast, angestiftet vom<br />
mysteriösen und launischen Bolschewiken-<br />
Führer Wladimir Iljitsch Lenin, und verhaftete<br />
die Minister der provisorischen Regierung,<br />
die dort residierten. In wenigen Stunden hatte<br />
Lenin seinen Staatstreich beendet und war<br />
Führer des Landes geworden, das er dann in<br />
Sowjetunion umbenannte.<br />
Putsch, Terror, Zwangswirtschaft<br />
Frieden gab es nicht. Wie heute oft vergessen<br />
wird, endeten die Kämpfe nicht mit dem bolschewistischen<br />
Putsch. In den <strong>Jahre</strong>n danach<br />
kam es zu blutigen Schlachten im ganzen Land,<br />
gefolgt von Hungersnöten, denen Hunderttausende<br />
zum Opfer fielen. Ungewählte Kommissare<br />
etablierten sich in den Dörfern und<br />
übten «revolutionäre Gerechtigkeit», was oft<br />
so viel hiess wie willkürliche Massenexekutionen.<br />
Während ihre neue Rote Armee auf dem<br />
Lande kämpfte, gaben sich die Bolschewiken<br />
in den Städten grosse Mühe, jede intellektuelle<br />
und politische Opposition zu vernichten.<br />
Neben dem Bürgerkrieg gab es den <strong>rot</strong>en Terror<br />
– Verhaftungen, Zwangsarbeitslager, Folter<br />
und Mord –, der manchmal abebbte, aber nie<br />
ganz aufhörte.<br />
In dieser Atmosphäre von Krieg und Gewalt<br />
wurde der sowjetische Staat geboren. Von<br />
Anfang an scheuten die Bolschewiken die<br />
Herrschaft des Rechts zugunsten von Willkürentscheidungen,<br />
mit dem Argument, dies<br />
sei im Moment unumgänglich, vor allem um<br />
die Gegenrevolution abzuwehren. <strong>Die</strong> meisten<br />
frühen Entscheidungen der Bolschewiken, auch<br />
die Gründung des Einparteienstaates und die<br />
Errichtung der ersten Zwangsarbeitslager, wurden<br />
damit gerechtfertigt. <strong>Die</strong> Wirtschaft wurde<br />
AKG<br />
Romantisierung der Revolution: «Ein Bolschewik»,<br />
Gemälde von Boris M. Kustodijew aus dem Jahr 1920.<br />
militarisiert – T<strong>rot</strong>zki selbst schwärmte davon,<br />
die Arbeiterschaft wie ein Bataillon zu führen<br />
–, und dabei blieb es. Solange es sie gab, konnte<br />
die Sowjetunion besser Waffen produzieren als<br />
Seife, B<strong>rot</strong> oder Möbel.<br />
Mit der Zeit politisierten die Bolschewiken<br />
auch die Gerichte, die Polizei, das Bildungswesen<br />
und schliesslich die ganze Kultur. Immer<br />
im Namen des Kampfes gegen reale und eingebildete<br />
Feinde beharrten sie auf der staatlichen<br />
Kontrolle aller Bereiche menschlicher Aktivitäten,<br />
von Fabriken und Minen bis zu Kindergärten,<br />
Markensammler-Vereinen und Schuhmacherbuden.<br />
Es wurde unmöglich, eine andere<br />
Meinung zu äussern, ja es wurde unmöglich,<br />
überhaupt ausserhalb staatlicher Kontrolle zu<br />
leben und zu arbeiten. In relativ kurzer Zeit
hatten die Bolschewiken die öffentlichen und<br />
privaten Institutionen ihres Landes so durchgreifend<br />
verändert, dass es unmöglich wurde,<br />
das Rad zurückzudrehen.<br />
Sie waren dabei so erfolgreich, dass vieles<br />
von dem, was heute in Russland passiert, immer<br />
noch dem Umbau der Gesellschaft zuzuschreiben<br />
ist, den Lenin 1917 begonnen hatte. Sogar<br />
im Russland von heute – über 15 <strong>Jahre</strong> nach dem<br />
Zusammenbruch der Sowjetunion von 1991 – ist<br />
das intellektuelle und kulturelle Erbe der Oktoberrevolution<br />
noch aussergewöhnlich stark. <strong>Die</strong><br />
Verdächtigung von Menschen und Organisationen,<br />
die nicht eindeutig mit dem Staat verbunden<br />
sind, das Desinteresse für Meinungsfreiheit<br />
und freie Presse, die Verachtung für Privatbesitz<br />
und für den Rechtsstaat, die paranoide Haltung<br />
gegenüber Ausländern und ausländischen<br />
Spionen: All diese Dinge sind seit den ersten<br />
umkämpften Tagen der Revolution nicht mehr<br />
zu trennen vom russischen Nationalbewusstsein,<br />
und sie sind immer noch da.<br />
Natürlich kann man argumentieren, dass<br />
einige dieser Elemente der nationalen Psychologie<br />
älter sind als die Revolution. Aber Lenin<br />
hat sie breiter und tiefer verankert. Stalin hat<br />
sie mit Terror durchgesetzt. Und nun gebraucht<br />
Wladimir Putin Geld und Propaganda, um sie in<br />
einem modernen, postsowjetischen Kontext am<br />
Leben zu erhalten.<br />
Das «Doublethink»-Prinzip<br />
<strong>Die</strong> Revolution schuf in der Sowjetunion eine<br />
Kulturform, die beispiellos ist. Ich habe bisher<br />
zwei Bücher geschrieben über die kommunistische<br />
Welt und arbeite nun an einem dritten.<br />
Das hat mir die Möglichkeit gegeben, mit vielen<br />
Menschen zu sprechen, die auf allen Ebenen der<br />
sowjetischen Gesellschaft gelebt und gearbeitet<br />
haben. Sie alle, ob sie nun früher Dissidenten,<br />
Häftlinge oder Beamte waren, beschreiben<br />
eine Gesellschaft, die von einer bizarren Dualität<br />
beherrscht wird. Auf der einen Seite eine<br />
Wirtschaft, die kaum funktionierte, mit leeren<br />
Läden und alten Frauen, die zu arm waren,<br />
um ihr Zimmer zu heizen. Auf der anderen<br />
Spruchbänder, die den Triumph des Sozialismus<br />
verkündeten und die «heroischen Errungenschaften<br />
des sowjetischen Vaterlandes».<br />
Wer nicht einverstanden war, wurde verhaftet.<br />
Und die Leute akzeptierten die Propaganda, aus<br />
Angst, aus Apathie und auch weil sie glaubten,<br />
sie würde irgendwann wahr werden.<br />
Auch dieses «Doublethink», wie es George<br />
Orwell genannt hatte – dass man zwei sich ausschliessende<br />
Ansichten miteinander vereinbaren<br />
kann –, war bereits in den frühesten Tagen<br />
der Revolution etabliert worden. <strong>Die</strong> Bolschewiken<br />
fühlten sich gezwungen, sofort den<br />
Sieg des Proletariats zu verkünden, obwohl<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 13
Essay<br />
der Kampf andauerte und obwohl Russland<br />
in Wahrheit von einer kleinen Gruppe von<br />
Intellektuellen regiert wurde, von denen viele<br />
das Proletariat zutiefst verachteten. Einige<br />
wenige Personen hatten schon damals schier<br />
unbegrenzte Macht, behaupteten aber vor der<br />
Öffentlichkeit, dass dem nicht so sei.<br />
Mit der Zeit lernten die Menschen einfach<br />
die Lücke zwischen Propaganda und Realität<br />
zu akzeptieren. Und auch hier ist festzustellen:<br />
<strong>Die</strong> Menschen in Putins Russland tun das<br />
immer noch. Putins momentaner Erfolg geht<br />
zum Teil auf das Geschick zurück, mit welchem<br />
er den Schein von Demokratie wahrt,<br />
während er sie in Wahrheit jedes bedeutungsvollen<br />
Inhaltes beraubt. So hat er es zum Beispiel<br />
immer abgelehnt, zum dritten Mal für die<br />
Präsidentenwahl anzutreten, weil dies gegen<br />
die Verfassung verstosse. Stattdessen will er<br />
nun Premierminister werden, und man kann<br />
davon ausgehen, dass er die russische Verfassung<br />
in diesem Sinne umschreiben wird. Putin<br />
hält sich unechte politische Parteien, kontrolliert<br />
die Medien, manipuliert Wahlen. Unabhängige<br />
Denker werden wie früher als ausländische<br />
Spione bezeichnet. Und doch bewahrt<br />
Putin die äusserlichen Formen einer verfassungsmässigen<br />
Demokratie, genau wie es die<br />
Sowjetunion einst tat – und für die meisten<br />
Russen ist das ganz akzeptabel.<br />
Romantisierung der Revolution<br />
Vielleicht kann man nichts anderes erwarten,<br />
als dass die Russen damals das bolschewistische<br />
Modell akzeptierten: Sich dagegenzustellen,<br />
hiess Verhaftung oder Tod. Und in der<br />
Gesellschaft hält sich noch immer eine latente<br />
Angst. Erstaunlicher ist im Rückblick das Ausmass,<br />
in dem Ausländer die Revolution bewunderten:<br />
von kambodschanischen Bauern und<br />
angolanischen Rebellen bis zu französischen<br />
Philosophen und britischen Politikern.<br />
Natürlich setzte diese Romantisierung der<br />
Revolution nicht sofort ein. In den 1920er <strong>Jahre</strong>n<br />
p<strong>rot</strong>estierten die westlichen Sozialisten,<br />
deren Genossen von den Bolschewiken ins<br />
Gefängnis geworfen wurden, lautstark gegen<br />
die Verbrechen der Revolution. Aber nach<br />
1930, als die Welt von einer Wirtschaftskrise<br />
geschüttelt wurde, änderte sich der Ton. Westliche<br />
Intellektuelle begannen, die Sowjetunion<br />
zu besuchen, wollten dort lernen, was man zu<br />
Hause gebrauchen konnte. In den USA wurde<br />
John Reed, ein amerikanischer Kommunist, der<br />
die Geschehnisse von 1917 beschrieben hatte,<br />
zu einer Art Volksheld, ebenso wie Lenin, die<br />
Hauptperson in Reeds Buch «Zehn Tage, die<br />
die Welt erschütterten».<br />
In den 1930er und 1940er <strong>Jahre</strong>n bemühte sich<br />
ein Teil der westlichen Linken sogar, den Terror<br />
zu erklären und zu entschuldigen, der damals<br />
die Sowjetunion verschlang, gerade weil sie<br />
gewisse Aspekte des sowjetischen Experiments<br />
zu Hause ausprobieren wollten. Damals wie<br />
später dienten westliche Sichtweisen auf Russland<br />
immer auch westlichen politischen Zielen:<br />
Besucher von Russland sahen allzu oft nur das,<br />
was ihren Anliegen zu Hause nützte.<br />
Seit 1989 ist die Oktoberrevolution als Politikum<br />
in den Hintergrund getreten: <strong>Die</strong> Haltung<br />
zur Sowjetunion spaltet westliche Politik<br />
nicht mehr, und kaum jemand sieht in Lenin<br />
noch etwas anderes als den ersten totalitären<br />
Diktator. T<strong>rot</strong>zdem lassen sich westliche Intellektuelle<br />
und Politiker noch immer zum Narren<br />
halten von den geistigen Erben der Revolution:<br />
von Wladimir Putin und seinen Imitatoren<br />
in Ländern wie Venezuela und Iran. Wie in<br />
der Vergangenheit sind wir immer noch allzu<br />
schnell bereit, die Korruption unserer eigenen<br />
Sprache zu tolerieren. <strong>Die</strong> Sowjetunion<br />
sprach von Frieden und unterhielt gleichzeitig<br />
14 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
RIA NOWOSTI / AKG<br />
<strong>Die</strong> Erstürmung des Winterpalasts am 25. Oktober<br />
(7. November) 1917 in St. Petersburg.<br />
die am meisten militarisierte Gesellschaft der<br />
Welt. Heute nennt sich Putin «Demokrat», um<br />
im Forum der G-8 akzeptiert zu werden. Mit<br />
seiner Art des Doublethink unterminiert er<br />
die westliche Kritik am eigenen undemokratischen<br />
Verhalten. Diktatorischen Verhaltens<br />
angeklagt, dreht er den Spiess um und erklärt,<br />
George W. Bush sei der wahre Diktator.<br />
Der Westen hat wenig gelernt<br />
Eine ganz ähnliche Taktik gebraucht der iranische<br />
Präsident Ahmadinejad: Als er im vergangenen<br />
Winter eine Anzahl von Holocaust-<br />
Leugnern einlud, den Holocaust in Teheran zu<br />
diskutieren, behauptete er, damit die «Dissidenten»<br />
des Westens in Schutz zu nehmen. Das<br />
ist eine atemberaubende Lüge von einem Mann,<br />
dessen Regime Akademiker einsperrt, weil sie<br />
das «Verbrechen» begangen haben, akademische<br />
Konferenzen zu organisieren.<br />
«Putin bewahrt die äusseren<br />
Formen einer verfassungs-<br />
mässigen Demokratie, genau<br />
wie es die Sowjetunion einst<br />
tat – für die meisten Russen<br />
ist das ganz akzeptabel.»<br />
Doch er bekam Applaus – ein Beweis dafür,<br />
dass wir im Westen t<strong>rot</strong>z der Erfahrung des<br />
vergangenen Jahrhunderts noch immer gerne<br />
an den guten Willen von fremden Diktatoren<br />
glauben, noch immer die revolutionäre Gewalt<br />
anderer Völker verherrlichen und noch immer<br />
beides durch das Prisma unserer eigenen politischen<br />
Debatten sehen. Wenn Putin oder Ahmadinejad<br />
den amerikanischen Präsidenten kritisieren,<br />
dann stimmen ihnen jene Europäer und<br />
Amerikaner zu, die Präsident Bush selbst auch<br />
nicht mögen. Meinungsumfragen zeigen, dass<br />
eine erstaunliche Zahl von Europäern Amerika<br />
für das gefährlichste Land der Welt hält – gefährlicher<br />
als Russland, das seine Nachbarn im Baltikum<br />
und in Georgien offen erpresst, einen<br />
versteckten Krieg in Tschetschenien führt und<br />
sein Öl als Waffe gegen die Europäer einsetzt;<br />
gefährlicher als Iran, das weltweit islamistische<br />
Terroristen unterstützt, und gefährlicher als<br />
Nordkorea, wo Hunderttausende Menschen<br />
in Konzentrationslagern sitzen, deren direktes<br />
Vorbild Stalins Gulag ist.<br />
<strong>Die</strong> Lektion ist ernüchternd: Wir haben im<br />
Westen wenig gelernt von der Katastrophe der<br />
russischen Revolution, der Zerstörung, die sie<br />
bewirkte, den vielen Menschenleben, die sie<br />
forderte und dem verheerenden Schaden, den<br />
sie Umwelt und Wirtschaft zufügte. Vielleicht<br />
sollten wir ihren 90. Geburtstag benutzen, um<br />
sie zu erforschen, darüber nachzudenken und<br />
sie neu zu bewerten – einmal mehr. �<br />
Übersetzung aus dem Amerikanischen von<br />
Kathrin Meier-Rust
GAËTAN BALLY / KEYSTONE<br />
Kolumne<br />
Charles Lewinskys Zitatenlese<br />
Charles Lewinsky,<br />
61, ist Schriftsteller,<br />
Radio- und TV-Autor<br />
und lebt in Frankreich.<br />
Sein Roman<br />
«Melnitz» (2006)<br />
wurde zum Bestseller.<br />
Entweder sie kaufen<br />
ein Buch und lesen<br />
es nicht. Oder sie<br />
leihen ein Buch und<br />
geben es nicht wieder und lesen es<br />
auch nicht. Oder sie geben es wieder<br />
und haben es nicht gelesen.<br />
Irmgard Keun<br />
Es soll hier nicht von allen Büchern<br />
die Rede sein, die kein Mensch liest.<br />
Davon gibt es wohl mehr, als wir<br />
Autoren uns gern eingestehen. Sondern<br />
nur von denen, über die man sich<br />
in ungelesener Weise fachmännisch<br />
äussert.<br />
In diesem von der Literaturwissenschaft<br />
sträflich vernachlässigten<br />
Forschungsbereich unterscheiden wir<br />
drei Untergruppen:<br />
Das gesellschaftliche Nichtlesen.<br />
Eine sehr nette Bekannte fühlte sich<br />
einmal der Höflichkeit halber verpflichtet,<br />
mir zu sagen, wie gut ihr<br />
doch einer meiner Romane gefallen<br />
habe. Ich fragte sie nach einer<br />
bestimmten Figur, und – o Wunder!<br />
– gerade dieser Charakter hatte ihr<br />
ganz besonderes Lesevergnügen bereitet.<br />
Obwohl die Figur in dem Buch gar<br />
nicht vorkam.<br />
<strong>Die</strong>se Art des Nichtlesens erwächst<br />
aus lobenswerter Absicht und erfreut<br />
den Autor zusätzlich, wenn sie mit<br />
dem tantiementrächtigen Kauf eines<br />
Buches (vorzugsweise Hardcover)<br />
verbunden ist.<br />
Das gebildete Nichtlesen.<br />
«Ulysses», «A la recherche du temps<br />
perdu» und «Der Mann ohne Eigenschaften».<br />
Im kulturelitären Diskurs<br />
ist es fast schon Verpflichtung,<br />
zumindest einmal pro Gespräch oder<br />
Kritik eines dieser drei Werke als<br />
Vergleichsgrösse anzuführen. Dabei<br />
spielt es keine Rolle, wenn man von<br />
den drei Büchern nicht mehr weiss,<br />
als dass in dem einen furchtbar komplizierte<br />
Wortspiele gemacht und in<br />
dem andern Madeleines gegessen<br />
werden (was immer das sein mag).<br />
Ach ja, und natürlich, dass Robert<br />
Musil kein österreichischer Fussballer<br />
ist. Ich habe bisher noch niemanden<br />
getroffen, der alle drei Bücher wirklich<br />
gelesen hätte. Aber sie machen sich im<br />
Gespräch ebenso gut wie im Regal.<br />
Das journalistische Nichtlesen.<br />
Es gibt Bücher, über die kann man<br />
als Journalist schreiben – und als<br />
Zeitungsleser fachkundig mitreden<br />
–, obwohl man nicht mehr von ihnen<br />
kennt als einen einzelnen Kernsatz.<br />
Und den hat wahrscheinlich ein Journalistenkollege<br />
aus dem Klappentext<br />
zitiert. Eva Hermans Bücher gehören<br />
zu dieser Kategorie. Niemand liest sie,<br />
aber jeder weiss, dass darin die Forderung<br />
aufgestellt wird: «Frauen zurück<br />
an den Herd!»<br />
Aber vielleicht muss man solche<br />
Bücher wirklich nicht<br />
lesen. Sonst ist man dann<br />
hinterher auf der Suche<br />
nach der eigenen verlorenen<br />
Zeit.<br />
Kurzkritiken Sachbuch<br />
Heidi Witzig: Wie kluge Frauen alt<br />
werden. Was sie tun und was sie lassen.<br />
Xanthippe, Zürich 2007. 320 Seiten, Fr. 34.–.<br />
Ob der feministische Impetus, der seit<br />
den siebziger <strong>Jahre</strong>n positive Frauenbilder<br />
propagiert, nun auch positive<br />
Altersbilder für Frauen hergibt? Das war<br />
die Ausgangsfrage für die Historikern<br />
Heidi Witzig, um Frauen in der dritten<br />
Lebensphase zu porträtieren, die beruflich<br />
aktiv waren und sich gegen patriarchalische<br />
Einschränkungen gewehrt<br />
hatten. Zusammengekommen sind 10<br />
feministisch engagierte Frauen mit Jahrgängen<br />
von 1917 bis 1944, die in der<br />
Schweiz leben, darunter Marthe Gosteli<br />
vom Archiv für Frauengeschichte, die<br />
Psychologin Julia Onken, die Basler Professorin<br />
Regina Wecker. <strong>Die</strong> selbstbewusst-lebensklugen,<br />
manchmal kämpferischen<br />
Interviews hat die Autorin nach<br />
Themen gebündelt: Beruf, Pensionierung,<br />
Geld, Beziehungen, Alter. Das ist<br />
etwas viel auf einmal – und vibriert doch<br />
mit weiblichem Mut, aktiver Lebensgestaltung<br />
und Selbstreflexion.<br />
Kathrin Meier-Rust<br />
Heiko Haumann (Hrsg.): <strong>Die</strong> Russische<br />
Revolution 1917. Studienbuch. Böhlau,<br />
Köln 2007. 182 Seiten, Fr. 23.–.<br />
<strong>Die</strong> Aufsatzsammlung von Heiko Haumann,<br />
Professor für Osteuropäische<br />
Geschichte an der Universität Basel,<br />
und seinem Team rückt einfache Teilnehmer<br />
der russischen Revolution<br />
und deren Lebenswelten ins Zentrum.<br />
Geschildert werden die Prägung im Exil<br />
– unter anderem in der Schweiz –, die<br />
revolutionären Ereignisse in Dörfern<br />
und an der Peripherie, auch aus Sicht<br />
eines Schweizer Reisenden (Hans Limbach).<br />
<strong>Die</strong> Autoren erörtern die Folgen<br />
der Umsturzes: Sozialismus, Gegenrevolution,<br />
Stalinismus, ebenso wie<br />
die Utopie vom neuen Menschen. Erst<br />
gegen Schluss verlässt Haumann die<br />
weitgehend historisierende Bilanzierung<br />
des Jahrhundertereignisses und<br />
wirft, etwas zögerlich, die Frage auf, ob<br />
die russische Revolution nicht als «Irrweg<br />
der Geschichte» abzulegen sei. Eine<br />
Zeittafel, ein Glossar, ein Personen- und<br />
ein Sachwortregister runden den handlichen<br />
Studienband ab.<br />
Urs Rauber<br />
Roderich Ptak: <strong>Die</strong> maritime Seidenstrasse.<br />
C. H. Beck, München 2007.<br />
368 Seiten, Fr. 43.70.<br />
Als Kolumbus sich im 15. Jahrhundert<br />
aufmachte, den Seeweg nach Indien zu<br />
entdecken, war er spät dran. Araber,<br />
Inder und vor allem Chinesen schipperten<br />
damals schon längst auf den Meeren<br />
zwischen Ostafrika, Indien, Japan und<br />
China. China galt in Asien als Grossmacht<br />
und beherrschte das, was der<br />
Sinologe Roderich Ptak die «maritime<br />
Seidenstrasse» nennt. Ptak beschreibt<br />
die Entwicklung der erfolgreichen asiatischen<br />
Seefahrt von ihren Anfängen,<br />
das heisst von den chinesischen Qin<br />
und Han im 3. Jahrhundert v. Chr., bis<br />
ins 16. Jahrhundert und eröffnet so völlig<br />
neue Perspektiven auf ein bis anhin<br />
– mindestens in Europa – vernachlässigtes<br />
Geschichtskapitel. In China hingegen<br />
erinnert man sich mit Stolz und<br />
neuem Selbstbewusstsein an diese Epoche,<br />
an die es heute anzuknüpfen gilt.<br />
Das Thema entbehrt damit nicht einer<br />
gewissen Aktualität.<br />
Geneviève Lüscher<br />
Harald Bergsdorf: <strong>Die</strong> neue NPD.<br />
Antidemokraten im Aufwind. Olzog,<br />
München 2007. 160 Seiten, Fr. 25.90.<br />
<strong>Die</strong> Nationaldemokratische Partei<br />
Deutschlands (NPD) gibt es als rechtsextremistische<br />
Splittergruppe schon<br />
seit 1964. Doch erst seit Udo Voigt, ein<br />
ehemaliger Hauptmann der Bundeswehr<br />
und Politologe, 1996 ihre Führung<br />
übernommen hat, hat sie sich zu einer<br />
aggressiven antikapitalistischen Kraft<br />
entwickeln können, die in zwei Parlamenten<br />
(Sachsen und Mecklenburg-<br />
Vorpommern) Einzug gehalten hat. Dass<br />
die Rechtspopulisten Deutschlands<br />
t<strong>rot</strong>zdem – im Vergleich zu Frankreich,<br />
Italien, Österreich und der Schweiz<br />
– geradezu marginal sind, warum man<br />
ihren dreisten Halbwahrheiten nicht<br />
mit Hysterie, sondern mit Argumenten<br />
entgegentreten sollte, gerade auch im<br />
Fernsehen, das erklärt der Bonner Politikwissenschafter<br />
Harald Bergsdorf in<br />
seiner wohltuend nüchternen und gut<br />
lesbaren Darstellung der Geschichte,<br />
Strategie, Ideologie und jüngsten Erfolge<br />
der NPD.<br />
Kathrin Meier-Rust<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 15
Sachbuch<br />
Schweizer Geschichte Eine neue Biografie schildert<br />
das Leben Saly Mayers, eines führenden, aber<br />
umstrittenen Exponenten der Schweizer Juden<br />
Plädoyer für<br />
einen<br />
Unverstandenen<br />
Hanna Zweig-Strauss: Saly Mayer,<br />
1882–1950. Ein Retter jüdischen Lebens<br />
während des Holocaust.<br />
Böhlau, Köln 2007. 392 Seiten, Fr. 66.–.<br />
Von Paul Stauffer<br />
<strong>Die</strong> quellennah erarbeitete Darstellung,<br />
die Hanna Zweig-Strauss dem Wirken<br />
von Saly Mayer (1882–1950) widmet,<br />
bemüht sich um eine gerechte Würdigung<br />
dieses zeitweise umstrittenen<br />
Repräsentanten des schweizerischen<br />
Judentums. Als geschäftsführender<br />
Sekretär und – seit 1936 – Präsident des<br />
Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes<br />
(SIG) fand der St. Galler Textilunternehmer<br />
sich in einer konfliktträchtigen<br />
Situation. Einerseits lag ihm<br />
viel daran, keinerlei Zweifel an seiner<br />
staatsbürgerlichen Loyalität und seinem<br />
Schweizer Patriotismus aufkommen zu<br />
lassen. Anderseits musste er befürchten,<br />
dass die Solidarität, die er als Jude<br />
seinen bedrohten Glaubensbrüdern in<br />
Hitlers Machtbereich schuldete, mit der<br />
restriktiven Grundtendenz der schweizerischen<br />
Ausländerpolitik früher oder<br />
später in Konflikt geraten würde.<br />
Partnerschaft mit Rothmund<br />
<strong>Die</strong> Autorin vermag zu zeigen, weshalb<br />
das hier angelegte Spannungspotenzial<br />
lange Zeit nicht zutage trat: Saly Mayer<br />
war peinlich darauf bedacht, mit dem<br />
für Ausländer- und Flüchtlingsfragen in<br />
Bern zuständigen Chefbeamten, Heinrich<br />
Rothmund, das bestmögliche Einvernehmen<br />
zu pflegen. Ende November<br />
1933 war Mayer ein erstes Mal mit<br />
Rothmund zusammengetroffen. Der<br />
oberste «Fremdenpolizist» benützte<br />
die Gelegenheit, klarzumachen, dass<br />
die Schweiz am bisher praktizierten<br />
Arbeitsverbot für jüdische Flüchtlinge<br />
festhalten werde. Im Übrigen verstehe<br />
sich die Schweiz nur als Transitland für<br />
die Weiterreise von Flüchtlingen, nicht<br />
als Ort dauernden Aufenthaltes.<br />
Mayer war mit Rothmunds Absicht,<br />
einen massiven Zustrom jüdischer<br />
Flüchtlinge und ihren Verbleib in der<br />
Schweiz nicht zuzulassen, grundsätzlich<br />
einverstanden. In ihren Motiven<br />
16 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
stimmten die beiden freilich nicht überein.<br />
Rothmund ging es darum, der Überfremdung<br />
– gelegentlich sprach er deutlicher<br />
von «Verjudung» – der Schweiz<br />
entgegenzuwirken. Mayer befürchtete<br />
von einem Anschwellen jüdischer Präsenz<br />
primär eine Zunahme des Antisemitismus,<br />
welche die mühsam gewonnene<br />
gesellschaftliche Anerkennung der<br />
alteingesessenen Schweizer Juden zu<br />
gefährden drohte.<br />
Hinzu kam, dass Mayer und seine<br />
Kollegen im Führungsgremium des SIG<br />
es als moralische Verpflichtung empfanden,<br />
die Kosten der Flüchtlingshilfe<br />
aus jüdischen Mitteln aufzubringen, d. h.<br />
weitgehend mit Spendengeldern der<br />
Schweizer Israeliten und Zuwendungen<br />
aus den USA zu finanzieren. Aber diese<br />
Finanzquellen waren naturgemäss nicht<br />
unerschöpflich, weshalb die Leitung<br />
des SIG einem unkontrollierten Einlass,<br />
namentlich von Juden aus Österreich<br />
nach dem «Anschluss» 1938, ablehnend<br />
gegenüberstand. Polizeihauptmann Grüninger<br />
war bei manchen St. Galler Juden<br />
nicht eben populär, und Saly Mayer sah<br />
damals in Heinrich Rothmund eher<br />
einen Verbündeten als einen Gegner.<br />
<strong>Die</strong> Autorin schliesst nicht aus, dass<br />
Mayer den Polizeioffizier bei Rothmund<br />
denunziert haben könnte.<br />
Als SIG-Präsident bewältigte Mayer<br />
im Alleingang ein enormes Arbeitspensum.<br />
Er entwickelte eine gewisse<br />
Neigung zu einsamen Entschlüssen und<br />
liess es an Sinn für Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Kommunikation weitgehend fehlen.<br />
Daraus erklärt sich zumindest teilweise,<br />
dass weder er selbst noch der SIG in<br />
den P<strong>rot</strong>eststurm einstimmten, mit dem<br />
weite Teile der schweizerischen Öffentlichkeit<br />
im August 1942 Rothmunds<br />
Erlass einer Grenzsperre «für Flüchtlinge<br />
nur aus Rassegründen» quittierten.<br />
Bekanntlich bewirkte diese Reaktion<br />
eine gewisse Lockerung der Aufnahmepraxis.<br />
Bei manchen Mitgliedern der<br />
SIG-Führung stiess Mayers Passivität<br />
auf lebhafte Kritik; man empfand seinen<br />
Kurs unbeirrbar loyaler «Partnerschaft»<br />
mit Rothmund als nicht mehr<br />
verantwortbar. Er musste als Präsident<br />
zurücktreten und übergab die Geschäfte<br />
im März 1943 seinem Nachfolger.<br />
PHOTOPRESS-ARCHIVE / KEYSTONE<br />
«Schwieriger, aber<br />
verdienstvoller<br />
und integrer Akteur<br />
der Zeitgeschichte»:<br />
SIG-Präsident Saly<br />
Mayer (1882–1950).<br />
<strong>Die</strong>se Demission bedeutete indes keineswegs<br />
das Ende von Mayers Engagement<br />
für die Sache der Juden. Schon<br />
seit 1940 vertrat er das American Jewish<br />
Joint Distribution Committee, kurz Joint<br />
genannt, in der Schweiz. <strong>Die</strong>ses bedeutende<br />
Hilfswerk leistete bereits seit<br />
1939 namhafte Beiträge an die Kosten<br />
der jüdischen Flüchtlingshilfe in der<br />
Schweiz, Zuwendungen, die zeitweise<br />
mehr als die Hälfte von deren Ausgaben-
udget deckten. 1939 betrug die Joint-<br />
Subvention 2 Millionen Franken, in den<br />
beiden folgenden <strong>Jahre</strong>n je 1,5 Millionen,<br />
um 1944 auf 3,3 Millionen Franken anzusteigen.<br />
Als weitgehend unabhängiger Gebieter<br />
über diese beträchtlichen Summen<br />
war Mayer eine Schlüsselfigur bei den<br />
jüdischen Hilfsbemühungen zugunsten<br />
der verfolgten Glaubensgenossen.<br />
Sein Zuständigkeitsbereich, zunächst<br />
auf die Schweiz beschränkt, weitete<br />
sich nach dem Kriegseintritt der USA<br />
auf das gesamte deutsch beherrschte<br />
Europa aus. Während Monaten setzten<br />
restriktive amerikanische Transfervorschriften<br />
die Fortsetzung der Hilfstätigkeit<br />
aufs Spiel. Erst die Schaffung einer<br />
eigenen Behörde für Angelegenheiten<br />
der Flüchtlingshilfe, des War Refugee<br />
Board (WRB), im Januar 1944 markierte<br />
das Ende der amtlichen amerikanischen<br />
Zurückhaltung gegenüber den humanitären<br />
Bemühungen zugunsten der Juden<br />
Europas.<br />
Der amerikanischen Gesandtschaft<br />
in Bern wurde ein Spezialist für diesen<br />
Tätigkeitsbereich, Roswell McClelland,<br />
zugeteilt. Zwischen ihm und Saly Mayer<br />
entwickelte sich eine freundschaftliche<br />
Zusammenarbeit. <strong>Die</strong>se sollte besonders<br />
wirksam werden, als Vertreter jüdischer<br />
Organisationen in Ungarn im Sommer<br />
1944 den Versuch unternahmen, die<br />
überlebende dortige jüdische Bevölkerung<br />
durch Verhandlungen mit der SS<br />
vor der Vernichtung zu retten.<br />
Retter von 1700 KZ-Juden<br />
Innerhalb der SS-Hierarchie – bis hinauf<br />
zu «Reichsführer» Heinrich Himmler<br />
– hegte man die Hoffnung, sich durch<br />
die Freilassung von Juden den Goodwill<br />
der Amerikaner, möglicherweise<br />
sogar ihre Bereitschaft zu einem Separatfrieden,<br />
erkaufen zu können. McClelland<br />
erwirkte von Washington die Einwilligung<br />
zu entsprechenden (Schein-)<br />
Verhandlungen, lediglich zum Zweck<br />
des Zeitgewinns. In seiner Eigenschaft<br />
als Repräsentant des Joint übernahm<br />
es Saly Mayer, mehrmals an der österreichischen<br />
Grenze mit SS-Offizieren<br />
zusammenzutreffen. <strong>Die</strong> von ihm<br />
hinhaltend geführten Verhandlungen<br />
blieben natürlich ergebnislos, aber als<br />
«Geste des guten Willens» liessen die<br />
SS-Leute immerhin nahezu 1700 ungarische<br />
Juden aus dem KZ Bergen-Belsen<br />
in die Schweiz ausreisen.<br />
Hanna Zweig-Strauss ist sehr gewissenhaft<br />
und im offenkundigen Bestreben<br />
zu Werk gegangen, die Vita Saly Mayers<br />
möglichst lückenlos und detailliert<br />
nachzuzeichnen. Gewisse Längen ihres<br />
Textes sind diesem Bemühen um biografische<br />
Vollständigkeit und Differenziertheit<br />
zuzuschreiben. Angesichts der<br />
streckenweise prekären Quellenlage ist<br />
der Autorin indes zu bescheinigen, dass<br />
ihr ein bemerkenswert instruktives, ausgewogenes<br />
Porträt eines schwierigen,<br />
aber bei aller Problematik verdienstvollen<br />
und integren Akteurs der Zeitgeschichte<br />
gelungen ist. �<br />
Paul Stauffer ist Historiker und war<br />
Schweizer Botschafter in Polen.<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 17
Sachbuch<br />
Erinnerungen <strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong>s Memoiren sind Bekenntnis und Rechtfertigung<br />
Vom Sponti zum Staatsmann<br />
<strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong>: <strong>Die</strong> <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong> <strong>Jahre</strong>.<br />
Deutsche Aussenpolitik – vom Kosovo<br />
bis zum Irak. Kiepenheuer & Witsch,<br />
Köln 2007. 444 Seiten, Fr. 41.50.<br />
Jürgen Schreiber: Meine <strong>Jahre</strong> mit<br />
<strong>Joschka</strong>. Nachrichten von fetten und<br />
mageren <strong>Jahre</strong>n. Econ, Berlin 2007.<br />
207 Seiten, Fr. 35.40.<br />
Von Gerd Kolbe<br />
Witzig und schlagfertig, angriffslustig<br />
und gelegentlich auch wehmütig, nie um<br />
eine Antwort und erst recht um keine<br />
Provokation verlegen. So kennen die<br />
Deutschen – und nicht nur sie – ihren<br />
früheren Aussenminister und viele <strong>Jahre</strong><br />
heimlichen Vorsitzenden der Grünen<br />
<strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong>. Er war und ist ein Mann<br />
der losen Zunge und, wie sein Buch über<br />
die sieben <strong>Jahre</strong> der <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong> Regierung<br />
zeigt, ein Meister der Rede, nicht<br />
aber des geschriebenen Wortes.<br />
Seine Memoiren enttäuschen. Man<br />
spürt förmlich, wie sich einer über 444<br />
Seiten quälte und alles, was ihn bewegte,<br />
für die Nachwelt detailliert aufschreiben<br />
wollte. So detailliert, dass im ersten Band<br />
nur die ersten zwei von sieben <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong><br />
Regierungsjahren überhaupt vorkommen.<br />
Das Buch unterscheidet sich<br />
nur wenig von den üblichen Politiker-<br />
Erinnerungen. Auch der sonst so kritische<br />
<strong>Fischer</strong> war nicht gegen die Versuchung<br />
gefeit, eine Rechtfertigungsschrift<br />
zu verfassen, und zwar vor allem wohl<br />
für die Grünen selbst, mit deren Bundespartei<br />
er, wie er reichlich spät bekennt,<br />
nie richtig warm geworden sei.<br />
Nagelprobe der Grünen<br />
Das ausführlichste Kapitel, <strong>Fischer</strong>s<br />
langatmige Schilderung des Kosovo-<br />
Konflikts, erinnert daran, wie schwer<br />
sich gerade seine Partei mit der ersten<br />
deutschen Kriegsbeteiligung nach<br />
1945 tat. Gern wären er und die Grünen<br />
«an einer heissen Konfrontation vorbeigekommen»,<br />
schreibt er. Innerhalb<br />
weniger Minuten jedoch habe er, ohne<br />
Möglichkeit der Abstimmung mit Partei<br />
und Fraktion, eine der weitreichendsten<br />
politischen Entscheidungen in seinem<br />
politischen Leben zu treffen gehabt. Ein<br />
Nein zur Nato-Intervention in Kosovo<br />
hätte die <strong>rot</strong>-grüne Koalition bereits im<br />
Herbst 1998 beendet. «Warum», so fragt<br />
er und hadert, «musste ausgerechnet<br />
die erste Bundesregierung, die von der<br />
politischen Linken gebildet worden war,<br />
mit Deutschland wieder in den Krieg<br />
ziehen?» Für den Fall der Ablehnung<br />
am Parteitag der Grünen in Bielefeld,<br />
so erfährt man, wollte er nicht nur als<br />
Minister zurücktreten, sondern auch<br />
Partei und Fraktion verlassen.<br />
Folgt man <strong>Fischer</strong>s Darstellung, so<br />
war er es, der vom ersten Tag der Luftangriffe<br />
auf Serbien an im Kreis der<br />
Kosovo-Kontaktgruppe auf eine friedliche<br />
Lösung drängte. Auch heute noch<br />
kommt es einem erstaunlich vor, wie<br />
schnell sich <strong>Fischer</strong> auf dem diplomati-<br />
18 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
CHARLES DHARAPAK / AP<br />
<strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong> mit<br />
Journalisten, nach<br />
einem Treffen im<br />
Weissen Haus mit<br />
Dick Cheney, 2003.<br />
schen Parkett zurechtfand und wie gut<br />
seine Zusammenarbeit mit US-Aussenministerin<br />
Madeleine Albright funktionierte.<br />
Fast wirkt es, als hätte die Chefin<br />
des State Department einen Narren<br />
am deutschen Aussenseiter gefressen.<br />
Spöttisch erwähnt <strong>Fischer</strong> demgegenüber<br />
die «glorious nations» und meint<br />
damit Grossbritannien und Frankreich.<br />
Sie unterzogen den neuen Kollegen<br />
zunächst einmal einem Härtetest mit<br />
dem Versuch, Deutschland und Italien<br />
aus der geplanten Friedenskonferenz<br />
herauszuhalten. Vergessen hat es ihnen<br />
<strong>Fischer</strong> offenbar nie.<br />
Selbst die Spitzenbeamten im Auswärtigen<br />
Amt hatten anfangs ihre Probleme<br />
mit dem Grünen, der doch aus der<br />
Frankfurter Spontiszene kam. Genüsslich<br />
und mit der ihm eigenen Gabe zur Ironie<br />
erzählt er, wie er Verdacht schöpfte. Bei<br />
der Vorbereitung eines Nato-Aussenministertreffens<br />
hatte er den Eindruck,<br />
dass seine Staatssekretäre ihm nur<br />
belanglose Dokumente, aber keine mit<br />
Geheimstempeln versehenen Papiere<br />
vorlegten. Er sah sich an die britische<br />
Fernsehserie «Yes Minister» erinnert,<br />
in der ein Tropf von Ressortchef von<br />
seinen Beamten gesteuert wird. <strong>Fischer</strong><br />
p<strong>rot</strong>estierte lautstark und war hinterher<br />
sicher, dass seine Mitarbeiter ihn ernst<br />
nahmen.<br />
Den stärksten Eindruck hinterlässt<br />
<strong>Fischer</strong>s energisches Bekenntnis zur<br />
deutschen Verantwortung für Israel.<br />
Seine Beschreibung der verfahrenen<br />
Situation im Nahen Osten ist lesenswert.<br />
Er macht kein Hehl daraus, dass er<br />
Israels Premier Sharon grossen Respekt<br />
zollt. Scharf urteilt er über seine Zeitgenossen.<br />
Seine Abneigung gegenüber<br />
dem französischen Präsidenten Chirac<br />
zum Beispiel ist überdeutlich. Ihm krei-<br />
det er den Niedergang der deutsch-französischen<br />
Beziehungen an. <strong>Fischer</strong> trauert<br />
der Europapolitik Helmut Kohls nach<br />
und beklagt Gerhard Schröders «emotionale<br />
Distanziertheit gegenüber Europa».<br />
Es ist dies nicht die einzige Kritik an seinem<br />
früheren Regierungschef.<br />
«Ich und <strong>Fischer</strong>»<br />
Das andere <strong>Fischer</strong>-Buch, das ebenfalls<br />
neu erschienen ist, stammt von Jürgen<br />
Schreiber, einem Reporter, der sich<br />
zugute hält, den Leitwolf der Grünen<br />
aus gemeinsamer Hausbesetzer- und<br />
Spontizeit in Frankfurt zu kennen. Der<br />
Titel «Meine <strong>Jahre</strong> mit <strong>Joschka</strong>» täuscht<br />
indes eine Nähe vor, die es zumindest<br />
zum Schluss so nicht mehr gab. <strong>Die</strong><br />
Überschrift «Ich und <strong>Fischer</strong>» würde<br />
der Sache eher gerecht. Natürlich bietet<br />
Schreiber das völlige Kontrastprogramm<br />
zur staatsmännischen Bilanz <strong>Fischer</strong>s.<br />
In Schreibers teilweise amüsanten, aber<br />
nicht für Historiker-Archive tauglichen<br />
Reflexionen über <strong>Fischer</strong> bleibt der spätere<br />
Aussenminister stets der Strassenkämpfer,<br />
Fotolehrling, Taxifahrer, Antiquar,<br />
Putzmacher und Müssiggänger aus<br />
dem Frankfurter Westend.<br />
Aus seiner militanten Vergangenheit<br />
habe er nie ein Geheimnis gemacht, verteidigt<br />
sich demgegenüber <strong>Fischer</strong>. Mit<br />
der Behauptung aber, den Unionsparteien<br />
sei es bei der lautstarken Kontroverse<br />
2001 um «eine ideologische Gesamtabrechnung<br />
mit der Generation der 68er»<br />
gegangen, überschätzt er die damalige<br />
Opposition und auch die eigene Bedeutung.<br />
<strong>Die</strong> CDU wollte von ihrer eigenen<br />
Krise ablenken und die <strong>rot</strong>-grüne Regierung<br />
ins Stolpern bringen. Das Auftauchen<br />
einer Foto, die <strong>Fischer</strong> zeigt, wie<br />
er auf einen Polizisten einschlagen will,<br />
kam dazu wie gerufen. �
Deutscher Herbst Eine neue Darstellung des RAF-<br />
Terrors verharrt in mediengängigen Klischees<br />
Baader, Meinhof und<br />
Sympathisanten<br />
Willi Winkler: <strong>Die</strong> Geschichte der RAF.<br />
Rowohlt, Berlin 2007. 528 S., Fr. 40.40.<br />
Von Heribert Seifert<br />
Über die deutschen Terroristen Baader,<br />
Meinhof und Co, die sich zur Rote-<br />
Armee-Fraktion (RAF) erklärt hatten,<br />
ist anscheinend immer noch nicht alles<br />
gesagt. Auch jetzt erscheinen weitere<br />
Bücher zum Thema, so eine neue Gesamtdarstellung,<br />
die uns «die Geschichte der<br />
RAF» verspricht. Der Journalist Willi<br />
Winkler will hohen Ansprüchen gerecht<br />
werden, wenn er den Leser auf den deutschen<br />
«Sonderweg» unterdrückter oder<br />
gescheiterter Revolten einstimmt, auf<br />
dem Baader, Meinhof und andere unterwegs<br />
gewesen sein sollen.<br />
Der Autor holt weit aus und beginnt<br />
in den fünfziger <strong>Jahre</strong>n der Bonner<br />
Republik. Kurzbiografien der späteren<br />
Terror-P<strong>rot</strong>agonisten wechseln mit<br />
knappen Skizzen deutscher Nachkriegspolitik.<br />
Chronologisch reihen sich die<br />
Stationen aneinander: die Revolte der<br />
Studenten in Berlin, Radikalisierungsschübe,<br />
der Wechsel von der Gewalt der<br />
Worte zu den Waffen, Fahndung und<br />
Verhaftung, der Stammheimer Prozess<br />
und die Selbstmorde, natürlich auch die<br />
Schleyer-Entführung und die späteren<br />
Morde an führenden Repräsentanten<br />
des «Schweine-Systems», schliesslich<br />
die triste Endphase einer nur noch mit<br />
der Logistik des Überlebens im Untergrund<br />
befassten Desperado-Truppe.<br />
<strong>Die</strong> fragwürdige Rolle, die der Staatsschutz<br />
zeitweise spielte, wird ebenso<br />
erwähnt wie die «Waffenbrüderschaft»<br />
der DDR.<br />
Verarbeitet ist nicht bloss die kaum<br />
noch überschaubare Literatur zum<br />
Thema. Winkler hat auch mit Zeitgenossen<br />
Kontakt gehabt und ihre Informationen<br />
eingearbeitet. Neues hat er dabei<br />
nicht zutage gefördert. Mit ein paar<br />
steilen Thesen versucht er aber seiner<br />
bieder-fleissigen Ereignisgeschichte, die<br />
angesichts der Stofffülle kaum je Tiefenschärfe<br />
gewinnt, Gewicht zu geben.<br />
So heisst es am Schluss des Buches:<br />
«Eine Historisierung der RAF kann aber<br />
nicht gelingen, solange der Zusammenhang<br />
zwischen dem Sündenfall des Staates<br />
und der Feindschaft gegen den Staat<br />
nicht eingestanden wird.» Das gehört<br />
zwar zu den mediengängigen Wandersagen<br />
über die «Mitschuld» des Staates<br />
am deutschen Terrorismus, kann aber<br />
auch bei Winkler plausibel nur wirken,<br />
wenn man mit einem Tunnelblick auf<br />
die damaligen deutschen Verhältnisse<br />
blickt und bloss Notstandsgesetze, die<br />
Unterstützung für den Vietnamkrieg<br />
der USA und die recht ruppige Praxis<br />
der Berliner Polizei sieht.<br />
Wer auch die andere Seite ausleuchtete,<br />
müsste Willy Brandt als Aussenminister<br />
und Kanzler der sozialliberalen<br />
Koalition ins Blickfeld rücken. Der<br />
sähe auch die Einführung der Mitbestimmung,<br />
den grosszügigen Ausbau<br />
des Sozialstaats und den Aufbruch ins<br />
Offene auf vielen gesellschaftlichen<br />
Feldern. Von «bleierner Zeit» im «deutschen<br />
Herbst» bleibt da wenig, wie<br />
einsichtige Linke längst eingestanden<br />
haben. Eine solch abwägende Situierung<br />
Von der Rote-Armee-<br />
Fraktion entführt<br />
und ermordet:<br />
Arbeitgeberpräsident<br />
Hanns-Martin<br />
Schleyer, 1977.<br />
Sozialwerk <strong>Die</strong> erste unabhängige Darstellung über den bekannten Schweizer Arzt<br />
Der Fall Guido Zäch als Wirtschaftskrimi<br />
Peter Zihlmann: Dr. Guido A. Zäch.<br />
Wohltäter oder Täter? Orell Füssli,<br />
Zürich 2007. 205 Seiten, Fr. 39.80.<br />
Von Markus Häfliger<br />
In nur zwei <strong>Jahre</strong>n ist es das dritte Buch<br />
über Guido A. Zäch – und das erste,<br />
das sich zu lesen lohnt. Das erste Buch<br />
«Für immer und ewig?» von Balz<br />
Theus war eine Streitschrift in Zächs<br />
Straf prozess. Auch Trudi von Fellenberg-<br />
Bitzis Heiligendarstellung «Guido<br />
A. Zäch – ohne Wenn und Aber» wurde<br />
von Zächs Paraplegikerstiftung finanziert.<br />
Peter Zihlmann ist nun der erste<br />
unabhängige Autor, der sich der Figur<br />
Guido A. Zäch annimmt.<br />
Sein Wirtschaftskrimi erzählt den<br />
Aufstieg des berühmtesten Schweizer<br />
Arztes – von seinen Anfängen in Basel<br />
bis zum Bau des Paraplegikerzentrums<br />
in Nottwil. Zäch wird geschildert als<br />
Macher und Visionär, der eine Milliarde<br />
Franken für die Querschnittgelähmten<br />
sammelt, mit der Zeit aber immer selbstherrlicher<br />
wird. Wie er sich mit der<br />
Paraplegikerstiftung ein Reich erschafft,<br />
in dem er fast ohne Kontrolle schaltet<br />
und waltet. Zihlmann korrigiert auch<br />
das Bild, wonach der Strafprozess Zäch<br />
ohne Vorwarnung getroffen habe: Mehrere<br />
Mitstreiter hatten intern jahrelang<br />
für Machtbeschränkung gekämpft - vergeblich.<br />
<strong>Die</strong>se Vorgänge, Zächs Vetternwirtschaft<br />
und seine Tobsuchtsanfälle<br />
sind vielfach belegt mit Sitzungsp<strong>rot</strong>o-<br />
AP<br />
des Terrorismus erspart sich Winkler<br />
ebenso wie eine kritische Prüfung der<br />
Behauptung, die RAF sei eine Antwort<br />
auf die deutsche NS-Geschichte gewesen.<br />
<strong>Die</strong> Täter haben damit wiederholt<br />
operiert, ihr Handeln dementierte solche<br />
Parolen. Winkler vermeidet eine<br />
klare Analyse dieser Doppelbödigkeit,<br />
bedient sich stattdessen vor allem suggestiver<br />
Anspielungen, indem er etwa<br />
durch einen Verweis auf die Geschwister<br />
Scholl im Zweiten Weltkrieg Baader<br />
und Meinhof in eine diffuse Nähe zum<br />
legitimen Widerstand rückt.<br />
Bei dieser Anlage des Buches überrascht<br />
es nicht, dass der Autor auf das<br />
einzige Rätsel nicht eingeht, das der<br />
deutsche Terrorismus bis heute stellt:<br />
warum Baader-Meinhof so lange Sympathie<br />
und Verständnis im intellektuellen<br />
und publizistischen Milieu gefunden<br />
haben. <strong>Die</strong>ses «Gespenst» aus jener Zeit<br />
kann Geisterjäger Winkler nicht finden<br />
– weil er es nicht sehen will. �<br />
kollen und Zeugenaussagen. Schade nur,<br />
dass Zihlmann die Fakten immer wieder<br />
mit blumigen Vergleichen aus der griechischen<br />
Mythologie vermischt.<br />
Im zweiten Teil nimmt Zihlmann<br />
einen seltsamen Perspektivenwechsel<br />
vor: Aus dem Machtmenschen wird das<br />
Justizopfer Zäch, das keine Chance auf<br />
ein gerechtes Urteil hat und wegen Veruntreuung<br />
verurteilt wird. Zwar weist<br />
der Autor zu Recht auf Widersprüche in<br />
der Argumentation der Justiz hin. Doch<br />
schwingen hier auch Ressentiments mit,<br />
die mit Zihlmanns beruflicher Karriere<br />
als Basler Anwalt und Richter zusammenhängen<br />
dürften. «Wohltäter oder<br />
Täter?» – so der Untertitel. T<strong>rot</strong>z einigen<br />
Schwächen erlaubt das Buch dem Leser,<br />
sich ein eigenes Urteil zu bilden. �<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 19
Sachbuch<br />
Staatskunde Der Diplomat Paul Widmer legt Wurzeln und Potenzial des Sonderfalls Schweiz offen<br />
– und führt damit weg von einer mürrischen Debatte in den neunziger <strong>Jahre</strong>n<br />
Offenheit und dezenter Patriotismus<br />
Paul Widmer: <strong>Die</strong> Schweiz als Sonderfall.<br />
Grundlagen – Geschichte – Gestaltung.<br />
NZZ Libro, Zürich 2007. 250 S., Fr. 45.–.<br />
Von Urs Rauber<br />
In den neunziger <strong>Jahre</strong>n des 20. Jahrhunderts<br />
mit ihrem Kult zur Selbstbezichtigung<br />
galt der Begriff Sonderfall Schweiz<br />
unter Intellektuellen als hochtoxische<br />
Vokabel, gemieden wie die Pest. Er stand<br />
für Retro-Denken und die Verbohrten im<br />
Land. Heute schreibt Paul Widmer, der<br />
Verfasser einer engagierten und gründlichen<br />
Publikation: «<strong>Die</strong>ses Buch ist ein<br />
Bekenntnis zum Sonderfall.»<br />
Dabei stützt sich der Autor nicht allein<br />
auf eine durchwegs überzeugende Argumentation.<br />
Er weiss sich auch in<br />
Übereinstimmung mit einem seit 2001<br />
feststellbaren Meinungswandel. Eine<br />
Mehrheit der Jugend wünscht sich,<br />
wie die Rekrutenbefragungen von 2003<br />
ergaben, den Sonderfall zurück, auch<br />
welsche und Tessiner Jugendliche –<br />
Letztere sogar stärker als der Schweizer<br />
Durchschnitt. Bei älteren Generationen<br />
hat, wie andere repräsentative Umfragen<br />
zeigen, die Zustimmung zum «Sonderfall<br />
Schweiz» ebenfalls zugenommen: von<br />
25 Prozent (1992) auf 41 Prozent (2003).<br />
<strong>Die</strong> Expo 02 und die Swissness-Welle<br />
seit Beginn dieses Jahrhunderts stützen<br />
den Paradigmawechsel augenfällig.<br />
Dabei ist das Sonderfall-Denken diesmal<br />
kein Ausdruck rückwärtsgewandter<br />
Sehnsucht, sondern ein Wunsch nach<br />
Modernisierung, verbunden mit jenem<br />
nach Autonomie und Eigenständigkeit,<br />
wie der Verfasser schreibt.<br />
«Soft power» der Schweiz<br />
Dass der Blick auf den Sonderfall von<br />
aussen stammt, scheint kein Zufall. Paul<br />
Widmer, 58, ist promovierter Historiker<br />
und Schweizer Botschafter in Amman;<br />
zuvor war er Botschafter in Zagreb und<br />
Berlin. Der Diplomat, der nicht nur die<br />
differenzierte Ausdrucksweise, sondern<br />
auch die klare Sprache kennt, verfasste<br />
mehrere Bücher, das zweitjüngste unter<br />
dem Titel «Schweizer Aussenpolitik<br />
und Diplomatie» (2003). <strong>Die</strong> Erfahrung<br />
der Welt und die Distanz zur Heimat<br />
ermöglichen, zusammen mit analytischem<br />
Scharfsinn, den Blick auf das<br />
Wesentliche.<br />
Widmer zählt die Schweiz zu den am<br />
stärksten internationalisierten Staaten<br />
der Welt, sie sei geradezu «ein Schrittmacher<br />
der Globalisierung». Er zitiert<br />
den Dekan einer anerkannten Schule<br />
für Politikwissenschaft in Singapur, der<br />
über unser Land sagt, es sei zwar keine<br />
Grossmacht, verfüge aber über «enorm<br />
viel soft power». Das renommierte US-<br />
Magazin «Science» hielt seinerseits<br />
in einer Untersuchung der nationalen<br />
Eigenschaften der Völker von 2005 fest,<br />
die Schweizer seien «von allen Nationen<br />
am weltoffensten».<br />
20 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
MARTIN RÜTSCHI / KEYSTONE<br />
«<strong>Die</strong> Schweiz steht<br />
und fällt mit dem<br />
Grad an Freiheit, den<br />
sie ihren Bürgern<br />
verschafft.»<br />
<strong>Die</strong>se gesellschaftliche Verfassung<br />
hängt laut Widmer entscheidend mit<br />
dem Sonderfall Schweiz zusammen, der<br />
auf vier Säulen beruht: direkte Demokratie,<br />
Föderalismus, aussenpolitische<br />
Neutralität und sprachlich-kulturelle<br />
Vielfalt. Der Autor untersucht die vier<br />
Elemente in ihrem geschichtlichen Werden,<br />
ihrer politischen Gestaltungskraft<br />
und ihrer Zukunftsfähigkeit. Dass dabei<br />
nicht alles genuin helvetisch ist, zeigt er<br />
beispielsweise am föderalistischen System,<br />
das 1848 aus den USA importiert<br />
wurde.<br />
Zu den schweizerischen Besonderheiten<br />
gehört ferner ein ausgeprägter<br />
Anti-Zentralismus, der sich etwa darin<br />
äusserte, dass Appenzell Innerrhoden<br />
100 <strong>Jahre</strong> lang alle eidgenössischen Vorlagen<br />
abgelehnt habe und es auch heute<br />
noch schwieriger sei, etwa die Schwyzer,<br />
Obwaldner und Walliser Kantonsbürger<br />
von den Vorteilen einer Bundesvorlage<br />
zu überzeugen als von deren Nachteilen.<br />
Der Verfasser skizziert seine Heimat als<br />
nüchternes, austariertes Staatsgebilde,<br />
das eine Idee verkörpere. Zu den ungeschriebenen<br />
Gesetzen gehören der Vor-<br />
rang von Freiheit und Selbstverantwortung,<br />
helvetische Tugenden wie Einvernehmlichkeit,<br />
Bedächtigkeit, Sparsamkeit<br />
in öffentlichen Dingen, ein hohes<br />
Bürgerengagement (das Milizprinzip)<br />
und aussenpolitische Zurückhaltung.<br />
Das Volk als Opposition<br />
In der Schweiz, dem «prägnantesten<br />
Beispiel einer Konkordanzdemokratie»,<br />
liege die eigentliche oppositionelle<br />
Kraft beim Volk. «<strong>Die</strong> direkte Demokratie<br />
wacht darüber, dass die Mehrheit<br />
nicht in satter Fülle erschlafft.» Wie<br />
die anderen drei Säulen ist auch die<br />
Neutralität mit ihrer auf Bruder Klaus<br />
zurückgehenden Maxime «Mischt euch<br />
nicht in fremde Händel» bis heute tief<br />
im Volk verankert. So sprachen sich in<br />
einer ETH-Umfrage von 2006 insgesamt<br />
90 Prozent der Befragten dafür aus, sie<br />
beizubehalten – im Unterschied zur<br />
politischen Elite, die weit skeptischer<br />
eingestellt ist. Der Diplomat Widmer<br />
kritisiert denn auch den 1996 erfolgten<br />
Beitritt der Schweiz zur Nato-Partnerschaft<br />
für den Frieden und das offizielle<br />
«Verständnis» für den Kosovo-Krieg
ohne Uno-Mandat im Jahr 1998, statt<br />
dass die klare Völkerrechtsverletzung<br />
verurteilt worden wäre.<br />
<strong>Die</strong> Weltoffenheit des Landes erklärt<br />
Widmer aus drei Faktoren, die genuin<br />
zum Staat Schweiz gehören: erstens<br />
bilde die Schweiz eine Willensnation;<br />
eine solche müsse sich stets erneuern,<br />
sei also dynamischer angelegt als<br />
eine Kulturnation. Zweitens seien in<br />
der direkten Demokratie die Durchschnittsbürger<br />
besser informiert als in<br />
andern Staaten, was die argumentative<br />
Auseinandersetzung fördere. Drittens<br />
widersetze sich der Föderalismus der<br />
Einheitlichkeit und biete stets mehrere<br />
Handlungsvarianten an, was ebenfalls<br />
die geistige Offenheit fördere.<br />
«Den Sonderfall pflegen»<br />
Paul Widmer ist nicht nur aufmerksamer<br />
Beobachter, sondern auch engagierter<br />
Staatsbürger, der vor möglichen Gefahren<br />
wie dem schwindenden Gemeinsinn<br />
oder einem überbordenden staatlichen<br />
Regulierungseifer warnt. <strong>Die</strong> Schweiz<br />
stehe und falle mit dem Grad von Freiheit,<br />
den sie ihren Bürgern verschaffe. Er<br />
plädiert dafür, sich «nicht bloss mürrisch<br />
mit dem Sonderfall abzufinden, sondern<br />
ihn bewusst zu pflegen». Er habe nämlich<br />
nichts mit Engstirnigkeit und Eigennutz,<br />
jedoch sehr viel mit Weltoffenheit<br />
und dezentem Patriotismus zu tun. <strong>Die</strong>ses<br />
Buch dürfte zu einem Standardwerk<br />
des schweizerischen Staats- und Gesellschaftsverständnisses<br />
in künftigen Diskussionen<br />
werden. �<br />
Christine Moser<br />
Weltwetter<br />
Über 650 Abbildungen von Zeitungsausschnitten gesammelt von<br />
Christine Moser mit einem Textbeitrag von David Signer,<br />
170 x 230 mm, 336 Seiten, Broschur mit amerikanischem Umschlag<br />
ISBN 978-3-905810-01-1, CHF 48.–, plus Versandkosten<br />
Über zwei <strong>Jahre</strong> hat Christine Moser die Satellitenbilder<br />
der Wetterseite aus der Neuen Zürcher Zeitung ausgeschnitten<br />
und gesammelt. <strong>Die</strong> schwarz weissen Abbildungen<br />
dokumentieren zusammen mit den zufälligen Ausschnitten<br />
aus den Vermischten Meldungen auf den Rückseiten<br />
überraschend poetisch unseren Zeitgeist. Das Aufeinandertreffen<br />
fragmentarischer Alltagsmeldungen weckt<br />
unterhaltsame und kritische Assoziationen zu einer kuriosen Welt.<br />
JAFFER<br />
Maharadschas Pracht und Herrlichkeit<br />
Der Buchautor Amin Jaffer ist Direktor für asiatische<br />
Kunst des Auktionshauses Christie’s in London<br />
und gilt als Indien-Spezialist. Nachdem Britannien<br />
den indischen Fürsten die Integrität ihrer Staatsgrenzen<br />
zugesichert hatte, waren die Maharadschas<br />
nicht mehr gezwungen, kostspielige Armeen zu<br />
finanzieren – ihr Reichtum mehrte sich dadurch ins<br />
Un ermessliche. Zugleich kamen Luxusgüter aus<br />
Europa in den Stand höchster Wertschätzung. <strong>Die</strong><br />
Bild: Joschi Herczeg<br />
besten europäischen Manufakturen für Schmuck,<br />
Möbel, Geschirr, Mode und Fahrzeuge arbeiteten<br />
für die Maharadschas. Das Buch dokumentiert die<br />
Hochblüte dieses Luxus sehr eindrücklich. <strong>Die</strong><br />
Maharani Gayatri Devi von Jaipur (im Bild) liess<br />
sich und ihr Seidenkleid durch den Fotografen feiern.<br />
Jost Auf der Maur<br />
Amin Jaffer: Made for Maharajas. Luxus und Design.<br />
Christian-Verlag, München 2007. 276 S., Fr. 124.–.<br />
Bitte senden Sie mir mit Rechnung<br />
Christine Moser, Weltwetter, ISBN 978-3-905810-01-1<br />
CHF 48.–, plus Versandkosten<br />
Anzahl<br />
Vorname, Name<br />
Strasse, Hausnummer<br />
PLZ, Ort<br />
Datum, Unterschrift<br />
Brikett Verlag Zürich AG, Geroldstrasse 5, 8005 Zürich<br />
www.brikett.ch<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 21
BRIDGEMANART<br />
Sachbuch<br />
Sozialgeschichte <strong>Die</strong> Abschaffung der Sklaverei als Vorläuferin einer Bürgerbewegung<br />
Mit modernen Waffen gegen Sklaverei<br />
Adam Hochschild: Sprengt die Ketten.<br />
Der entscheidende Kampf um die<br />
Abschaffung der Sklaverei. Klett-Cotta,<br />
Stuttgart 2007. 504 Seiten, Fr. 49.–.<br />
Von Ina Boesch<br />
In der Westminster Abbey steht die<br />
Statue eines schmächtigen Mannes, der<br />
berühmt war für seine melodiöse Stimme<br />
und heute bekannt ist als einer der<br />
grossen Kämpfer gegen den britischen<br />
Sklavenhandel: William Wilberforce.<br />
Lange stand die Figur des vermögenden<br />
und konservativen Unterhausabgeordneten<br />
allein da, bis man vor zehn <strong>Jahre</strong>n<br />
Gerechtigkeit schuf: Zu Füssen des Politikers<br />
erinnert ein Gedenkstein an einen<br />
Mann, der viele seiner Zeitgenossen<br />
nicht nur körperlich, sondern auch geistig<br />
überragte: Thomas Clarkson.<br />
Petitionen und Zuckerboykott<br />
Der ehemalige Geistliche machte mit<br />
einem Essay zur Sklaverei den Politiker<br />
Wilberforce zum Abolitionisten und zu<br />
seinem überzeugten Mitstreiter. Während<br />
Jahrzehnten bildeten die beiden<br />
auf ihrem «Kreuzzug» gegen den Sklavenhandel<br />
ein erfolgreiches Gespann,<br />
bei dem jeder auf den Part des anderen<br />
angewiesen war. Es brauchte Wilberforce,<br />
der im Parlament lobbyierte und<br />
stundenlange Reden hielt, ebenso wie<br />
Clarkson, der auf seinem Pferd Tausende<br />
von Kilometern ritt und die Bevölkerung<br />
zur Unterzeichnung von Petitionen<br />
oder zum Boykott von Zucker animierte,<br />
um innerhalb von nur zwanzig <strong>Jahre</strong>n<br />
im März 1807 die Abschaffung des britischen<br />
Sklavenhandels zu bewirken.<br />
Nun erweist der amerikanische<br />
Journalist Adam Hochschild, bekannt<br />
22 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
Im 18. Jahrhundert<br />
gehörte die Sklaverei<br />
zum Alltag wie heute<br />
das Auto.<br />
geworden mit einem ähnlich gestrickten<br />
Sachbuch, «Schatten über dem Kongo»,<br />
dem spät wertgeschätzten Clarkson die<br />
ihm gebührende Ehre und stellt ihn ins<br />
Zentrum seiner mitreissend erzählten<br />
Geschichte über die Abschaffung der<br />
Sklaverei. Hochschild setzt sich zwar<br />
nicht als erster Autor mit dem Rotschopf<br />
Clarkson und der britischen Antisklavenhandelbewegung<br />
auseinander, doch<br />
er ist der erste, der dieses Kapitel britischer<br />
Sozialgeschichte so spannend<br />
schildert und zudem überraschende<br />
Bezüge schafft.<br />
Um die schier unvorstellbare Leistung<br />
der ursprünglich zwölfköpfigen,<br />
vorwiegend aus Quäkern bestehenden<br />
Gruppe um Clarkson zu betonen, vergleicht<br />
er deren Initiative mit der heute<br />
undenkbaren Forderung, weltweit das<br />
Auto abzuschaffen. Im 18. Jahrhundert<br />
gehörte die Sklaverei ebenso zum Alltag<br />
wie heute das Auto. Es war damals<br />
normal, dass ein Abgeordneter sagen<br />
konnte, der Sklavenhandel sei «kein<br />
anziehendes Geschäft, aber das ist das<br />
Handwerk des Metzgers nicht, und dennoch<br />
ist ein Hammelkotelett eine feine<br />
Sache». Nicht alle von Hochschild präsentierten<br />
Analogien leuchten gleichermassen<br />
ein, doch es überzeugt seine<br />
Interpretation des Abolitionismus als<br />
«bestorganisierte Bürgerbewegung<br />
aller Zeiten», die agitatorische Mittel,<br />
wie sie heute zivilgesellschaftliche P<strong>rot</strong>estbewegungen<br />
kennen, erstmals oder<br />
zumindest perfektioniert einsetzte.<br />
Wie in der Sardinenbüchse<br />
So störte einer der ersten Warenboykotte<br />
der Geschichte, der Boykott<br />
von Zucker – damals das wichtigste<br />
Schmiermittel der globalen Wirtschaft<br />
–, die Selbstgewissheit der Plantagenbe-<br />
sitzer empfindlich. Und das von Clarkson<br />
und seinen Männern produzierte<br />
Poster mit der schematischen Aufsicht<br />
des Sklavenschiffes «Brookes» erregte<br />
mit seiner Darstellung von unendlich<br />
vielen flach auf dem Boden liegenden<br />
Sklavenkörpern, eng zusammengepresst<br />
wie Sardinen in der Büchse, die Besucher<br />
von Pubs im ganzen Land. Ebenso<br />
modern wie das Poster oder der Boykott<br />
mutet der Einsatz eines Logos an. Das<br />
Bild vom knienden Afrikaner in Ketten<br />
mit flehend erhobenen Händen, darüber<br />
die Worte «Bin ich nicht ein Mensch und<br />
Bruder?», hatte der bekennende Abolitionist<br />
und berühmte Steingutproduzent<br />
Josiah Wedgwood in Auftrag gegeben.<br />
Möglicherweise vertraut Hochschild<br />
seiner Lesart der Bewegung als Vorläuferin<br />
der modernen P<strong>rot</strong>estbewegung<br />
zu sehr, weshalb er andere Fragen aus<br />
dem Blick verliert. Leider diskutiert er<br />
kaum die Ideologien hinter der Abschaffung<br />
des Sklavenhandels – so wie zum<br />
Beispiel die Autoren David, Etemad und<br />
Schaufelbuehl in ihrem Buch «Schwarze<br />
Geschäfte» (2005) plausibel dargelegt<br />
haben, dass der Kampf gegen die Sklaverei<br />
in der Schweiz eigentlich ein Kampf<br />
gegen den moralischen Zerfall der Gesellschaft<br />
war. Und man hätte gern genauer<br />
erfahren, warum der P<strong>rot</strong>est gegen den<br />
Sklavenhandel gerade in Grossbritannien<br />
zum Erfolg führte. Das dichte Strassennetz,<br />
der effiziente Briefverkehr oder<br />
das Aufkommen von Kaffeehäusern förderten<br />
zweifelsohne die Verbreitung der<br />
Idee. Ob aber zwangsrekrutierte Briten<br />
wegen der am eigenen Leib erfahrenen<br />
Knechtschaft tatsächlich empathisch<br />
für die Leiden der Sklaven wurden, sei<br />
dahingestellt. Angesichts der grossartigen<br />
Darstellung ist dies jedoch lediglich<br />
Erbsenzählerei. �
Auswanderung Ein junges jurassisches Paar steigt zur<br />
gesellschaftlichen Elite in Äthiopien auf<br />
Sägereimeister<br />
in Abessinien<br />
Rolf Meier: Briefe aus Abessinien.<br />
Aus dem Leben einer Schweizer<br />
Auswandererfamilie in Äthiopien. Hier<br />
und jetzt, Baden 2007. 160 S., Fr. 29.80.<br />
Von Geneviève Lüscher<br />
Das Bild ist prächtig, um nicht zu sagen<br />
herrschaftlich: Ganz in Weiss und hoch<br />
zu Ross sitzt die junge Dame, sie trägt<br />
lange Handschuhe und einen pompösen<br />
Hut, auf dem Schoss hält sie ein ebenfalls<br />
vollständig weiss gekleidetes Kind.<br />
<strong>Die</strong> Zügel des Pferdes hält ein Schwarzer.<br />
<strong>Die</strong> auf dem Pferd sitzt, ist Jeanne<br />
Evalet-Roth, Tocher eines jurassischen<br />
Uhrenmachers und Frau des Uhrenmachers<br />
Edouard Evalet, der 1898 nach<br />
Äthiopien ausgewandert war.<br />
Das Buch von Rolf Meier, der mit der<br />
Auswandererfamilie entfernt verwandt<br />
ist, basiert auf Unterlagen, die in einer<br />
alten Hutschachtel auf einem lang nicht<br />
mehr geräumten Estrich zum Vorschein<br />
gekommen sind. Meier hat diese Briefe,<br />
Fotografien, Postkarten und Zeitungsausschnitte<br />
gesichtet und das Wichtigste<br />
zusammengefasst. Grau unterlegte<br />
Seiten liefern Hintergrundwissen zur<br />
Vergangenheit Äthiopiens. Entstanden<br />
ist ein kleines Stück kaum bekannte<br />
Schweizer Kolonialgeschichte sowie die<br />
anrührende Familiengeschichte einer<br />
letztlich gescheiterten Auswanderung.<br />
<strong>Die</strong> Gefühle des Autors waren dabei<br />
gemischt: «Man würde lieber darüber<br />
berichten, wie die eigenen Verwandten<br />
in Ostafrika uneigennützig und nachhaltig<br />
zur Entwicklung des armen Landes<br />
beigetragen haben, aber die Briefe zeigen,<br />
dass das Wirtschaften in die eigene<br />
Tasche eine wichtige Rolle spielte.» So<br />
haben die Evalets zum Beispiel mit ihrer<br />
Sägerei der rücksichtslosen Abholzung<br />
des Urwaldes Vorschub geleistet.<br />
<strong>Die</strong> Familie wurde nicht reich in Afrika,<br />
aber es ging ihr gut, mindestens am<br />
Anfang. Edouard Evalet hatte den Jura<br />
auch nicht aus Not verlassen, er wollte<br />
die Welt sehen und etwas erleben. Deswegen<br />
meldete er sich auf ein Stelleninserat,<br />
in dem Kaiser Menelik im fernen<br />
Afrika einen Uhrenmacher suchte.<br />
<strong>Die</strong> Pflege der kaiserlichen Uhrensammlung<br />
war ihm dann aber nicht<br />
genug. Er richtete die erste und lange<br />
Zeit einzige Sägerei im Land ein, versuchte<br />
sich im Waffenhandel und etlichen<br />
anderen Geschäften, die zeitweise<br />
ganz gut liefen. <strong>Die</strong> politische Situation<br />
war aber unsicher, und es war mitunter<br />
schwierig, die richtige Partei am Hof zu<br />
unterstützen. Es war dann vor allem die<br />
skrupellose Abschöpfung der Erträge<br />
durch Kaiser Haile Selassie I., welche<br />
die Evalets an den Rand des Ruins trieb.<br />
Edouard, durch das Klima gesundheitlich<br />
angeschlagen, starb 1943, kurz nach<br />
der italienischen Besetzung.<br />
Jeanne, die 20-jährige tüchtige Modistin,<br />
folgte ihrem Mann mit Begeisterung<br />
ins Ausland. Sie führte bald die Buchhaltung<br />
und leitete die Sägerei, wenn er zur<br />
Edouard und Jeanne<br />
Evalet-Roth und<br />
ihre drei Kinder<br />
(aufgenommen in der<br />
Schweiz).<br />
Kur in die Schweiz fuhr. Das Geldverdienen<br />
machte ihr Spass, und sie versuchte<br />
sich ebenfalls in kleinen Import-Export-<br />
Geschäften, handelte einmal mit Briefmarken,<br />
das andere Mal mit Seifen oder<br />
Seidenstoffen aus Zürich. Als Weisse<br />
gehörten die Evalets zur gesellschaftlichen<br />
Elite, pflegten einen entsprechenden<br />
Lebensstil und nahmen am kaiserlichen<br />
Hofe an vornehmen Anlässen<br />
teil. Selbstverständlich stand ihnen eine<br />
Schar von schwarzen Bediensteten zur<br />
Verfügung.<br />
Nach dem Tod Edouards versuchte<br />
Jeanne, ihren Besitz zu verkaufen, um<br />
in die Heimat zurückzukehren. Sie starb<br />
1973 in Addis Abeba und liegt dort neben<br />
ihrem Mann begraben. Ihre Nachkommen<br />
kehrten in die Schweiz zurück. �<br />
Familie Eberhard Rathgeb philosophiert über Sohn- und Vaterrolle, ohne seine Partnerin zu erwähnen<br />
Pathetisch überhöhtes Vatersein<br />
Eberhard Rathgeb: Schwieriges Glück.<br />
Versuch über die Vaterliebe. Hanser,<br />
München 2007. 159 Seiten, Fr. 27.20.<br />
Von Daniel Puntas Bernet<br />
Der Versuch, den Gründen nachzugehen,<br />
wieso das Wort «Vaterliebe» in<br />
unserem Wortschatz kaum vorkommt<br />
oder ein Mensch sich nie «vaterseelenallein»<br />
fühlt, könnte zu interessanten<br />
Erkenntnissen über Väter führen. Der<br />
«FAZ»-Redaktor Eberhard Rathgeb<br />
unternimmt ihn in diesem Buch und<br />
lotet aus, warum Väter offenbar leichten<br />
Herzens morgens zur Arbeit fahren und<br />
es ihnen nichts ausmacht, ihre Kinder<br />
nur am Wochenende zu erleben. Oder<br />
wieso die Kommunikation zwischen<br />
Vater und Sohn eine schwierigere ist<br />
als zwischen Mutter und Sohn. Leider<br />
bleibt es beim Versuch.<br />
Rathgeb findet darauf keine Antworten.<br />
Sein «Versuch über die Vaterliebe»<br />
liefert weder anregende Unterhaltung<br />
noch vertiefte Analyse. In 52 Kapiteln<br />
schildert der Autor seine Beziehung<br />
zum Vater, romantisiert das Verhältnis<br />
zur Tochter, spricht über die Patchworkfamilien,<br />
welche sich in dieselbe ländliche<br />
Idylle zurückgezogen haben wie<br />
er selbst, und versucht, seine Gedanken<br />
mit Bezügen zur Literatur und Metaphern<br />
aus der Natur zu untermauern.<br />
Lose schweift der Autor von in der<br />
dritten Person formulierten, pathetisch<br />
überhöhten Schilderungen («Als er<br />
selbst, der Sohn, Vater geworden war,<br />
hat er jeden Abend, den er zu Hause sein<br />
konnte, seiner Tochter vorgelesen»)<br />
zu zwischen den Zeilen formulierter<br />
Gesellschaftskritik: «Doch wie wir mit<br />
unseren Eltern umgehen, die wir lieber<br />
ins Altersheim stecken, als daheim<br />
bei uns aufzunehmen, weil wir keinen<br />
Platz und keine Zeit haben, gehen wir<br />
mit unseren Kindern um, die wir wegen<br />
irgendwelcher Glücksversprechen vernachlässigen<br />
oder ganz verlassen.»<br />
Rathgeb moniert, dass das Muttersein<br />
dem Ruf der Natur entspringe,<br />
das Vatersein hingegen eine Verhaltensbe<br />
stimmung sei. Seine Enttäuschung<br />
darüber kann er im stilistisch überstrapazierten<br />
Buch nicht verbergen.<br />
Bezeichnend, dass die Mutter seiner<br />
Tochter in keiner Zeile vorkommt: Es<br />
ist die «Zeit»-Redaktorin und «Literaturclub»-Moderatorin<br />
Iris Radisch, die<br />
kürzlich mit «<strong>Die</strong> Schule der Frauen»<br />
eine gefeierte Analyse über die Familie<br />
vorgelegt hat. �<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 23
Sachbuch<br />
Familie Über den schwierigen Umgang von Erwachsenen mit ihren bedürftigen Eltern<br />
Vom Haus ins Heim<br />
Anonymus: Wohin mit Vater? Ein Sohn<br />
verzweifelt am Pflegesystem. S. <strong>Fischer</strong>,<br />
Frankfurt 2007. 190 Seiten, Fr. 30.60.<br />
Christine Eichel: <strong>Die</strong> Liebespflicht.<br />
Zwischen alten Eltern und kleinen<br />
Kindern. Pendo, München 2007.<br />
229 Seiten, Fr. 32.–.<br />
Cyrille Offermans: Warum sollte ich<br />
meine demente Mutter belügen?<br />
Antje Kunstmann, München 2007.<br />
160 Seiten, Fr. 26.20.<br />
Von Simone von Büren<br />
«Ob wir das mit unseren Eltern einigermassen<br />
anständig hinbekommen, ob wir<br />
sie so pflegen, unterbringen, versorgen,<br />
wie es angemessen wäre, das gehört<br />
nicht zum Kanon der stolz präsentierten<br />
Lebensleistungen», schreibt Christine<br />
Eichel in ihrem Essay «<strong>Die</strong> Liebespflicht».<br />
Womöglich wird sich das bald<br />
ändern. Jedenfalls widmen sich gleich<br />
drei Neuerscheinungen aus Deutschland<br />
und den Niederlanden den Herausforderungen<br />
dieser Aufgabe.<br />
Von einem Tag auf den andern ist die<br />
Mutter nicht mehr da. Was tun mit dem<br />
pflegebedürftigen Vater, der allein im<br />
Wohnzimmer sitzt und sich ohne Hilfe<br />
nicht von der Stelle bewegen kann? Im<br />
autobiografisch geprägten Sachbuch<br />
«Wohin mit dem Vater?» schildert ein<br />
deutscher Journalist distanziert in der<br />
dritten Person und in einer Mischung<br />
aus Erzählung, sachlicher Kritik und<br />
praktischen Informationen, wie er in<br />
kürzester Zeit eine Pflegelösung für<br />
seinen Vater finden muss. Der Generationenvertrag<br />
fordert, dass er die<br />
Betreuung selber übernimmt: «Ich muss<br />
das tun, jedes Kind muss das tun, es ist<br />
das Mindeste, was man seinen Eltern<br />
schuldig ist.» Er hat eine eigene Familie<br />
und Arbeit am andern Ende des Landes.<br />
<strong>Die</strong> verzweifelte Suche nach Alternativlösungen<br />
beginnt.<br />
Pflegerin aus Polen<br />
Ein ganztätiger professioneller Pflegedienst<br />
zu Hause stellt sich schnell als<br />
unbezahlbar heraus. Besuche in verschiedenen<br />
Pflegeheimen in der ungenannt<br />
bleibenden Stadt im Osten Deutschlands<br />
bestätigen seine schlimmsten Befürchtungen:<br />
sedierte Insassen in Doppelzimmern,<br />
Uringeruch, Magensonden<br />
und Katheter, weil Füttern und Toilette<br />
zu zeitaufwendig sind. Zudem wird<br />
klar, dass ein ökonomisches Interesse<br />
an möglichst pflegebedürftigen Patienten<br />
besteht: je schlechter der Zustand,<br />
desto höher die Pflegestufe, desto mehr<br />
Geld vom Staat. Der Sohn realisiert: Den<br />
Vater in eine solche Institution zu geben,<br />
käme einem Akt der Entsorgung gleich.<br />
<strong>Die</strong> Lösung, die er schliesslich findet,<br />
sieht eine Pflegefachfrau aus Polen vor<br />
und ist illegal. Deshalb veröffentlicht er<br />
sein Sachbuch anonym.<br />
Auch die deutsche Autorin Christine<br />
Eichel ist auf der Suche nach einer<br />
Lösung für ihren zunehmend demen-<br />
24 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
ZELCK/LAIF<br />
Leise Aufmerksamkeit<br />
für verwirrte alte<br />
Menschen statt<br />
märtyrerhafter<br />
Aktionismus.<br />
ten Vater. Er ist vorerst in einem Heim<br />
untergebracht. Doch die pflichtbewusste<br />
Tochter hat ein schlechtes Gewissen und<br />
beginnt, sich mit andern Betreuungsmöglichkeiten<br />
auseinanderzusetzen. In<br />
einer leicht verzettelten Mischung aus<br />
eigenen Beobachtungen und Fallbeispielen<br />
thematisiert sie die Probleme,<br />
auf die sie dabei stösst: das schlechte<br />
Gewissen, das erneute Abhängigkeitsverhältnis<br />
zwischen Eltern und Kindern<br />
nach <strong>Jahre</strong>n «planvoll verlernter Nähe»,<br />
die Konfrontation mit dem eigenen<br />
Älterwerden, den Zusammenhang zwischen<br />
Pflegenotstand und individualistischer<br />
Gesellschaft.<br />
Wie schon der Titel ihres Essays zeigt,<br />
stellt sie dabei die moralische Verpflichtung<br />
ins Zentrum und orientiert sich<br />
als Pfarrerstochter stark an christlichen<br />
Werten. Auf eigenartig abstrakte Weise<br />
fordert sie den Eltern gegenüber Liebe<br />
und Aufmerksamkeit, geht aber, abgesehen<br />
von einigen sentimentalen Passagen,<br />
kaum auf den eigenen Vater ein.<br />
Ganz anders Cyrille Offermans in<br />
seinem aufwühlend ehrlichen Essay<br />
«Warum sollte ich meine demente<br />
Mutter belügen». Im Unterschied zu<br />
den beiden andern Autoren, welche die<br />
Möglichkeit, die Eltern selbst zu pflegen,<br />
pflichtbewusst erwägen, dann aber<br />
verwerfen, begleiten der niederländische<br />
Autor und seine Geschwister die an<br />
Alzheimer erkrankte Mutter jahrelang<br />
auf ihrem Weg in die totale Abhängigkeit<br />
und Verwirrung. Mit dem liebevollen<br />
Blick des Sohnes beobachtet Offermans<br />
ihr ununterbrochenes Reden und<br />
die g<strong>rot</strong>esken Rollenspiele, mit denen<br />
sie die wachsenden Löcher im Gedächtnis<br />
zu vertuschen sucht.<br />
Faszinierend genau beschreibt er, wie<br />
mentale, sprachliche und motorische<br />
Abläufe zerbröckeln, bis sie alles «wie<br />
angeleitet von einer unverständlichen<br />
peniblen Gebrauchsanweisung» ausführt.<br />
Witzig und liebevoll<br />
Er verbindet witzige Anekdoten mit philosophischen<br />
Überlegungen und findet<br />
kraftvolle Metaphern für den Zustand<br />
der Mutter: Sie eilt «wie ein schludriges<br />
Gespenst auf der Suche nach einem<br />
Beichtvater durch die Gänge meines<br />
Hirns» oder erinnert ihn an einen<br />
Clown, dessen Bewegungen experimentellen<br />
Charakter haben: «Alle seine<br />
Aktionen sind ein Schlag in die Luft. Zu<br />
keinem Ding hat er noch eine vertraute<br />
Beziehung, jeder Gegenstand ist ihm ein<br />
Hindernis, das er überwinden muss.»<br />
Wenn die Mutter ihm erzählt, sie sei<br />
in einem Leierkasten abgeführt worden,<br />
tut er das nicht als Wahn ab, sondern<br />
respektiert es als Ausdruck ihres Erlebens.<br />
Überhaupt ist er bemüht, sie ernst<br />
zu nehmen. Oft ist aber gar nicht klar,<br />
was das bedeutet: Was tun, wenn sie<br />
seine Fürsorglichkeit als verräterische<br />
Vormundschaft erlebt? Ist es human,<br />
sie möglichst lange für voll zu nehmen?<br />
Oder ist es sinnvoller, zu lügen? Wie<br />
geht man dann mit dem Gefühl um, sie<br />
überlistet zu haben?<br />
Unsicherheit und Schuldgefühle bleiben<br />
auch bei Offermans. Doch sein Buch<br />
zeigt, dass die grosse Leistung nicht in<br />
märtyrerhaftem Aktionismus besteht.<br />
Viel wichtiger ist die leise Aufmerksamkeit,<br />
die den verwirrten alten Menschen<br />
statt als demographische Kategorie<br />
als ein Individuum mit einer eigenen<br />
Geschichte und Emotionalität wahrnimmt<br />
und damit seine Würde bewahrt.<br />
Gelingt einem das, darf man es durchaus<br />
stolz als Lebensleistung präsentieren. �
Bundesratswahlen Der frühere Aargauer SP-Nationalrat Silvio Bircher beschreibt die Abwahl von<br />
Ruth Metzler und die Wahl Christoph Blochers in die Landesregierung 2003<br />
«Parteipolitisierung» im Bundesrat<br />
Silvio Bircher: Wahlkarussell Bundeshaus.<br />
Umstrittene Bundesratswahlen<br />
und Schweizer Politik. AT-Verlag,<br />
Baden 2007. 206 Seiten, Fr. 29.90.<br />
Von Urs Altermatt<br />
«Parlamentswahlen sind auch Bundesratswahlen<br />
geworden.» So steht es im vorliegenden<br />
Buch, das der zweiundsechzigjährige<br />
Aargauer SP-Politiker Silvio Bircher<br />
nach einer dreissigjährigen Laufbahn als<br />
Grossrat, Nationalrat und Regierungsrat<br />
verfasst hat. In Europa sind Regierungsbildungen<br />
ein Abbild der Wahlen und<br />
der nachfolgenden, zum Teil langwierigen<br />
Koalitionsverhandlungen. Insofern<br />
beginnt sich die Schweiz auch in dieser<br />
Beziehung zu europäisieren, wobei sie<br />
die rapide Entwicklung in diese Richtung<br />
paradoxerweise jener Partei verdankt, die<br />
sonst den «Sonderfall Schweiz» bei jeder<br />
Gelegenheit betont.<br />
Nach der Einführung des Proporzwahlrechts<br />
musste die Sozialdemokratie ein<br />
Vierteljahrhundert warten, bis sie 1943<br />
einen und 1959 dank einer Allianz mit den<br />
Christlichdemokraten einen zweiten Sitz<br />
in der Landesregierung erhielt. Für die<br />
Integration der SP in den Bundesrat war<br />
die inhaltliche Konkordanz und nicht der<br />
arithmetische Proporz massgebend. <strong>Die</strong><br />
SP hatte ihr Bekenntnis zur proletarischen<br />
Weltrevolution aufgegeben und die militärische<br />
Landesverteidigung anerkannt.<br />
Bircher beschreibt ausführlich die spannende<br />
Wahl von Christoph Blocher. Nach<br />
den eidgenössischen Wahlen von 2003<br />
warf eine knappe Parlamentsmehrheit<br />
die christlichdemokratische Bundesrätin<br />
Ruth Metzler kurz vor ihrem Präsidialjahr<br />
aus dem Amt. <strong>Die</strong> Parteistrategen der SVP<br />
und der FDP beriefen sich auf die Wahlarithmetik<br />
und gingen kaltschnäuzig über<br />
die von Sozial- und Christlichdemokraten<br />
vorgebrachten Argumente der inhaltlichen<br />
Konkordanz hinweg. In einem Kommentar<br />
nannte ich damals die Abwahl der<br />
Vizepräsidentin Metzler einen «Tabubruch»,<br />
der Folgen habe – indem künftig<br />
auch anderen Bundesräten das gleiche<br />
Schicksal drohen könne.<br />
Wie nie zuvor bei Nationalratswahlen<br />
– dies hebt Silvio Bircher hervor – stehen<br />
die Bundesräte im Zentrum einer eigentlichen<br />
Marketing-Wahlschlacht, die die<br />
SVP zu einem Plebiszit für oder gegen<br />
Christoph Blocher umfunktionierte. 2003<br />
wollte der Freisinn den Volkstribun Blocher<br />
durch den Einbezug in die Landesregierung<br />
bändigen, stattdessen revolutionierte<br />
dieser nicht nur den Stil der<br />
schweizerischen Politik, sondern auch die<br />
eidgenössischen Wahlen.<br />
Der ehemalige Chefredaktor des so -<br />
zialdemokratischen «Freien Aargauers»<br />
beschreibt den Wandel des politischen<br />
Systems in unaufgeregtem Ton und lässt<br />
die Geschichte der «Zauberformel» detailreich<br />
Revue passieren. Im Unterschied zu<br />
andern Autoren vermittelt Silvio Bircher<br />
wenig Klatsch und Tratsch, wenn er auch<br />
der Personalisierung seinen Tribut leistet<br />
und in die Darstellung des politischen<br />
Systems Porträts der sieben Bundesrätinnen<br />
und Bundesräte einstreut. Wer für<br />
die «Parteipolitisierung» des Bundesrates<br />
Belege sucht, findet zahlreiche Beispiele.<br />
Wirklich spannend ist das Buch dennoch<br />
nicht geworden, denn der Politiker Bircher<br />
schlängelt sich um die Grundfrage herum,<br />
ob die Zusammensetzung des Bundesrates<br />
einer blossen Proporzrechnung folgen<br />
soll oder die Konkordanz gerade eine<br />
inhaltliche Übereinstimmung in den politischen<br />
Grundfragen voraussetzt. �<br />
Urs Altermatt ist Professor für<br />
Zeitgeschichte an der Uni Freiburg.<br />
Überwachung Ein Pamphlet von Wolfgang Sofsky – brillant geschrieben, antiquiert im Inhalt<br />
<strong>Die</strong> Zitadelle der Freiheit<br />
Wolfgang Sofsky: Verteidigung des<br />
Privaten. Eine Streitschrift. C. H. Beck,<br />
München 2007. 158 Seiten, Fr. 26.80.<br />
Von Thomas Köster<br />
Wolfgang Sofsky ist ein grimmiger Hüter<br />
des Privaten. In seiner neuen Streitschrift<br />
hat sich der Göttinger Soziologe, mit<br />
dem blendenden Panzer seiner Sprache<br />
gerüstet, auf den Wehrturm gestellt, den<br />
er die «Zitadelle der persönlichen Freiheit»<br />
nennt. Es gilt, das Bollwerk von all<br />
jenem, was kein Fremder sehen, hören,<br />
wissen soll, gegen die allgegenwärtige<br />
Bedrohung von draussen zu beschützen.<br />
«Recht so, Herr Sofsky!», möchte der<br />
Leser zu dieser «Verteidigung des Privaten»<br />
rufen. In einer Zeit, in der Politiker<br />
die Online-Durchsuchung von privaten<br />
Computern als präventives Mittel gegen<br />
Terror verkaufen und E-Mails einen<br />
Umweg über weltweit vernetzte Server<br />
nehmen, die von ausländischen Geheimdiensten<br />
bespitzelt werden, scheint die<br />
Privatsphäre mehr denn je bedroht.<br />
YOSHIKO KUSANO / KEYSTONE<br />
Am Tag der Abwahl:<br />
Bundesrätin Ruth<br />
Metzler, 10. 12. 2003.<br />
Dass dem Leser der spontane<br />
Zuspruch zu Sofskys Thesen dann aber<br />
doch im Hals stecken bleibt, liegt an der<br />
Methode, aber auch am Inhalt des Pamphlets.<br />
Denn der Soziologe argumentiert<br />
weitgehend ohne aktuellen Bezug<br />
und derart polemisch, dass selbst der<br />
demokratischste Sozialstaat im Lichte<br />
martialischer Metaphern wie ein totalitaristisches<br />
Regime erscheint.<br />
«Fern jedes moralischen Anspruchs<br />
kennt die Entwicklung des Staates nur<br />
eine Richtung: Vorwärts in der Entmündigung<br />
und Enteignung der Bürger!»,<br />
schreibt Sofsky – und vergisst in<br />
seinem Zorn auf Steuereintreiber und<br />
Sicherheitsfanatiker, dass die Gefahr,<br />
von Firmen übers Internet, über Kredit-<br />
und Kundenkarten ausspioniert zu<br />
werden, heute schon viel realer ist. «Der<br />
gemeine Untertan wird ohne sein Wissen<br />
und gegen seinen Willen belauscht<br />
und beobachtet», steht da. Dabei muss<br />
man nur eine Talkshow im Privatfernsehen<br />
schauen oder in der Bahn mit einem<br />
jener unzähligen Handygespräche konfrontiert<br />
werden, in denen Mitreisende<br />
ihr Intimstes nach aussen kehren, um<br />
zu begreifen, dass dem grossen Bruder<br />
allzu viele Türen freiwillig geöffnet werden<br />
und die «Zitadelle» des Privaten in<br />
dieser Form längst nicht mehr existiert.<br />
Sofsky scheint dies zu merken und<br />
geht dem Problem aus dem Weg, indem<br />
er als Umfriedung des privaten Bollwerks<br />
nicht einmal mehr das soziale<br />
Band der Freunde und Familie fasst,<br />
sondern nur noch Hirn und Haut des<br />
Individuums. Konsequenterweise endet<br />
die Verteidigung des Privaten mit einem<br />
Kapitel über die Gedankenfreiheit. Nur<br />
die Gedanken sind frei, sagt Sofsky – und<br />
auch nur so lange, bis wir beginnen, sie<br />
mitzuteilen. Sein staatspolitisch radikaler<br />
Liberalismus mündet in asoziale Isolation.<br />
Eine Alternative ist das nicht.<br />
So wirkt diese Streitschrift t<strong>rot</strong>z ihrer<br />
politischen Brisanz seltsam abstrakt und<br />
antiquiert. Was an Wahrem zur alltäglichen<br />
Überwachung und Manipulation<br />
durch Staat, Medien, Gesellschaft und<br />
Religion gesagt wird, haben auch andere<br />
schon gesagt. Vielleicht nicht so schön<br />
und so suggestiv wie Sofsky. �<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 25
Sachbuch<br />
Geschichte Beatrix Mesmer beschreibt den langen Weg der Schweizer Frauen zum Stimmrecht<br />
Enttäuschungen, Demütigungen und Erfolge<br />
Beatrix Mesmer: Staatsbürgerinnen ohne<br />
Stimmrecht. <strong>Die</strong> Politik der schweizerischen<br />
Frauenverbände 1914−1971.<br />
Chronos, Zürich 2007. 360 S., Fr. 58.–.<br />
Von Tobias Kaestli<br />
Im Ersten Weltkrieg traten Frauen in<br />
die Lücken, wo Männer zum Militär<br />
aufgeboten wurden. Bei Kriegsende<br />
hatten der Gemeinnützige Frauenverein,<br />
der Katholische Frauenbund, der<br />
Bund Schweizerischer Frauenvereine<br />
und viele andere grössere und kleinere<br />
Verbände eindrücklich bewiesen, was<br />
längst nicht mehr zu beweisen war: dass<br />
Frauen nicht nur für den Privatbereich<br />
tätig waren, sondern wichtige Arbeiten<br />
im <strong>Die</strong>nst der Allgemeinheit leisteten.<br />
Energisch forderten sie nun das<br />
Frauenstimm- und -wahlrecht. 1918/19<br />
suchte der Schweizerische Verband für<br />
Frauenstimmrecht nach der effektivsten<br />
Strategie, um dieser Forderung zum<br />
Durchbruch zu verhelfen. Obwohl die<br />
Gewerkschaften und die SP in ihrem<br />
Generalstreikprogramm das Gleiche<br />
Das amerikanische Buch Tagebuch eines Insiders aus dem Weissen Haus<br />
Ein Paukenschlag eröffnet die posthum<br />
veröffentlichten Aufzeichnungen Journals<br />
1952–2000 des amerikanischen<br />
Historikers Arthur M. Schlesinger jr.,<br />
(Penguin Press, 894 Seiten). Im März<br />
1952 erklärte US-Präsident Harry Truman<br />
auf einer Gala der Demokraten,<br />
dass er für eine erneute Kandidatur<br />
nicht mehr zur Verfügung stehe. <strong>Die</strong><br />
Einladung zum Abend hatte Schlesinger<br />
von einem Freund erhalten. Mit den<br />
anwesenden Notabeln war der 34-jährige<br />
Sohn eines renommierten Geschichtswissenschafters<br />
bereits damals<br />
bekannt. So begab sich Schlesinger anschliessend<br />
mit Averell Har riman und<br />
Adlai Stevenson zur Nachlese in den<br />
exklusiven Washing toner Metropolitan<br />
Club.<br />
Berühmte Namen, historische Augenblicke,<br />
ein Marathon von Essen und<br />
Partys, bei dem die gutgemixten Martinis<br />
nie ausgingen – die 900 Seiten starken<br />
«Journals» sind ein anregender<br />
Cocktail aus Klatsch, bisher unbekannten<br />
Informationen und scharfsinnigen<br />
Analysen. Sofort nach Erscheinen im<br />
Oktober wurden sie am gleichen Sonntag<br />
in den Buchbeilagen der «Washington<br />
Post» und der «New York Times»<br />
als Aufmacher und sehr positiv besprochen.<br />
Eine dichtgewebte Chronik sind<br />
die Tagebücher nicht; aber aus unzähligen<br />
Episoden entsteht das Porträt einer<br />
Klasse in ihrer Epoche. Schlesingers<br />
Welt ist die einer Elite auf der Achse<br />
Boston–New York–Washington, bevölkert<br />
von Norman Mailer und Gore Vidal,<br />
Lauren Bacall und Gloria Steinem.<br />
Nebenbei treten Judy Garland oder<br />
26 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />
LEN SIRMAN / KEYSTONE<br />
ren Zusammenarbeit. Immerhin unterstützte<br />
der «bürgerliche» Frauenstimmrechtsverband<br />
eine Frauenstimmrechts-<br />
Motion des Sozialdemokraten Herman<br />
Greulich wie auch eine entsprechende<br />
Motion des Freisinnigen Emil Göttisheim.<br />
Zudem lancierte er eine Frauenstimmrechts-Petition.<br />
Alle Bemühungen verliefen im Sand!<br />
Auch auf kantonaler Ebene schickten die<br />
Männer sämtliche Vorstösse zugunsten<br />
eines partiellen oder integralen Frauenstimmrechts<br />
bachab. Nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg wiederholte sich dieses<br />
Trauerspiel. Erst als die Schweiz 1962<br />
dem Europarat beitrat und sich vor die<br />
Aufgabe gestellt sah, die Europäische<br />
Menschenrechtskonvention umzusetzen,<br />
bekam die Forderung nach Gleichberechtigung<br />
der Frauen neuen Schub.<br />
Es dauerte allerdings noch fast ein Jahrzehnt,<br />
bis sie auf Bundesebene durchgesetzt<br />
wurde. Seither kämpft die «neue»<br />
Frauenbewegung für umfassende rechtliche<br />
und gesellschaftliche Gleichberechtigung.<br />
Das alles ist dargestellt in<br />
vielen Einzeluntersuchungen.<br />
<strong>Die</strong> Kennedy-Brüder<br />
Robert, Ted und John<br />
(von links), frühe<br />
1960er <strong>Jahre</strong>. Unten:<br />
Arthur M. Schlesinger.<br />
AP gefordert hatten, kam es zu keiner enge-<br />
Mick Jagger auf, der sich als «humorvoll,<br />
klug und anmutiger Tänzer» entpuppt<br />
und obendrein durch «gutes<br />
Benehmen» überrascht.<br />
Schlesinger hatte es 1952 nach einem<br />
Abstecher in den CIA-Vorläufer OSS<br />
längst zu einer Harvard-Professur und<br />
einem Pulitzerpreis gebracht. Zu Beginn<br />
der «Journals» als Redenschreiber ein<br />
Intimus von Adlai Stevenson, der zweimal<br />
als demokratischer Kandidat gegen<br />
Eisenhower scheiterte, übertrug Schlesinger<br />
seine Loyalität 1959 auf John<br />
F. Kennedy. Ihm ist er als Berater in das<br />
Weisse Haus gefolgt. Schlesinger blieb<br />
dem glamourösen Clan von JFK verbunden,<br />
auch wenn er nach dem Scheitern<br />
der präsidialen Ambitionen Ted Kennedys<br />
1980 kein politisches Amt mehr<br />
übernehmen wollte. Gleichwohl hat bis<br />
zu Bill Clinton noch jeder bedeutende<br />
demokratische Politiker den Rat des<br />
Beatrix Mesmer, emeritierte Berner<br />
Geschichtsprofessorin, legt nun eine eindrückliche<br />
Gesamtschau vor, aus der vor<br />
allem eines ersichtlich wird: <strong>Die</strong> Frauenverbände<br />
mischten sich in das politische<br />
Handeln auf allen Ebenen ein, verhielten<br />
sich «staatstragend», noch bevor sie die<br />
politische Gleichberechtigung errungen<br />
hatten. Dass sie dabei unzählige Enttäuschungen<br />
und Demütigungen erlebten,<br />
versteht sich von selber.<br />
<strong>Die</strong> Autorin schreibt einen kühlen,<br />
leicht ironischen Stil, und t<strong>rot</strong>zdem ist<br />
zu spüren, wie sie mitleidet, sich aber<br />
auch freut, wenn den Frauen ein kluger<br />
Schachzug gelingt. Sie bemüht sich, die<br />
traditionelle Einteilung der Frauenbewegung<br />
in eine bürgerliche und eine sozialdemokratische<br />
Strömung durch eine<br />
exaktere Zuordnung zu überwinden. <strong>Die</strong><br />
Situierung der Frauenverbandstätigkeit<br />
in der männerdominierten Parteien- und<br />
Verbandslandschaft verwischt sich aber<br />
durch ihre manchmal etwas detailversessene<br />
Darstellungsweise. So ist zwar<br />
der Erkenntnisgewinn in Einzelheiten<br />
hoch, aber eine einprägsame Übersicht<br />
ist nur schwer zu gewinnen. �<br />
zierlichen Insiders mit der charakteristischen<br />
Fliege gesucht.<br />
Skandalöses aus dem Leben und Treiben<br />
der von ihm so verehrten Kennedys<br />
hat Schlesinger nicht notiert. Dennoch<br />
betten die Aufzeichnungen historische<br />
Grossereignisse – bis zum Scheitern Al<br />
Gores im November 2000 – in die Zweifel<br />
und Schwächen der P<strong>rot</strong>agonisten<br />
ein. Da beklagt sich der aufstrebende<br />
Henry Kissinger bei Schlesinger, dass<br />
ihn Dean Rusk nicht zu JFK vorlasse.<br />
Auch das starke Geltungsbedürfnis<br />
Schlesingers treibt mitunter bunte Blüten.<br />
So kann er es als 80-Jähriger kaum<br />
verwinden, dass ihm im Haus der «Washington<br />
Post»-Verlegerin Katharine<br />
Graham eine Senatorenwitwe den Weg<br />
zu Prinzessin Diana verstellt.<br />
Schlesinger hat über 20 teilweise monumentale<br />
Bücher über amerikanische<br />
Geschichte geschrieben, so die Klassiker<br />
A Thousand Days: John F. Kennedy in<br />
the White House (Houghton Mifflin<br />
2002) und The Imperial Presidency<br />
(Houghton Mifflin 2004). Wie er neben<br />
allen gesellschaftlichen und politischen<br />
Verpflichtungen für die «Journals» Zeit<br />
fand, ist kaum nachvollziehbar. Dabei<br />
sind diese nur das von seinen Söhnen<br />
Andrew und Stephen erstellte Destillat<br />
aus 6000 Seiten, die Schlesinger seiner<br />
Sekretärin mitunter täglich diktierte. Er<br />
wollte daraus den zweiten Band seiner<br />
Erinnerungen verfassen. Dazu kam es<br />
nicht mehr: Er verstarb im Februar<br />
2007 standesgemäss bei einem Dinner<br />
in Manhattan.<br />
Von Andreas Mink �
Agenda<br />
Bilder einer Stimme Maria Callas<br />
Mailand, im Herbst 1958: <strong>Die</strong> Callas macht sich<br />
in ihrem Schlafzimmer schön. Sie hat ein bewegtes<br />
Jahr hinter sich. Von New York bis London ist sie<br />
frenetisch gefeiert worden, in der Scala hat man<br />
sie als Iphigenie mit 25-minütigem Applaus bedacht,<br />
während sie als Anna Bolena das Publikum polarisiert.<br />
Mit ihrem Gatten, der ihre Gagen heimlich in<br />
die eigene Tasche wirtschaftet, liegt sie in heftigem<br />
Streit. Derweil schickt Aristoteles Onassis ihr Blumen<br />
in die Garderobe, eine Romanze kündet sich an.<br />
Das Leben der Jahrhundert-Diva lässt sich nun in<br />
einem Bildband mit vielen überraschenden Fotos<br />
Bestseller November 2007<br />
Belletristik<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Paulo Coelho: <strong>Die</strong> Hexe von Portobello.<br />
Diogenes. 320 Seiten, Fr. 35.90. (1)<br />
Tim Krohn: Vrenelis Gärtli.<br />
Eichborn. 362 Seiten, Fr. 39.90. (4)<br />
Franz Hohler: Es klopft.<br />
Luchterhand. 175 Seiten, Fr. 31.90. (2)<br />
Khaled Hosseini: Tausend strahlende Son-<br />
nen. Bloomsbury. 381 Seiten, Fr. 38.–. (6)<br />
Henning Mankell: <strong>Die</strong> italienischen Schuhe.<br />
Zsolnay. 365 Seiten, Fr. 38.90. (5)<br />
Julia Franck: <strong>Die</strong> Mittagsfrau.<br />
S. <strong>Fischer</strong>. 432 Seiten, Fr. 35.40. (3)<br />
Pascal Mercier: Lea.<br />
Hanser. 256 Seiten, Fr. 36.–. (–)<br />
Milena Moser: Stutenbiss.<br />
Blessing. 250 Seiten, Fr. 31.90. (7)<br />
Warlam Schalamow: Durch den Schnee.<br />
Matthes & Seitz. 342 Seiten, Fr. 40.30. (–)<br />
Andrea Camilleri: <strong>Die</strong> dunkle Wahrheit des<br />
Mondes. Lübbe. 272 Seiten, Fr. 35.50. (8)<br />
aufblättern. Sie zeigen den Star als junges Pummelchen<br />
und reife Lady, im Pelz und im Bikini, beim Bier<br />
mit einem Berliner Arbeiter, auf ausgelassener Fahrt<br />
unter Freundinnen, lachend, manchmal tobend und<br />
oft auch in sich gekehrt. Maria Callas pflegte nicht<br />
den makellosen Schöngesang, sondern eine kompromisslose<br />
Ausdruckskunst, und sie war keine hübsche<br />
Larve, sondern eine Frau mit einem Gesicht, das man<br />
so wenig vergisst wie ihre Stimme. Manfred Papst<br />
Yann-Brice Dherbier (Hrsg.): Maria Callas.<br />
Bilder eines Lebens. Schwarzkopf & Schwarzkopf,<br />
Berlin 2007. 160 Seiten, Fr. 50.90.<br />
Sachbuch<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Rhonda Byrne: The Secret. Das Geheimnis.<br />
Goldmann. 237 Seiten, Fr. 30.10. (1)<br />
Jacky Gehring: Mit Body Reset attraktiv,<br />
schlank, vital. Sivita. 113 Seiten, Fr. 26.50. (3)<br />
Verena Wermuth: <strong>Die</strong> verbotene Frau.<br />
Woa. 317 Seiten, Fr. 23.–. (2)<br />
Richard Dawkins: Der Gotteswahn.<br />
Ullstein. 574 Seiten, Fr. 39.90. (–)<br />
André Gorz: Brief an D.<br />
Rotpunktverlag. 97 Seiten, Fr. 24.–. (–)<br />
Walter Raaflaub: Tote Hose.<br />
Wörterseh. 317 Seiten, Fr. 34.90. (10)<br />
Moritz Leuenberger: Lüge, List und Leiden-<br />
schaft. Limmat. 221 Seiten, Fr. 32.–.(5)<br />
Titus Arnu: Langenscheidt Übelsetzungen.<br />
Langenscheidt. 128 Seiten, Fr. 18.60. (8)<br />
Roberto Saviano: Gomorrha.<br />
Hanser. 384 Seiten, Fr. 38.70. (4)<br />
Hape Kerkeling: Ich bin dann mal weg.<br />
Malik. 353 Seiten, Fr. 35.40. (6)<br />
Erhebung im Auftrag des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbands SBVV; 25. 10. 2007. Preise laut Angaben von www.buch.ch.<br />
Agenda November 07<br />
Basel<br />
Montag, 5. November, 20.30 Uhr<br />
Zoë Jenny: Das Portrait. Lesung, Fr. 15.–.<br />
Atlantis, Klosterberg, Tel. 061 264 26 55.<br />
Donnerstag, 15. November, 19 Uhr,<br />
19.45 Uhr, 20.30 Uhr<br />
-minu: Der etwas andere Alltag. Tramlesung.<br />
Abfahrten ab Aeschenplatz, Fr. 8.–.<br />
Plätze limitiert; Tel 061 264 26 55.<br />
Freitag, 23. November, 19 Uhr<br />
Eduardo Mendoza: Mauricios Wahl.<br />
Lesung und Gespräch, Fr. 15.–. Literaturhaus,<br />
Barfüssergasse 3, Tel. 061 261 29 50.<br />
Bern<br />
Mittwoch, 7. November, 20 Uhr<br />
Lukas Hartmann: Spuren in der Polenta.<br />
Kinderbuchvernissage. Eintritt frei.<br />
Thalia Buch im Loeb. Tel. 031 320 20 20.<br />
Mittwoch, 14. November, 12 Uhr<br />
Mittagspause mit Astrid Lindgren.<br />
Kornhausbibliothek, Kornhausplatz 18,<br />
Tel. 031 327 10 26.<br />
Mittwoch, 14. November, 20 Uhr<br />
Rüdiger Safranski: Romantik.<br />
Vortrag und Lesung.<br />
Fr. 15.–. Stauffacher<br />
Buchhandlung,<br />
Neuengasse 25–37,<br />
Tel. 031 313 63 63.<br />
Zürich<br />
Donnerstag, 8. November, 20 Uhr<br />
David Albahari: <strong>Die</strong> Ohrfeige. Lesung<br />
und Gespräch, Fr. 15.– inkl. Apéro.<br />
Literaturhaus, Limmatquai 62,<br />
Tel. 044 254 50 00.<br />
<strong>Die</strong>nstag, 20. November, 20 Uhr<br />
Mircea Cǎrtǎrescu: <strong>Die</strong> Wissenden.<br />
Lesung und Gespräch, Fr. 15.– inkl.<br />
Apéro. Literaturhaus, Limmatquai 62,<br />
Tel. 044 254 50 00.<br />
<strong>Die</strong>nstag, 27. November, 20 Uhr<br />
Davide Longo: Der Steingänger. Lesung<br />
und Gespräch, Fr. 15.– inkl. Apéro.<br />
Literaturhaus, Limmatquai 62,<br />
Tel. 044 254 50 00.<br />
Verschiedene Orte<br />
Luzern, Mittwoch, 14. November, 20 Uhr<br />
Kurt Steinmann: Odysee von Homer.<br />
Neuübersetzung. Lesung. Orell Füssli,<br />
Frankenstr. 7–9, Tel. 041 229 60 20.<br />
Schaffhausen, Mittwoch, 21. November,<br />
20 Uhr<br />
Judith Giovanelli-Blocher: Woran wir<br />
wachsen. Lesung, Fr. 12.–. Thalia Bücher,<br />
Vordergasse 77, Tel. 052 632 40 50.<br />
Winterthur, Montag,<br />
19. November,<br />
20 Uhr<br />
Christina Viragh:<br />
Im April. Lesung.<br />
Volkarthaus,<br />
Turnerstrasse 1,<br />
Tel. 052 267 51 08.<br />
4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 27<br />
ISOLDE OHLBAUM